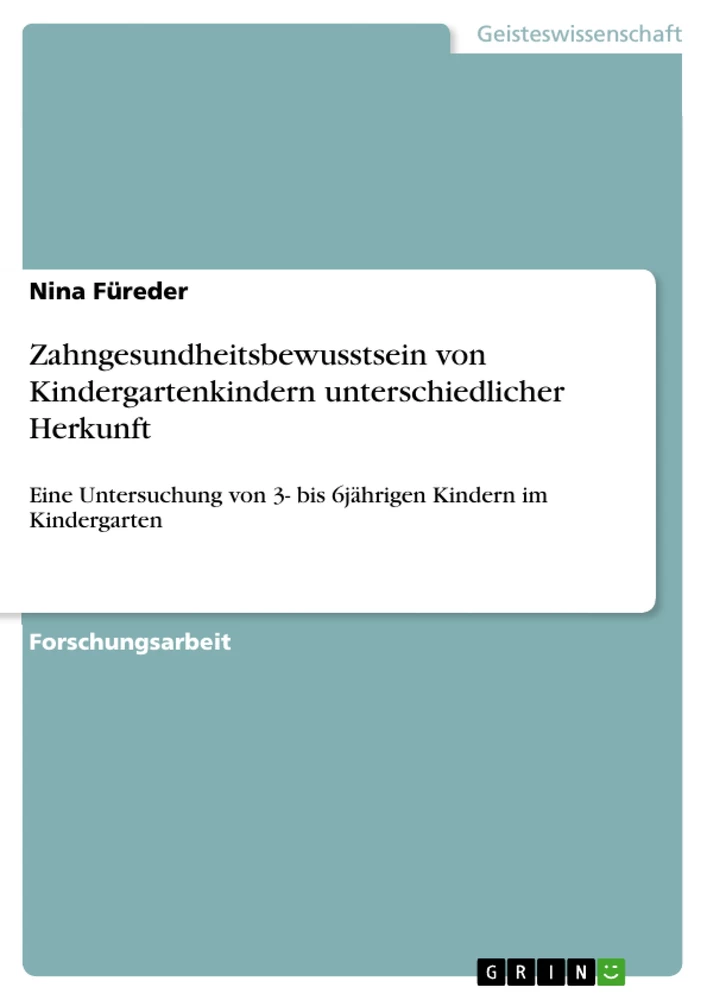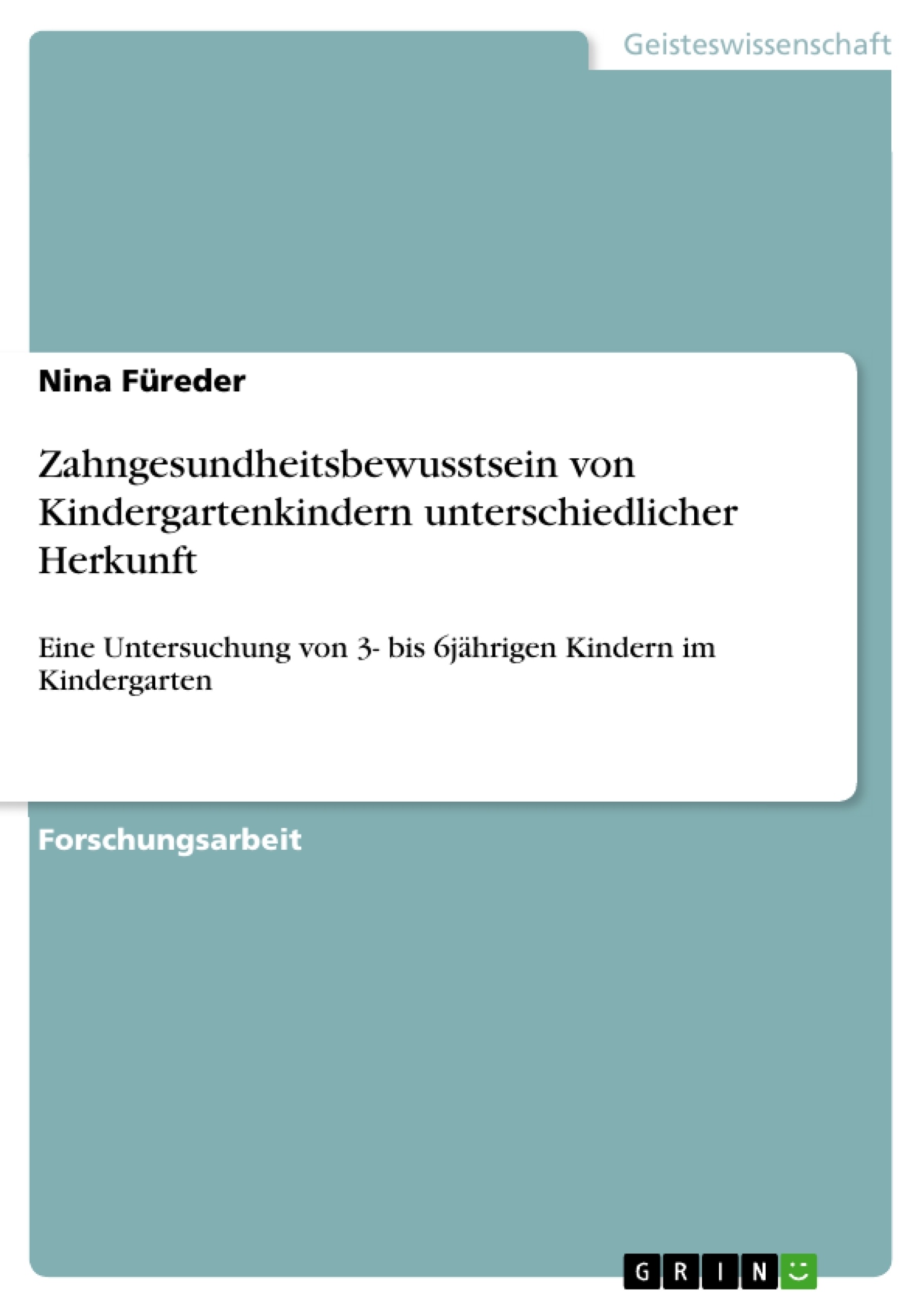Der heutige Wissensstand zur Ätiologie und Pathogenese der Karies ist so gut, dass durch den Einsatz präventiver Maßnahmen ein deutlicher Kariesrückgang erzielt werden kann.
In den letzten Jahren wurde bereits und vor allem in den Industrienationen ein Rückgang der Kariesprävalenz nachgewiesen, wobei dies in erhöhtem Maße die Zähne der bleibenden Dentition betrifft. Die Zahngesundheit im Milchgebiss weist geringere Erfolge auf, es wird sogar ein Wiederanstieg der Milchzahnkaries beobachtet.
Im Ergebnis des allgemeinen Kariesrückgangs zeigt sich insbesondere im Milchgebiss, dass dies für Kinder sozial benachteiligter Gruppen, sowie für Kinder aus Migrantenfamilien nicht gilt. Dieser Effekt wird „Polarisation des Kariesbefalls“ genannt, d.h. bei einem minimalen Anteil der Bevölkerung gibt es eine hohe Konzentration von kariösen Läsionen. Die Ursachen für die großen Unterschiede in der Zahngesundheit sieht man in der sozialen Schichtung – je niedriger der soziale Status, welcher mit niedrigem Bildungsgrad und geringer sozialer Integration einhergeht, desto schlechter der Zustand der Zähne, so Micheelis/Bauch 1991 , 1993; Micheelis/Reich 1999. Geringeres Bildungsniveau der Eltern, geringes Einkommen, Sprachbarrieren, sowie kulturelle Unterschiede bei den Ernährungsgewohnheiten und Hygienemaßstäben stehen hier im Vordergrund. Viele Familien mit Migrationshintergrund sind betroffen.
Die MigrantInnen bilden eine äußerst inhomogene Gruppe. Kulturelle und sprachliche Unterschiede zersplitten die Einwanderer aus über 150 Ländern in viele Subkulturen, deshalb scheinen sie nicht gleichmäßig an der fortschreitenden Verbesserung der Zahngesundheit zu partizipieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINFÜHRUNG
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Ziele und Gang der Arbeit_
- 1.3. Forschungsfragen
- 2. ZAHNMEDIZINISCHE GRUNDLAGEN
- 2.1. Aufbau der Zähne
- 2.1.1. Zahnschmelz
- 2.1.2. Zahnbein
- 2.1.3. Zahnmark
- 2.1.4. Zahnhalteapparat
- 2.1.5. Zahnfleisch
- 2.2. Systematische Einteilung und Bezifferung der Zähne
- 2.3. Kennwerte der Zahngesundheit
- 2.3.1. DMF T/S-Wert
- 2.3.2. Morbidität
- 2.3.3. Kariesinzidenz
- 2.3.4. Kariesprävalenz
- 2.4. Karies und Plaque
- 2.4.1. Ätiologie
- 2.4.2. Epidemiologie
- 2.5. Mundhygienetechniken
- 2.5.1. Modifizierte Zahnputzmethode nach Bass
- 2.5.2. KAI-Methode
- 2.6. Prophylaxe
- 2.6.1. Primarprävention
- 2.6.2. Sekundärprävention
- 2.6.3. Tertiärprävention
- 2.7. Zusammenhang von Ernährung und Zahngesundheit
- 2.8. Vorkommen und Wirkung von Fluoriden
- 2.8.1. Tablettenfluoridierung
- 2.8.2. Trinkwasserfluoridierung
- 2.8.3. Salzfluoridierung
- 3. MIGRATION UND GESUNDHEIT
- 3.1. Gesundheitliche Lage
- 3.1.1. Migranten und Migrantinnen
- 3.1.2 Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
- 3.2. Probleme - Positionen - Perspektiven_
- 4. THEORETISCHER UND GESUNDHEITSPOLITISCHER\nHINTERGRUND DER ZAHNGESUNDHEITSFÖRDERUNG
- 4.1. Salutogenese von Antonovsky
- 4.1.1 Gesundheits-Krankheits-Kontinuum
- 4.1.2. Kohärenzgefühl
- 4.2. Zielsetzung der Weltgesundheitsorganisation für die Zahngesundheit
- 4.3. Soziale Ungleichheit und Zahngesundheit
- 5. PROPHYLAXEPROGRAMM
- 5.1. Individual- und Gruppenprophylaxe
- 5.2. Persönlicher Nutzen durch gute Mundgesundheit
- 5.3. Ökonomischer Nutzen der Gruppenprophylaxe
- 5.4. Gruppenprophylaxe in Österreich
- 5.5. Modellprojekt „Verein für prophylaktische Gesundheitsarbeit“ im Kindergarten
- 5.5.1. Ziele der Zahngesundheitsförderung des PGA
- 5.5.2. Inhalte der Betreuung im Kindergarten
- 5.5.3. Elternabende
- 6. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG: ZAHNGESUNDHEIT IM\nKINDERGARTEN
- 6.1. Ausgangslage und Problemstellung
- 6.2. Methodik
- 6.2.1. Beschreibung der Zielpopulation, Auswahlkriterien und Response
- 6.2.2. Design und Methode der Studie
- 6.2.3. Studienziele und Forschungsfragen
- 6.2.4. Statistische Auswertung
- 6.2.5. Hypothesen
- 6.3. Darstellung der Ergebnisse der Elternbefragung
- 6.3.1. Fragen zum Zahnpflegeverhalten
- 6.3.2. Fragen zur Anwendung von Fluoriden
- 6.3.3. Inanspruchnahme zahnmedizinischer Leistungen
- 6.3.4. Fragen zu den Ernährungsgewohnheiten
- 6.3.5. Angaben zur Familie
- 6.3.6. Bildung der Mütter und Zahnpflegeverhalten der Kinder
- 6.3.7. Bildung der Mutter und Ernährungsgewohnheiten
- 6.3.8. Bildung der Mutter und Anwendung von Fluoriden
- 6.3.9. Bildung der Mutter und Inanspruchnahme zahnärztlicher Leistungen_
- 6.4. Diskussion der Auswertungen der Elternbefragung
- 7. VORSCHLÄGE ZUR VERBESSERUNG DES MUND-\nGESUNDHEITSBEWUSSTSEINS IN DEN FÜNF AUSGEWÄHLTEN\nKINDERGARTEN
- 7.1. Vorbildwirkung der Eltern auf die Zahngesundheit der Kinder
- 7.2. Zahngesunde Ernährung und Fluoridierung
- 7.3. Ausweitung der Vorsorgeuntersuchung bei Schwangeren und Kleinkindern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Zahngesundheitsbewusstsein von Kindergartenkindern unterschiedlicher Herkunft. Das Ziel der Arbeit ist es, die Zahngesundheit von 3-6jährigen Kindern in einem Kindergarten zu untersuchen und Faktoren zu identifizieren, die das Zahngesundheitsbewusstsein der Kinder beeinflussen.
- Zahngesundheitsbewusstsein von Kindern
- Einflussfaktoren auf Zahngesundheit
- Migrationshintergrund und Zahngesundheit
- Prophylaxe und Präventionsmaßnahmen
- Empirische Untersuchung von Zahngesundheit im Kindergarten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Problemstellung und erläutert die Ziele und Forschungsfragen der Untersuchung. Kapitel 2 beleuchtet die zahnmedizinischen Grundlagen, die für die Studie relevant sind, inklusive des Aufbaus der Zähne, Kennwerte der Zahngesundheit, Karies und Plaque, Mundhygienetechniken, Prophylaxe sowie den Zusammenhang zwischen Ernährung und Zahngesundheit. Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Themenkomplex Migration und Gesundheit, wobei die gesundheitliche Lage von Migranten und Migrantinnen sowie von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund fokussiert wird.
Kapitel 4 behandelt den theoretischen und gesundheitspolitischen Hintergrund der Zahngesundheitsförderung. Dabei werden Konzepte wie die Salutogenese von Antonovsky, die Zielsetzung der Weltgesundheitsorganisation für die Zahngesundheit und der Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und Zahngesundheit beleuchtet. Kapitel 5 widmet sich dem Thema Prophylaxe und Prävention. Es werden verschiedene Modelle der Individual- und Gruppenprophylaxe sowie die ökonomischen Vorteile von Gruppenprophylaxe in Österreich vorgestellt.
Kapitel 6 stellt die empirische Untersuchung der Zahngesundheit im Kindergarten vor. Es beschreibt die Methodik, die Studiendesigns, die Auswahl der Zielpopulation, die statistische Auswertung sowie die Ergebnisse der Elternbefragung. Schließlich werden im letzten Kapitel 7 Vorschläge zur Verbesserung des Mundgesundheitsbewusstseins in den fünf ausgewählten Kindergärten präsentiert.
Schlüsselwörter
Zahngesundheit, Kindergartenkinder, Migrationshintergrund, Prophylaxe, Prävention, Mundhygiene, Fluoride, Ernährungsgewohnheiten, Elternbefragung, empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die "Polarisation des Kariesbefalls"?
Es bedeutet, dass ein Großteil der Karieserkrankungen auf einen kleinen, meist sozial benachteiligten Teil der Bevölkerung konzentriert ist.
Wie beeinflusst der Migrationshintergrund die Zahngesundheit?
Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede bei Ernährungsgewohnheiten und ein geringerer Zugang zu präventiven Maßnahmen führen oft zu einem schlechteren Zahnzustand bei Kindern aus Migrantenfamilien.
Was ist der DMF-T/S-Wert?
Es ist ein internationaler Kennwert für die Zahngesundheit, der die Anzahl der zerstörten (decayed), fehlenden (missing) und gefüllten (filled) Zähne oder Flächen angibt.
Welche Prophylaxemethoden werden für Kinder empfohlen?
Empfohlen werden die KAI-Putzmethode, die Anwendung von Fluoriden (Salz, Tabletten oder Zahnpasta) sowie regelmäßige Gruppenprophylaxe im Kindergarten.
Welchen Einfluss hat die Bildung der Mutter auf die Zähne des Kindes?
Studien zeigen einen direkten Zusammenhang: Ein höheres Bildungsniveau der Mutter korreliert oft mit besserem Zahnpflegeverhalten und gesünderen Ernährungsgewohnheiten der Kinder.
- Arbeit zitieren
- Nina Füreder (Autor:in), 2010, Zahngesundheitsbewusstsein von Kindergartenkindern unterschiedlicher Herkunft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158013