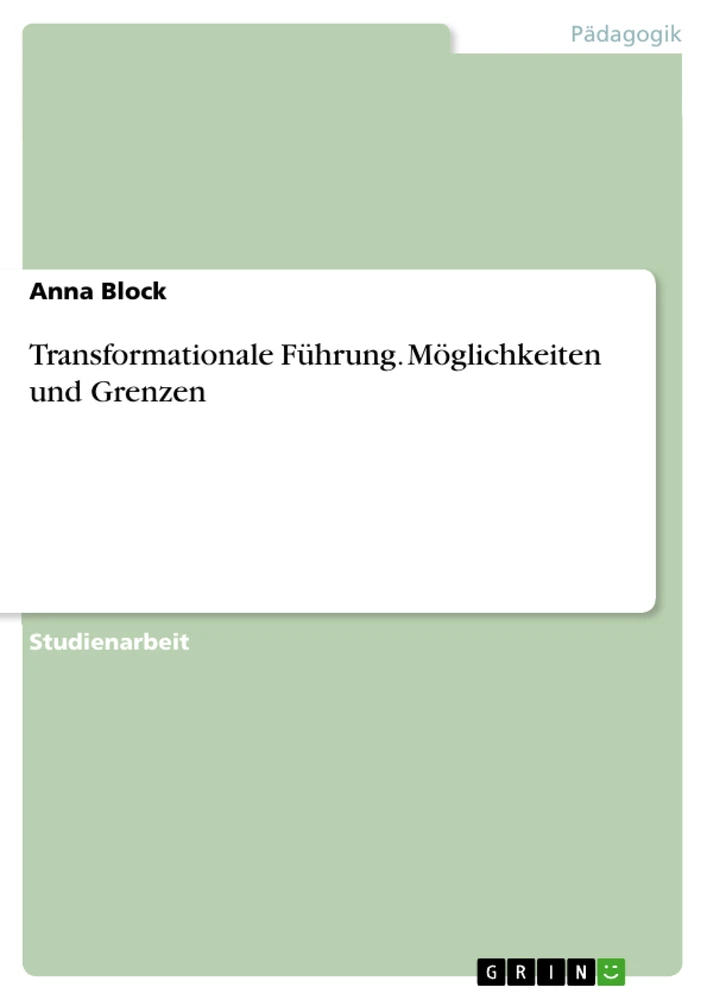Was sind die Möglichkeiten, die sich durch transformationale Führung eröffnen und welchen Grenzen unterliegt sie? Um sich dieser Fragestellung nähern zu können, wird nach einer kurzen Beschäftigung mit dem Begriff der Führung, transformationale Führung zunächst in die Führungstheorien eingeordnet, um sie dann von transaktionaler und charismatischer Führung abgrenzen zu können. Da sich verschiedene Theoretiker mit transformationaler Führung beschäftigt haben wird darauf folgend exemplarisch Bass´ Modell transformationaler Führung vorgestellt, das meiner Meinung nach die wichtigste Theorie dieser Konzeption darstellt. Anschließend sollen sowohl die Möglichkeiten, als auch die Grenzen transformationaler Führung aufgezeigt werden, um ein Fazit hinsichtlich der Effektivität transformationaler Führung ziehen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- WAS IST FÜHRUNG?
- EINORDNUNG VON TRANSFORMATIONALER FÜHRUNG IN DIE FÜHRUNGSTHEORIEN
- BEGRIFFSBESTIMMUNG TRANSFORMATIONALER, CHARISMATISCHE UND TRANSAKTIONALER FÜHRUNG.
- TRANSFORMATIONALE FÜHRUNG.
- CHARISMATISCHE FÜHRUNG
- TRANSAKTIONALE FÜHRUNG.
- TRANSFORMATIONALE FÜHRUNG NACH BASS: THE FULL RANGE OF LEADERSHIP.....
- MÖGLICHKEITEN TRANSFORMATIONALER FÜHRUNG.....
- EMPIRISCH GESICHERTE ERGEBNISSE.
- DER EINFLUSS VON KONTEXTFAKTOREN
- GRENZEN VON TRANSFORMATIONALER FÜHRUNG.
- PRAKTISCHE GRENZEN
- DER EINFLUSS VON KONTEXTFAKTOREN
- ETHISCHE GRENZEN
- TRANSFORMATIONALE FÜHRUNG ALS MANIPULATION?
- FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der transformationalen Führung. Sie untersucht die Möglichkeiten und Grenzen dieser Führungstheorie und befasst sich mit den spezifischen Merkmalen und Einflussfaktoren, die zum Erfolg oder Misserfolg dieser Führungsform beitragen können. Der Fokus liegt auf der Klärung des Konzepts der transformationalen Führung, ihrer Einordnung in die Führungstheorien und ihrer Abgrenzung von transaktionale und charismatischer Führung.
- Die Einordnung der transformationalen Führung in die Führungstheorien
- Die Möglichkeiten der transformationalen Führung
- Die Grenzen der transformationalen Führung
- Der Einfluss von Kontextfaktoren auf die transformationalen Führungserfolg
- Die ethischen Aspekte der transformationalen Führung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Führungsforschung und die Relevanz der transformationalen Führung als eine vielversprechende Führungstheorie einführt. Im Anschluss wird der Begriff der Führung allgemein definiert und verschiedene theoretische Ansätze vorgestellt.
Die Arbeit setzt sich mit der Einordnung der transformationalen Führung in die Führungstheorien auseinander und stellt die wichtigsten Ansätze im Bereich der Führungsforschung vor. Dabei wird zwischen universellen und situativen Führungsmethoden sowie Eigenschafts- und Verhaltenstheorien unterschieden. Im Anschluss wird die transformationalen Führung von transaktionale und charismatischer Führung abgegrenzt.
Im nächsten Kapitel wird das Modell der transformationalen Führung nach Bass vorgestellt. Das Kapitel beleuchtet die verschiedenen Facetten der transformationalen Führung, die in diesem Modell beschrieben werden.
Die Arbeit analysiert anschließend die Möglichkeiten der transformationalen Führung. Dabei wird auf empirisch gesicherte Ergebnisse aus der Forschung sowie auf den Einfluss von Kontextfaktoren eingegangen.
Abschließend werden die Grenzen der transformationalen Führung analysiert. Die Arbeit beleuchtet sowohl praktische Grenzen als auch den Einfluss von Kontextfaktoren und ethische Aspekte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Begriffe der Führungsforschung, insbesondere die transformationalen Führung. Es werden wichtige theoretische Ansätze wie transaktionale und charismatische Führung, sowie verschiedene Führungstheorien, wie die von Bass, beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Was ist transformationale Führung?
Ein Führungsstil, bei dem Führungskräfte ihre Mitarbeiter inspirieren, motivieren und deren Werte und Ziele transformieren, um außergewöhnliche Leistungen zu erzielen.
Wie unterscheidet sie sich von transaktionaler Führung?
Transaktionale Führung basiert auf einem Austauschverhältnis (Belohnung gegen Leistung), während transformationale Führung auf Visionen und persönlicher Entwicklung beruht.
Was beinhaltet das Modell von Bass ("Full Range of Leadership")?
Das Modell beschreibt ein Spektrum von Führungsverhalten, das von Laissez-faire über transaktionale bis hin zu transformationalen Elementen reicht.
Wo liegen die ethischen Grenzen der transformationalen Führung?
Es besteht die Gefahr der Manipulation, wenn charismatische Führungskräfte ihre Macht missbrauchen, um Mitarbeiter für egoistische oder unethische Ziele zu instrumentalisieren.
Welchen Einfluss haben Kontextfaktoren auf den Führungserfolg?
Der Erfolg hängt stark von der Unternehmenskultur, der Krisenanfälligkeit der Branche und der persönlichen Reife der geführten Mitarbeiter ab.
- Arbeit zitieren
- Anna Block (Autor:in), 2010, Transformationale Führung. Möglichkeiten und Grenzen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158023