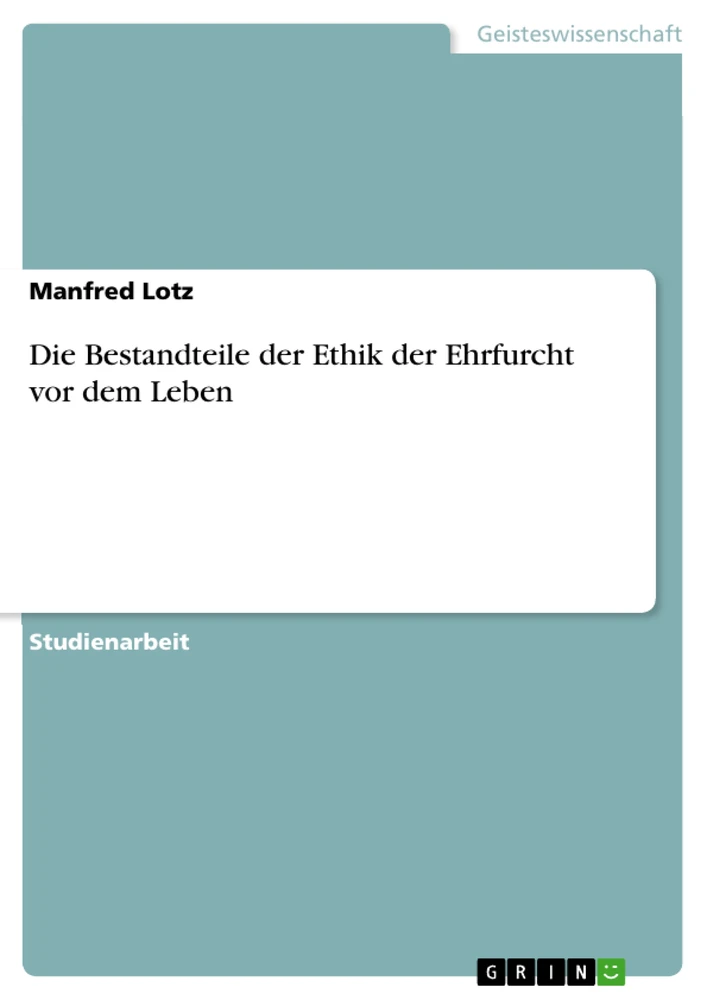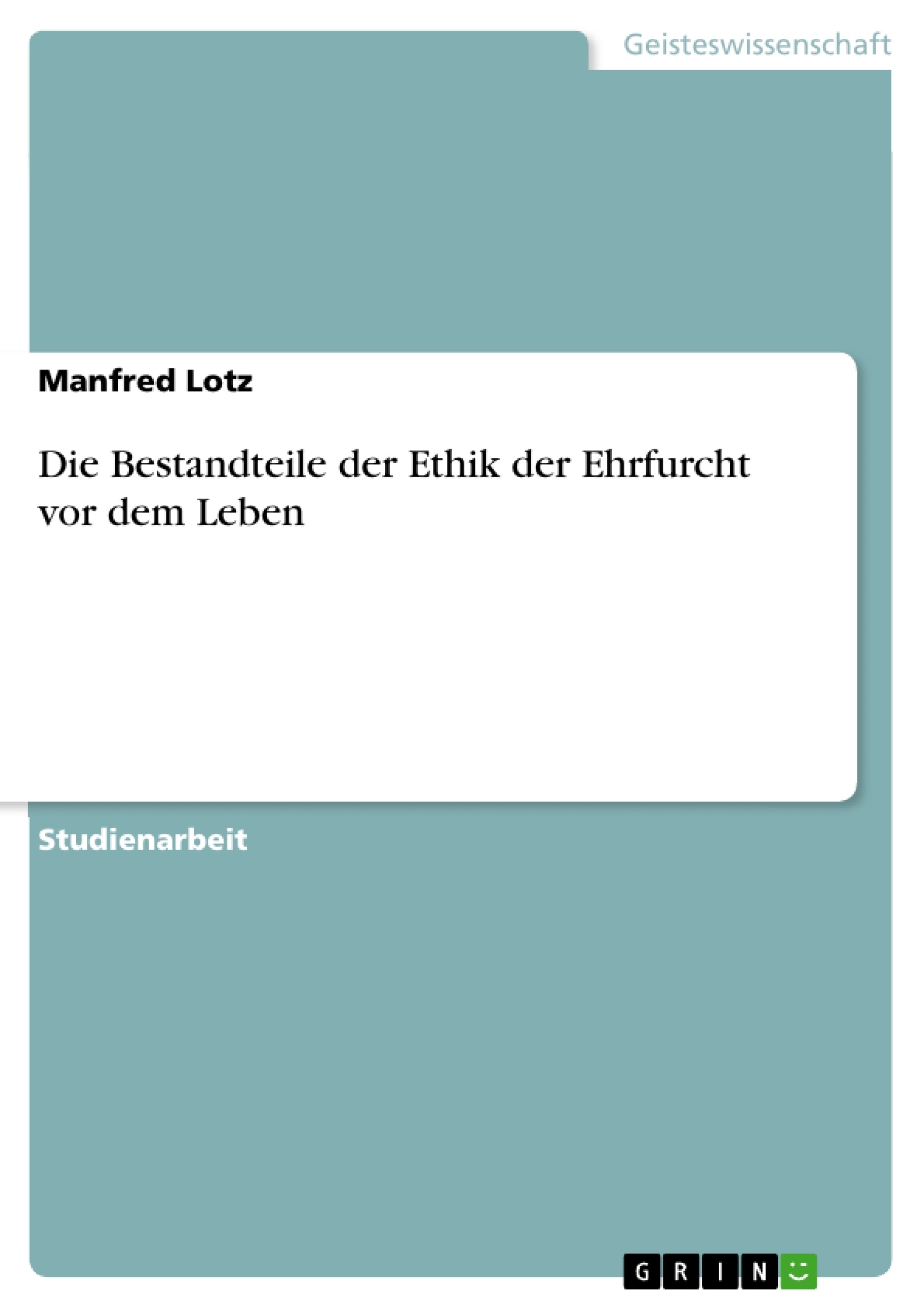Darstellung des Themas
Nur wenige Geisteswissenschaftler genießen ein Ansehen in der Bevölkerung, das dem Schweitzers
nahe kommt.1 Der Urwaldarzt aus Passion gilt als einer der angesehensten Denker des zwanzigsten
Jahrhunderts. In der Fachwelt hingegen stößt das Werk des „Außenseiters“2 auf Widerspruch3,
Widerwillen und Unverständnis. Seine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben steht im Zentrum seiner
Philosophie. Er stützt seine Ethik auf Kant in der Methodik4, Schopenhauer in weiten Teilen der
Terminologie5 und die Mystik6 in Bezug auf das Denken.7 Mit Schopenhauer einhergehend bezieht er
sich häufig auf die asiatische Philosophie und besonders auf das buddhistische Gedankengut.8
Bei einer derart vielfältigen Zusammensetzung stellt sich die Frage von selbst, ob das überhaupt
zusammenpassen kann ohne, dass Schweitzer sich unrettbar in Widersprüche verstrickt?
1 Vgl. Chattopadhyaya, 1966 S.50. Diesen Aufsatz habe ich als Beleg dafür herangezogen, dass Schweitzers auch in
Indien bekannt ist.
2 Vgl. Günzler, 1996, S. 2. Die Bezeichnung „Außenseiter“ passt wirklich besser zu einem selbsternannten
„Philosophen“, als zu einem Doktor der Philosophie. Seine Dissertation handelt von Kants Religionsphilosophie
(siehe unten).
3 Vgl. J.C.
Wolf.
4 Vgl. Günzler, 1996 S. 59.
5 So zum Beispiel auf den Ausdruck „Wille zum Leben“.
6 Ob diese mittelalterlich oder fernöstlich ist, sei dahingestellt.
7 Vgl. Werner, 1990.
8 Vgl. Meyer, 1994.
Auf diese Frage soll diese Hausarbeit eine Antwort geben.
Inhaltsverzeichnis
- Darstellung des Themas
- Der kantische Anspruch
- Schopenhauer
- Wie wirkt sich der Wille zum Leben auf die Welt- und Lebensanschauung aus?
- Der Wille zum Leben bei Schweitzer
- Die Selbstentzweiung des Willens zum Leben
- Die,,indischen Denker"
- Die mittelalterliche Mystik
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit Albert Schweitzers Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben und analysiert, wie er seine Philosophie auf die Werke von Kant und Schopenhauer stützt. Ziel ist es, die Verbindungen und Unterschiede zwischen Schweitzers Denken und den beiden Philosophen aufzuzeigen und die Frage zu beantworten, ob seine Philosophie trotz der vielfältigen Einflüsse widerspruchsfrei ist.
- Der kantische Einfluss auf Schweitzers Ethik
- Die Rolle des Willens zum Leben in Schweitzers Philosophie
- Die Verbindung zwischen Schopenhauers Welt- und Lebensverneinung und Schweitzers Lebensbejahung
- Schweitzers Kritik an Kants Ethik
- Die Relevanz der mittelalterlichen Mystik für Schweitzers Denken
Zusammenfassung der Kapitel
- Darstellung des Themas: Der Abschnitt stellt Albert Schweitzer und sein Werk vor. Er erläutert, warum Schweitzers Philosophie sowohl Anerkennung als auch Kritik findet und warum er als „Außenseiter“ bezeichnet wird.
- Der kantische Anspruch: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss von Immanuel Kant auf Schweitzers Ethik. Schweitzer teilt Kants Kritik an der empirischen Welt, möchte aber gleichzeitig seine Ethik auf die reale Welt anwenden. Er kritisiert Kant für seine „praxisferne“ Denkweise und dessen Reduktion der empirischen Realität.
- Schopenhauer: In diesem Kapitel wird die Verbindung zwischen Schweitzers Ethik und der Philosophie Arthur Schopenhauers untersucht. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Bezug auf den Willen zum Leben und die Rolle des Intellekts hervorgehoben.
- Wie wirkt sich der Wille zum Leben auf die Welt- und Lebensanschauung aus?: Der Abschnitt beleuchtet die Auswirkungen des Willens zum Leben auf die Welt- und Lebensanschauung nach Schopenhauer. Er erklärt die Selbstentzweiung des Willens zum Leben und die damit verbundene Welt- und Lebensverneinung.
- Der Wille zum Leben bei Schweitzer: Dieser Abschnitt zeigt, wie Schweitzer Schopenhauers „Wille zum Leben“ übernimmt und ihn für seine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben nutzt. Er beschreibt Schweitzers Konzept von einem allgegenwärtigen Willen zum Leben, der sich sowohl in Tieren als auch in Pflanzen und Gegenständen manifestiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe in dieser Arbeit sind: Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben, kantischer Einfluss, Schopenhauer, Wille zum Leben, Welt- und Lebensanschauung, Lebensbejahung, Selbstentzweiung, Mystik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Zentrum von Albert Schweitzers Philosophie?
Das Zentrum seiner Philosophie ist die „Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben“.
Auf welchen Denkern basiert Schweitzers Ethik?
Schweitzer stützt sich methodisch auf Kant, terminologisch auf Schopenhauer und inhaltlich auf die Mystik sowie asiatisches Gedankengut.
Was übernimmt Schweitzer von Schopenhauer?
Er übernimmt den Begriff des „Willens zum Leben“, wandelt Schopenhauers Lebensverneinung jedoch in eine aktive Lebensbejahung um.
Wie kritisiert Schweitzer Immanuel Kant?
Er kritisiert Kants Ethik als zu praxisfern und bemängelt die Reduktion der empirischen Realität in dessen Denken.
Warum wird Schweitzer oft als „Außenseiter“ der Fachwelt bezeichnet?
Während er in der Bevölkerung hohes Ansehen genießt, stößt sein Werk in der akademischen Philosophie oft auf Unverständnis oder Widerspruch.
- Quote paper
- Manfred Lotz (Author), 2008, Die Bestandteile der Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158065