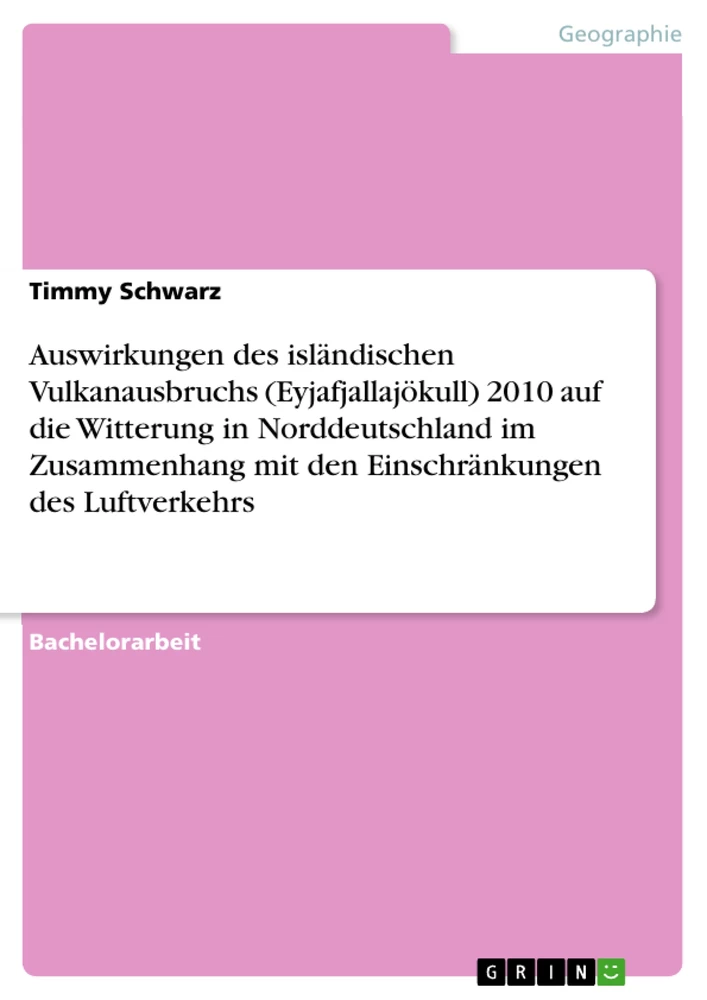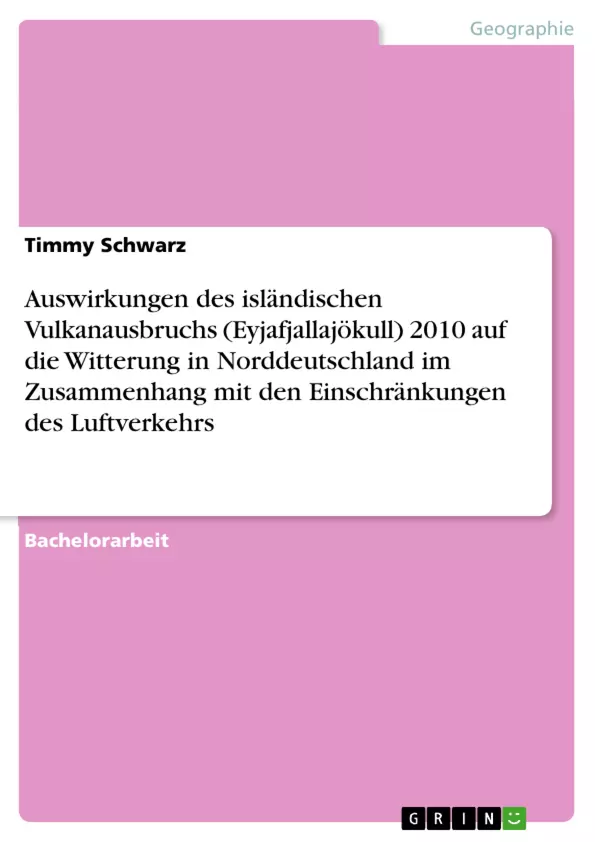Während des Ausbruchs des Eyjafjallajökull im Frühjahr 2010 auf Island gab es Einschränkungen des kommerziellen Flugverkehrs.
Durch das Ausbleiben der sonst üblichen Vielzahl an Flugbewegungen in Europas Himmel verringerte sich die Anzahl der Kondensstreifen und somit künstlichen Cirrus-Wolken.
In der Arbeit wird der klimatische Einfluss in Norddeutschland beleuchtet - während einer Phase der Aussetzung des Flugverkehrs während derer gleichzeitig die Aschewolke nicht über dem Untersuchungsgebiet lag.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Besondere Einflussgrößen auf Klima und Witterung in Europa
- Globale Verdunkelung
- Variation der Sonnenaktivität
- Schwankungen der thermohalinen Zirkulation
- Ausbruch des Eyjafjallajökull auf Island 2010 und seine Auswirkungen
- Temperaturveränderungen in Norddeutschland - Analyse (Material und Methoden)
- Ergebnisse
- Schlussfolgerungen / Diskussion
- Zusammenfassung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen des Vulkanausbruchs des Eyjafjallajökull auf die Witterung in Norddeutschland im Kontext der daraus resultierenden Einschränkungen des Luftverkehrs im Jahr 2010. Die Arbeit analysiert die Temperaturveränderungen in Norddeutschland und untersucht, ob die Flugverbote einen messbaren Effekt auf die Bodentemperaturen hatten.
- Einfluss von Vulkanausbrüchen auf das Klima
- Analyse der Temperaturveränderungen in Norddeutschland
- Auswirkungen der Flugverbote auf die Bodentemperaturen
- Vergleich mit ähnlichen Ereignissen, z.B. den Anschlägen vom 11. September 2001
- Bedeutung des Luftverkehrs für das Klima
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Relevanz des Vulkanausbruchs des Eyjafjallajökull und der damit verbundenen Flugverbote für die Witterung in Norddeutschland dar. Kapitel 2 beleuchtet wichtige Einflussgrößen auf das Klima und die Witterung in Europa, darunter die globale Verdunkelung, die Variation der Sonnenaktivität und Schwankungen der thermohalinen Zirkulation. Kapitel 3 konzentriert sich auf den Ausbruch des Eyjafjallajökull und seine Auswirkungen auf die Temperaturveränderungen in Norddeutschland. Dabei werden die verwendeten Materialien und Methoden beschrieben, die Ergebnisse präsentiert und Schlussfolgerungen gezogen. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Vulkanausbruch, Eyjafjallajökull, Luftverkehr, Flugverbote, Temperaturveränderungen, Norddeutschland, Witterung, Klima, globale Verdunkelung, Sonnenaktivität, thermohaline Zirkulation.
- Quote paper
- Timmy Schwarz (Author), 2010, Auswirkungen des isländischen Vulkanausbruchs (Eyjafjallajökull) 2010 auf die Witterung in Norddeutschland im Zusammenhang mit den Einschränkungen des Luftverkehrs , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158076