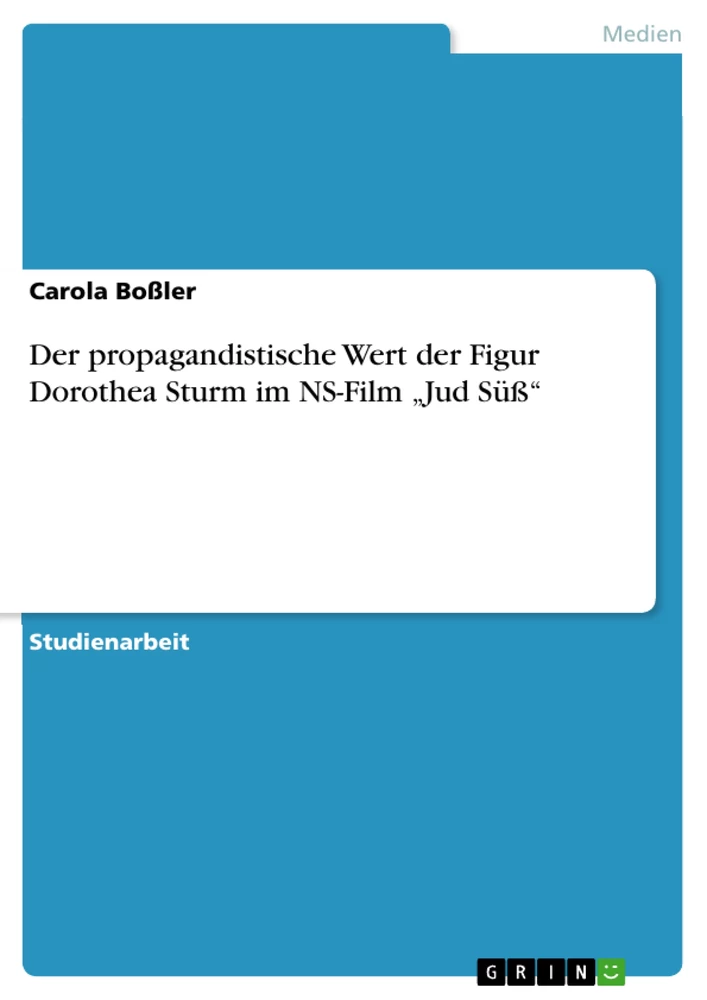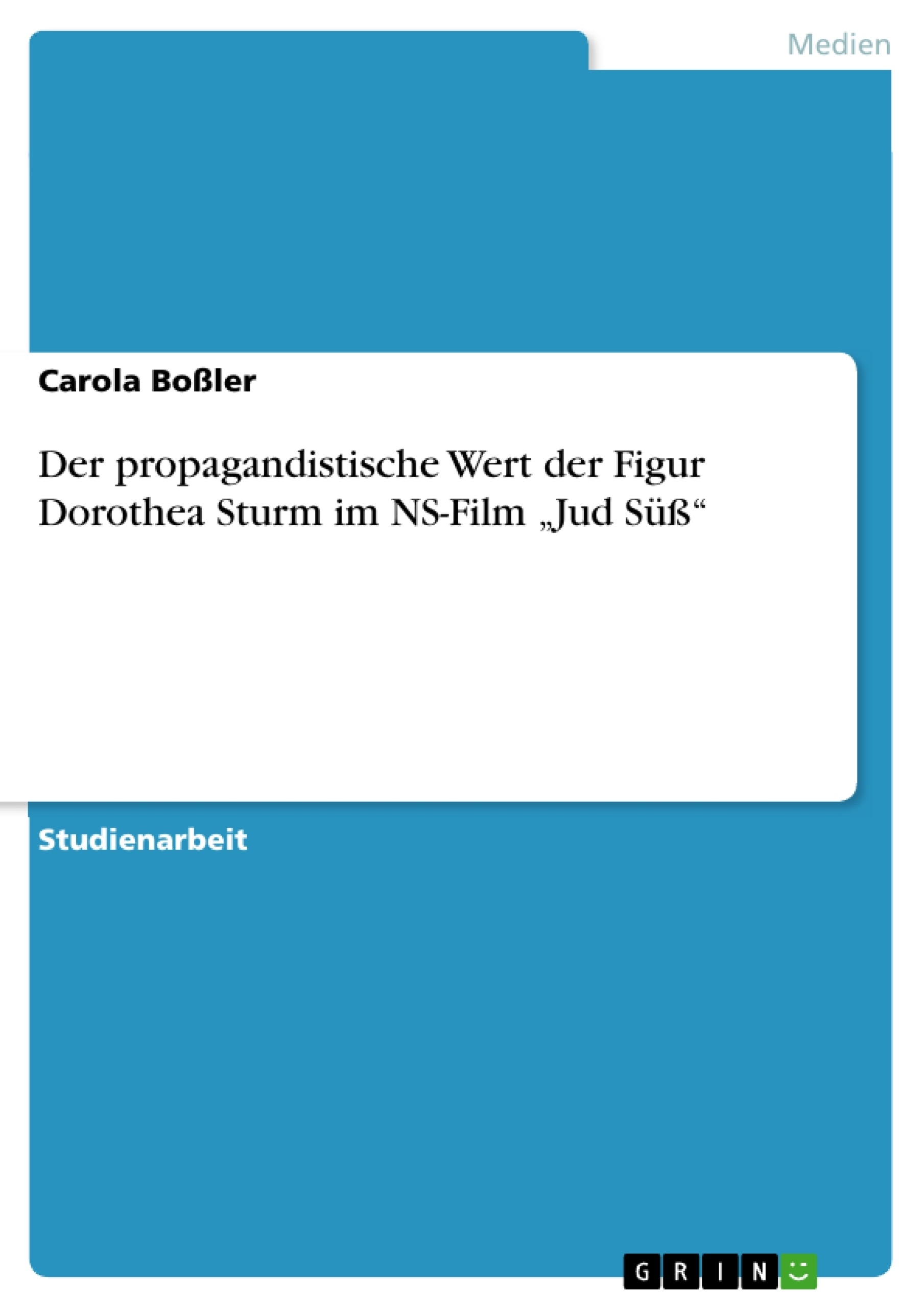Inhaltlich geben die Filmemacher vor, historisch belegt den rasanten gesellschaftlichen Aufstieg des Frankfurter Bankiers Jud Süß Oppenheimer (geboren Ende des 17. Jahrhunderts, gestorben am 4.02.1738) am Hof des Herzogs Karl Alexander von Württemberg zum Finanzminister bis hin zu seinem Tod am Galgen nach zu zeichnen. Die Ausarbeitung und Gestaltung des gesamten Films gibt sich hierbei von den Machern gewollt große Mühe, an Hand der Figurenzeichnungen den Antisemitismus des nationalsozialistischen (im Folgenden: NS-) Regimes nachvollziehbar und sympathisch als einzig vernünftige Reaktion auf die „Gefahren des Weltjudentums“ und der „Rassenschande“ aufzuzeigen.
Sämtliche Frauenfiguren in „Jud Süß“ dienen vornehmlich einer Flankierung und Bestätigung der handelnden männlichen Figuren in ihren Rollenbildfunktionen. Sie alle begünstigen und ermöglichen durch Naivität, Verführbarkeit und ihren fehlenden antisemitischen Instinkt den schnellen und für die Stuttgarter Bevölkerung unerfreulichen Aufstieg des Bankiers Jud Süß Oppenheimer zum Finanzminister am Hofe Karl Alexanders, der sich auf Kosten der „einfachen Leute“ massiv bereichert, den Herzog manipuliert, die Landstände auflösen lässt und sich mal mit Schmeicheleien, mal mit Gewalt die arischen Frauen Württembergs sexuell gefügig macht oder dem Herzog als Zuhälter zuführt. Alle diese Figuren, selbst die Komparsenfiguren, werden von Männern gelenkt und gemaßregelt.
Als weibliche Hauptfigur verkörpert Dorothea Sturm durch ihre Fehler und Schwächen - die die Geschichte zu ihrem dramatischen Höhepunkt (ihrem Selbstmord, der die Revolution voll ausbrechen lässt) führen - das Bild einer Frau, wie die vorbildliche arische Deutsche im Dritten Reich nicht zu sein habe, da ihr sonst der Untergang droht und sie durch ihr Fehlverhalten die Situation verschlimmert und aufrechte Deutsche ins Verderben stürzen kann. Tragisch wird dieses Verhalten umso mehr, da sie alle Tugenden einer vorbildlichen arischen Frau besitzt, nur fehlen ihr der antisemitische Instinkt und die bedingungslose Bereitschaft, sich passiv gegenüber dem ihr zugeordneten Mann zu verhalten.
Um dies zu untermauern, werde ich im Folgenden den Propaganda-Apparat des NS-Regimes, die Funktion des Films als Propagandamittel und die beabsichtigte Erziehung der Masse beschreiben, um dann an Hand einer detaillierten und szenenchronologischen Inhaltsangabe die Figur der Dorothea Sturm zu analysieren und meine These zu bestätigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der antisemitische Spielfilm als Propagandamittel im Dritten Reich
- Was ist NS-Propaganda und wie funktioniert sie im speziellen als Filmpropaganda?
- Propaganda und Volkserziehung
- Detaillierte und szenenchronologische Inhaltsangabe von „Jud Süß“
- Analyse und Interpretation der Figur Dorothea Sturm an Hand der Figurenzeichnung und - entwicklung
- Fazit Der propagandistische Wert der Figur Dorothea Sturm in „Jud Süß“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Analyse der Figur Dorothea Sturm im NS-Film „Jud Süß“ und untersucht deren propagandistischen Wert im Kontext des Antisemitismus des NS-Regimes. Ziel ist es, die Rolle der Figur als Symbol für das „fehlerhafte“ Verhalten einer arischen Frau im Dritten Reich zu beleuchten und die beabsichtigte politische Botschaft des Films zu entschlüsseln.
- Die Funktion des NS-Films als Propagandamittel
- Die Charakterisierung und Funktion der Figur Dorothea Sturm
- Der propagandistische Wert der Figur im Kontext des Antisemitismus
- Die Darstellung des „Weltjudentums“ und die Rolle von Jud Süß Oppenheimer
- Die Bedeutung von Dorothea Sturms Selbstmord als Höhepunkt des Films
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Film „Jud Süß“ im Kontext der NS-Filmpropaganda vor und gibt einen Überblick über die historische und politische Bedeutung des Werks.
Kapitel 2 beleuchtet den antisemitischen Spielfilm als Propagandamittel im Dritten Reich. Es werden die Funktionsweise der NS-Propaganda und deren Nutzung im Filmbereich erläutert.
Kapitel 3 bietet eine detaillierte Inhaltsangabe des Films „Jud Süß“ und analysiert die Figur Dorothea Sturm im Detail. Es wird auf die Figurenzeichnung und -entwicklung sowie die Rolle der Figur im Gesamtkontext des Films eingegangen.
Schlüsselwörter
NS-Propaganda, Filmpropaganda, Antisemitismus, Jud Süß, Dorothea Sturm, Figurenzeichnung, Weltjudentum, Volkserziehung, Frauenrolle, arische Frau, Selbstmord, Propagandawirkung
Häufig gestellte Fragen
Welche propagandistische Funktion hat die Figur Dorothea Sturm im Film "Jud Süß"?
Dorothea Sturm dient als Negativbeispiel für die "arische Frau". Ihr Schicksal soll zeigen, dass Naivität gegenüber dem "Weltjudentum" und mangelnder antisemitischer Instinkt ins Verderben führen.
Wie wird das "Weltjudentum" in "Jud Süß" dargestellt?
Der Film nutzt antisemitische Stereotype, um Juden als manipulativ, geldgierig und als Bedrohung für die "Rassereinheit" und die soziale Ordnung darzustellen.
Was war das Ziel der NS-Filmpropaganda?
Das Ziel war die "Volkserziehung" im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie, die emotionale Beeinflussung der Massen und die Rechtfertigung der antisemitischen Politik.
Welche Rolle spielt der Selbstmord von Dorothea Sturm im Plot?
Ihr Selbstmord nach der Vergewaltigung durch Jud Süß bildet den dramatischen Höhepunkt, der im Film die "gerechte" Empörung und den gewaltsamen Aufstand der Stuttgarter Bevölkerung auslöst.
Wie werden Frauenrollen in diesem Propagandafilm instrumentalisiert?
Frauen werden als Spielball männlicher Interessen und als Opfer dargestellt, deren Fehlverhalten (z.B. Verführbarkeit) die nationale Gemeinschaft gefährdet.
Warum gilt "Jud Süß" als einer der gefährlichsten Propagandafilme des Dritten Reiches?
Wegen seiner hohen handwerklichen Qualität und der geschickten emotionalen Manipulation, die antisemitisches Gedankengut als packende Unterhaltung tarnte.
- Quote paper
- Carola Boßler (Author), 2009, Der propagandistische Wert der Figur Dorothea Sturm im NS-Film „Jud Süß“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158104