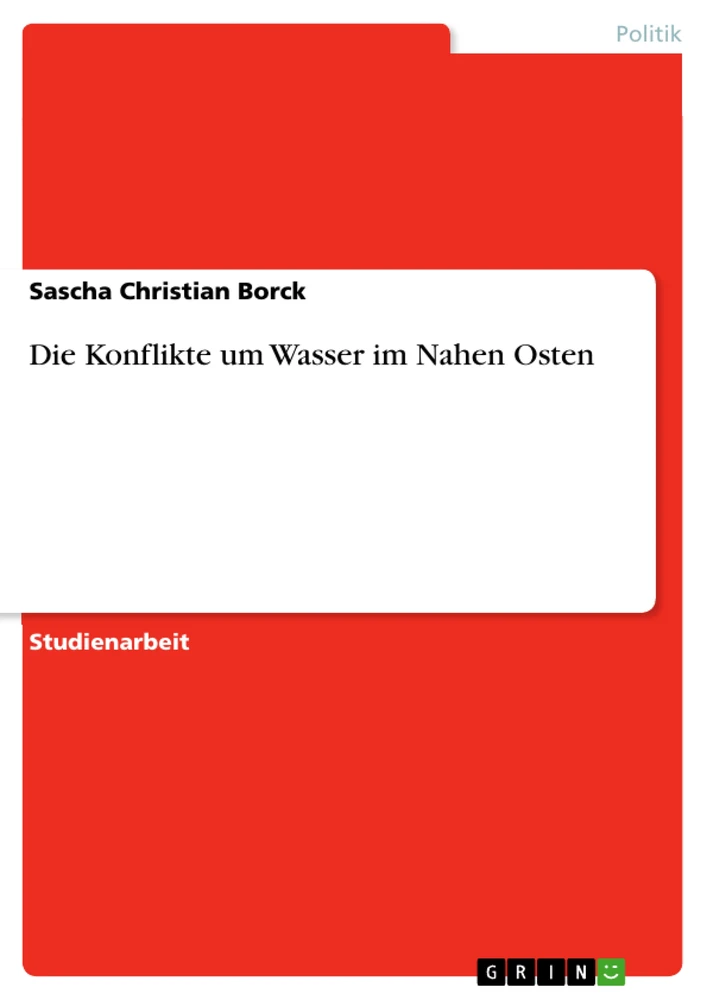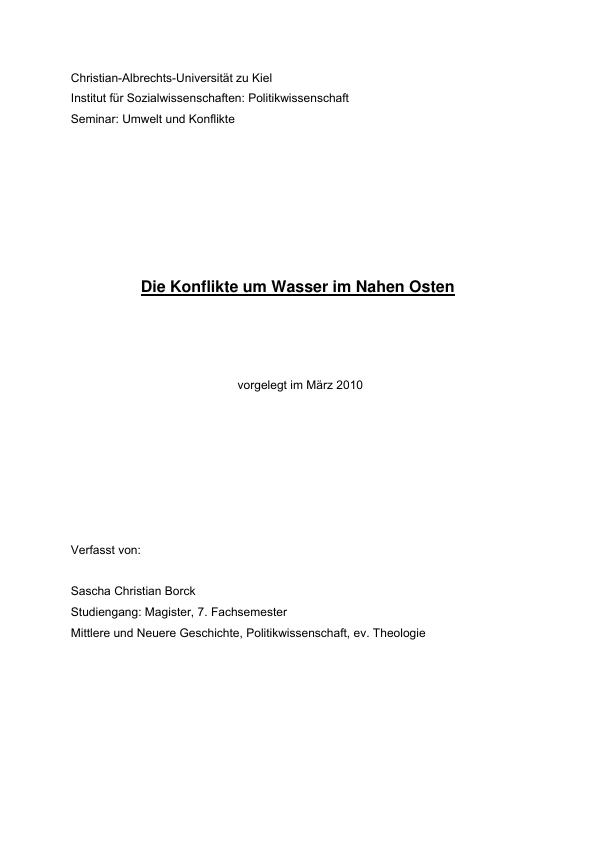„The next war in the Middle East will be over water, not politics.“
Diese viel zitierten Worte sprach der Außenminister Ägyptens und spätere UNO-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali im Mai 1990 aus. Dieses Zitat steht in Zusammenhang mit einer Unzahl ähnlicher, die in den letzten 20 Jahren von Politikern und Forschern im Zusammenhang mit den Problemen der weltweiten Wasserversorgung getätigt wurden.
Seit den 1980er Jahren warnten immer wieder Forscher vor Kriegen um den Besitz von Wasserquellen. Aufgrund der globalen Bevölkerungsexplosion, so die Annahme, würde es in verschiedenen Regionen der Welt zu einem Mangel an Trinkwasser kommen, der schließlich zu bewaffneten Konflikten führen könnte. Vor allem im Nahen Osten rechneten US-amerikanische „Think Tanks“, wie das „Center for Strategic and International Studies“ in Washington, D.C. mit solchen Ressourcenkonflikten:
„The Middle East stands at the pricipice of another major natural resource crisis. Before the twenty-first century, the struggle over limited and threatened water resources could sunder already fragile ties among regional states and lead to unprecedeted upheavel within the area.”
Diese Szenarien wurden und werden nach wie vor begierig von den Medien aufgegriffen, obwohl sie durchaus umstritten sind. Unstrittig ist jedoch, dass es auf der ganzen Welt Konflikte zwischen Staaten um die Nutzung von meistens grenzüberschreitenden Flusssystemen und Wasservorkommen gibt. Dabei wird vor allem das Konfliktpotenzial von Wasser im Nahen Osten am Höchsten eingestuft. Deshalb wird sich auch die vorliegende Arbeit mit der Wasserproblematik dieser Weltregion befassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeines zu Wasser
- Wasserverteilung und Verbrauch
- Wasser im Völkerrecht
- Die globale Wasserpolitik
- Wasserkonflikte im Nahen Osten
- Der Konflikt um Euphrat und Tigris
- Das Wasser im Heiligen Land
- Lösungsansätze
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Wasserproblematik im Nahen Osten und analysiert die Konflikte, die aus der knappen Ressource entstehen. Sie beleuchtet dabei sowohl die weltweite Wasserverteilung und den Verbrauch als auch die völkerrechtlichen Aspekte des internationalen Wassermanagements.
- Die Bedeutung von Wasser als lebensnotwendige Ressource und die globalen Herausforderungen der Wasserverteilung
- Die Rolle des Völkerrechts im Umgang mit grenzüberschreitenden Wasservorkommen
- Die Analyse von Wasserkonflikten im Nahen Osten anhand von Fallbeispielen: Euphrat-Tigris und das „Heilige Land“
- Die Vorstellung von Lösungsansätzen zur Bewältigung der Wasserkonflikte
- Die Bewertung der Gefahr von kriegerischen Auseinandersetzungen um Wasser im Nahen Osten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die These von Boutros Boutros-Ghali auf, dass der nächste Krieg im Nahen Osten um Wasser geführt werden könnte. Sie stellt die wachsende Bedeutung von Wasser als Ressource in den Mittelpunkt und thematisiert die Diskussionen um Konflikte aufgrund von Wasserknappheit.
Der erste Abschnitt beleuchtet die weltweite Verteilung und den Verbrauch von Wasser. Dabei werden die Unterschiede zwischen „grünem“ und „blauem Wasser“ erläutert und die Bedeutung der Agrarwirtschaft als größter Verbraucher „blauen Wassers“ hervorgehoben.
Der zweite Abschnitt widmet sich den Wasserkonflikten im Nahen Osten. Er untersucht den Konflikt um Euphrat und Tigris, der zwischen der Türkei, Syrien und dem Irak besteht, und analysiert die komplexe Wassersituation im „Heiligen Land“.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Wasserknappheit, Wasserkonflikte, internationales Wasserrecht, Naher Osten, Euphrat-Tigris, „Heiliges Land“, Wasserpolitik, Ressourcenkonflikte, grenzüberschreitende Flüsse, UNO, internationale Zusammenarbeit, Lösungsansätze.
Häufig gestellte Fragen zu Wasserkonflikten im Nahen Osten
Wird der nächste Krieg im Nahen Osten um Wasser geführt?
Dies ist eine viel zitierte These (u.a. von Boutros Boutros-Ghali), da Wasserknappheit und Bevölkerungswachstum das Konfliktpotenzial in der Region massiv erhöhen.
Welche Rolle spielt der Konflikt um Euphrat und Tigris?
Es ist ein grenzüberschreitender Konflikt zwischen der Türkei, Syrien und dem Irak über die Nutzung und Stauung dieser lebenswichtigen Flusssysteme.
Was ist das Problem mit der Wasserverteilung im „Heiligen Land“?
Die knappen Ressourcen (z.B. Jordan, Grundwasserleiter) sind zentraler Bestandteil des israelisch-palästinensischen Konflikts und hochgradig politisiert.
Was sagt das Völkerrecht zum internationalen Wassermanagement?
Das Völkerrecht versucht Regeln für die gerechte Aufteilung grenzüberschreitender Wasservorkommen zu finden, stößt aber oft an nationale Souveränitätsansprüche.
Welche Lösungsansätze gibt es für die Wasserkrise?
Dazu zählen internationale Kooperationen, technologische Lösungen wie Entsalzung und effizientere Bewässerungsmethoden in der Landwirtschaft.
- Quote paper
- Sascha Christian Borck (Author), 2009, Die Konflikte um Wasser im Nahen Osten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158175