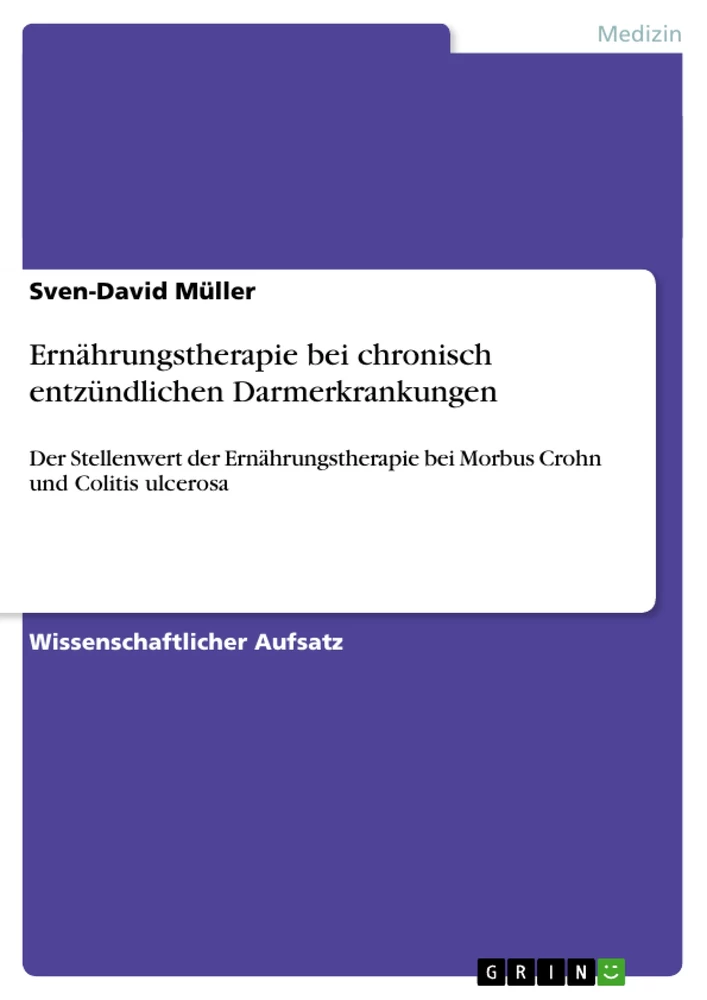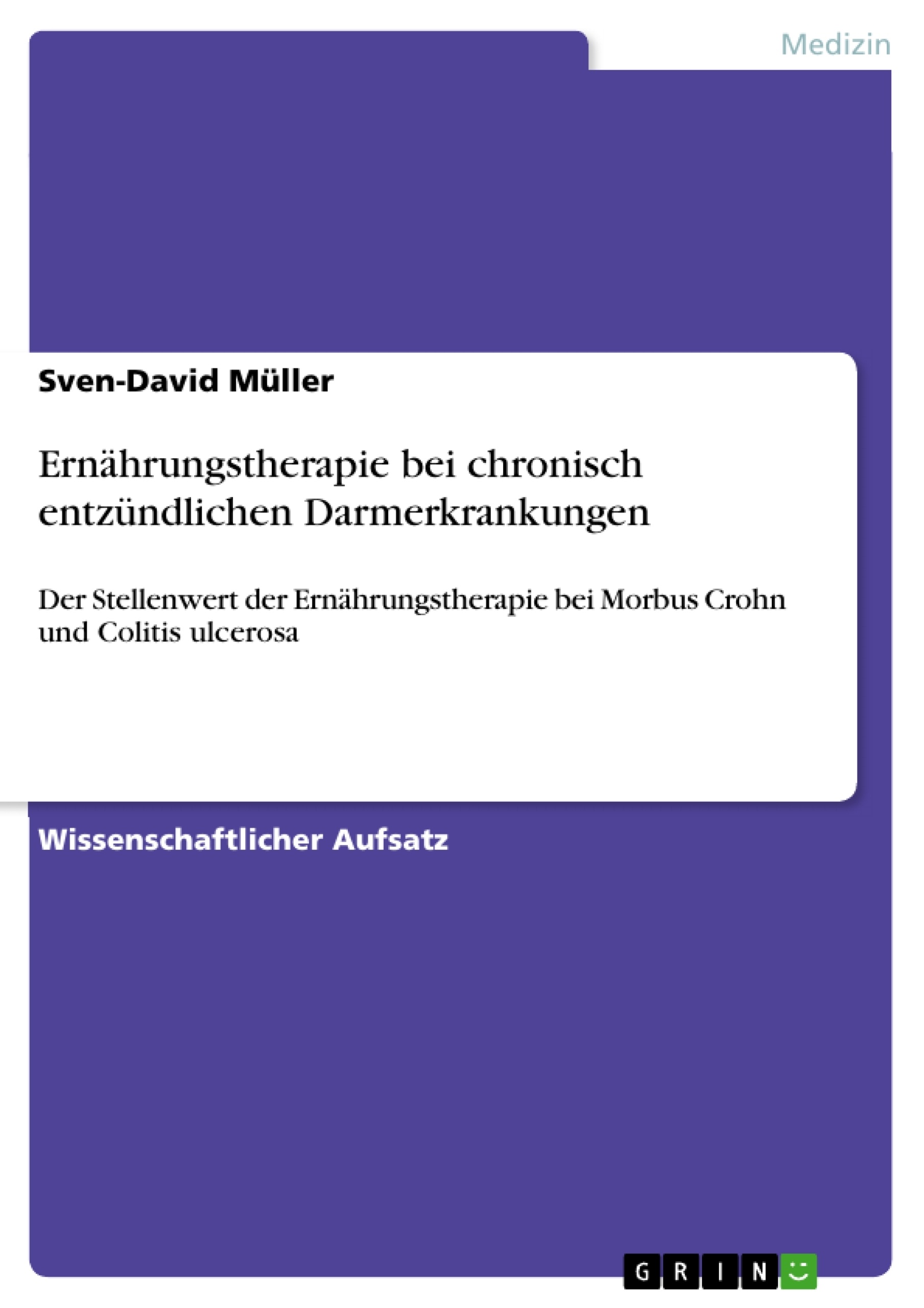Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind die häufigsten chronisch entzündlichen Darmerkrankungen beim Menschen. Bei Menschen, die unter den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen Morbus
Crohn oder Colitis ulcerosa leiden, werden Ernährungseinflüsse für die Entstehung, den Ernährungs- und Allgemeinzustand, die Behandlung und das Auftreten von Nahrungsmittel-, Getränke- und Speisenintoleranzerscheinungen als bedeutsam
angesehen. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen führen häufig zu Ernährungsstörungen (Mangelernährung), deren Ausgleich Verlauf und Aktivität der Erkrankungen günstig beeinflussen können. Der Stellenwert der enteralen Ernährung mit Trink-, Sonden- und Zusatznahrungen wird im Gesamttherapiekonzept bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa bisweilen nicht gebührend beachtet. 80 – 90 Prozent
der Crohn-Betroffenen leiden unter Bauchschmerzen, teils kolikartig, mit Schleim und Blutauflagerung. Die Beziehungen zwischen Ernährung
und Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind vielfältig und für das symptomfreien Intervall und den akuten Entzündungsschub gegeben. Ob die Ernährungsweise ein Cofaktor in der Auslösung der Erkrankungen ist, ist nicht eindeutig geklärt. Insbesondere im Bereich der Probiotika (Dysbiose, Darmflora, Leaky Gut) scheinen vielfältige Zusammenhänge in der Auslösung und Therapie zu bestehen. Unter dem Begriff chronisch entzündliche Darmerkrankungen werden der Morbus Crohn, die Colitis ulcerosa sowie nicht klassifizierbare Formen (Colitis inditerminata) zusammengefasst. Die Ursachen und die Ätiologie der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen im engeren
Sinne (Morbus Crohn und Colitis ulcerosa) sind weiterhin nicht geklärt.
Inhaltsverzeichnis
- Die Rolle der Ernährung bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa
- Gründe der Mangelernährung bei Morbus Crohn
- Diätetische Therapie bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
- Stenosen, Fistelbildung und andere Begleiterscheinungen
- Ernährungseinflüsse
- Der Einfluss der Darmflora auf Colitis ulcerosa und Morbus Crohn mit Lokalisationsort Dickdarm
- Ernährung im akuten Entzündungsschub
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Ernährung auf Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, zwei chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. Sie beleuchtet die Zusammenhänge zwischen Ernährungsmustern, Mangelernährung, und dem Krankheitsverlauf. Die Arbeit analysiert auch die Rolle der Darmflora und die Wirksamkeit verschiedener diätetischer Therapien.
- Der Einfluss der Ernährung auf die Entstehung und den Verlauf von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa.
- Ursachen und Auswirkungen von Mangelernährung bei betroffenen Patienten.
- Die Rolle der Darmflora und deren Modulation durch Ernährung.
- Diätetische Therapieansätze und deren Wirksamkeit.
- Bewertung des Körpergewichts und der Bedeutung des Body-Mass-Index (BMI).
Zusammenfassung der Kapitel
Die Rolle der Ernährung bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa: Dieser Abschnitt stellt die Bedeutung der Ernährung bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa heraus. Er beschreibt die hohen Raten von Bauchschmerzen, Durchfall und Gewichtsverlust bei Crohn-Patienten und die damit verbundenen Ernährungsprobleme. Der erwiesene Nutzen der enteralen Ernährungstherapie wird betont, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Der Text diskutiert die komplexen Beziehungen zwischen Ernährung und dem Krankheitsverlauf, ohne jedoch einen eindeutigen kausalen Zusammenhang zwischen spezifischen Ernährungsfaktoren und der Entstehung der Erkrankungen zu belegen. Das Nord-Süd-Gefälle in der Inzidenz der Erkrankungen wird im Kontext unterschiedlicher Ernährungsweisen diskutiert, wobei ein Zusammenhang zwischen verringerter Ballaststoffzufuhr und erhöhtem Zucker- und Fettkonsum und der Krankheitsentstehung vermutet, aber nicht eindeutig bewiesen wird.
Gründe der Mangelernährung bei Morbus Crohn: Dieses Kapitel listet ausführlich die vielfältigen Ursachen für Mangelernährung bei Morbus Crohn auf. Es umfasst sowohl reduzierte Nahrungsaufnahme aufgrund von Schmerzen, Appetitlosigkeit und Angst vor ungeeigneten Nahrungsmitteln, als auch Resorptionsstörungen, erhöhte Verluste durch Blutungen und Durchfall, sowie erhöhten Bedarf durch Entzündungen und Fieber. Der erhöhte Energiebedarf und die mögliche Fettverwertungsstörung mit der daraus resultierenden Steatorrhoe werden detailliert erklärt, ebenso wie die Behandlungsoptionen mit MCT-Fetten. Die Bedeutung einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr wird ebenfalls hervorgehoben.
Diätetische Therapie bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen: Hier werden die häufigsten chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED), Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, vorgestellt. Der nicht heilbare Charakter der Erkrankungen und die multifaktoriellen Ursachen (genetische Prädisposition, Ernährungsfaktoren, Umwelteinflüsse, Allergien, Mikroorganismen, Noxen, psychische Faktoren) werden beschrieben. Die "Western Diet" mit ihrem hohen Zucker- und Fastfoodkonsum und dem Mangel an Ballaststoffen wird als möglicher krankheitsmitauslösender Faktor genannt. Der Text erwähnt den Ausschlussdiäten und die kohlenhydratarme Lutz-Diät als mögliche Therapieansätze, betont aber, dass die wissenschaftliche Evidenz für pauschale Empfehlungen noch unzureichend ist.
Stenosen, Fistelbildung und andere Begleiterscheinungen: Dieses Kapitel beschreibt typische Begleiterscheinungen des Morbus Crohn, wie Fistelbildungen und Stenosen. Es erläutert, wie Entzündungen zu diesen Komplikationen führen können und welche weiteren gastrointestinalen Probleme wie Laktoseintoleranz, Gallensäureverlustsyndrom und Steatorrhoe auftreten können. Der Zusammenhang zwischen den beschriebenen Komplikationen und der Ernährung wird angedeutet, ohne jedoch detaillierte Zusammenhänge zu spezifizieren.
Ernährungseinflüsse: Dieser Abschnitt vertieft die Diskussion über den Einfluss der Ernährung auf die Entstehung von CED. Die "Western Diet" wird als potenzieller Kofaktor hervorgehoben, insbesondere im Zusammenhang mit Morbus Crohn. Die Rolle des Stillens bei der Colitis ulcerosa wird angesprochen. Der Text erwähnt Ausschlussdiäten und deren Erfolg bei einigen Patienten, sowie die mögliche Rolle von Mikroorganismen und die erfolgreiche Therapie mit Probiotika. Die Diskussion über die wissenschaftliche Evidenz für einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Ernährung und Krankheitsentstehung bleibt bestehen.
Der Einfluss der Darmflora auf Colitis ulcerosa und Morbus Crohn mit Lokalisationsort Dickdarm: Dieser Abschnitt behandelt die Bedeutung der Darmflora für die Entstehung von CED. Er beschreibt die immense Anzahl von Mikroorganismen im Darm und deren wichtige Funktion für die Gesundheit. Der Text erläutert, wie ein gestörtes Gleichgewicht der Darmflora, eine verminderte Toleranz des Immunsystems und überschießende Immunreaktionen zur Entstehung der Erkrankungen beitragen können. Die Rolle spezifischer Mikroorganismen und der Erfolg von Therapien mit Probiotika, insbesondere mit dem E. coli Stamm Nissle 1917, werden detailliert beschrieben.
Schlüsselwörter
Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED), Ernährung, Mangelernährung, Darmflora, Probiotika, E. coli Stamm Nissle 1917, Diätetische Therapie, MCT-Fette, Western Diet, Ballaststoffe, Zucker, Fett, Immunsystem, Remission, Rezidivrate.
Häufig gestellte Fragen zu: Einfluss der Ernährung auf Morbus Crohn und Colitis ulcerosa
Welche Themen werden in diesem Text behandelt?
Der Text behandelt umfassend den Einfluss der Ernährung auf Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Dies beinhaltet die Rolle der Ernährung bei der Entstehung und dem Verlauf der Erkrankungen, die Ursachen und Folgen von Mangelernährung, die Bedeutung der Darmflora und deren Modulation durch Ernährung, verschiedene diätetische Therapieansätze und deren Wirksamkeit, sowie die Bewertung des Körpergewichts und des BMI. Zusätzlich werden Begleiterscheinungen wie Stenosen und Fistelbildungen sowie die "Western Diet" und deren möglicher Einfluss diskutiert.
Welche Rolle spielt die Ernährung bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa?
Der Text betont die hohe Bedeutung der Ernährung bei beiden Erkrankungen. Bauchschmerzen, Durchfall und Gewichtsverlust bei Morbus Crohn-Patienten werden als häufige Ernährungsprobleme genannt. Die enterale Ernährung, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, wird als wirksam beschrieben. Ein eindeutiger kausaler Zusammenhang zwischen spezifischen Nahrungsmitteln und der Krankheitsentstehung wird jedoch nicht belegt, sondern ein komplexer Zusammenhang zwischen Ernährungsmustern und Krankheitsverlauf vermutet. Der mögliche Einfluss der "Western Diet" mit ihrem niedrigen Ballaststoffgehalt und hohen Zucker- und Fettanteil wird diskutiert.
Warum leiden Morbus Crohn-Patienten oft unter Mangelernährung?
Mangelernährung bei Morbus Crohn resultiert aus verschiedenen Faktoren: reduzierte Nahrungsaufnahme durch Schmerzen, Appetitlosigkeit und Angst vor ungeeigneten Lebensmitteln; Resorptionsstörungen; erhöhte Verluste durch Blutungen und Durchfall; und erhöhter Energiebedarf durch Entzündungen und Fieber. Eine mögliche Fettverwertungsstörung mit Steatorrhoe und die Bedeutung ausreichender Flüssigkeitszufuhr werden ebenfalls hervorgehoben. Die Behandlung mit MCT-Fetten wird als Option erwähnt.
Welche diätetischen Therapien werden bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen eingesetzt?
Der Text nennt den Ausschlussdiäten und die kohlenhydratarme Lutz-Diät als mögliche Therapieansätze. Es wird jedoch betont, dass die wissenschaftliche Evidenz für pauschale Ernährungsempfehlungen noch unzureichend ist. Der nicht heilbare Charakter der Erkrankungen und die multifaktoriellen Ursachen (Genetik, Umweltfaktoren, Allergien, Mikroorganismen etc.) werden hervorgehoben. Die "Western Diet" wird als möglicher krankheitsmitauslösender Faktor genannt.
Welche Begleiterscheinungen von Morbus Crohn werden im Text beschrieben?
Der Text beschreibt Fistelbildungen und Stenosen als typische Komplikationen von Morbus Crohn. Weitere gastrointestinale Probleme wie Laktoseintoleranz, Gallensäureverlustsyndrom und Steatorrhoe werden erwähnt. Der Zusammenhang zwischen diesen Komplikationen und der Ernährung wird angedeutet, jedoch ohne detaillierte Spezifikation.
Welche Rolle spielt die Darmflora bei Colitis ulcerosa und Morbus Crohn?
Der Text betont die Bedeutung eines ausgewogenen Darmmikrobioms für die Gesundheit. Ein gestörtes Gleichgewicht der Darmflora, verminderte Immunsystemtoleranz und überschießende Immunreaktionen werden als Faktoren bei der Entstehung von CED genannt. Die Rolle spezifischer Mikroorganismen und der Erfolg von Therapien mit Probiotika, insbesondere E. coli Stamm Nissle 1917, werden detailliert beschrieben. Der Fokus liegt auf der Lokalisation im Dickdarm.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Textes?
Schlüsselwörter sind: Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED), Ernährung, Mangelernährung, Darmflora, Probiotika, E. coli Stamm Nissle 1917, Diätetische Therapie, MCT-Fette, Western Diet, Ballaststoffe, Zucker, Fett, Immunsystem, Remission, Rezidivrate.
- Arbeit zitieren
- M.Sc. Sven-David Müller (Autor:in), 2010, Ernährungstherapie bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158219