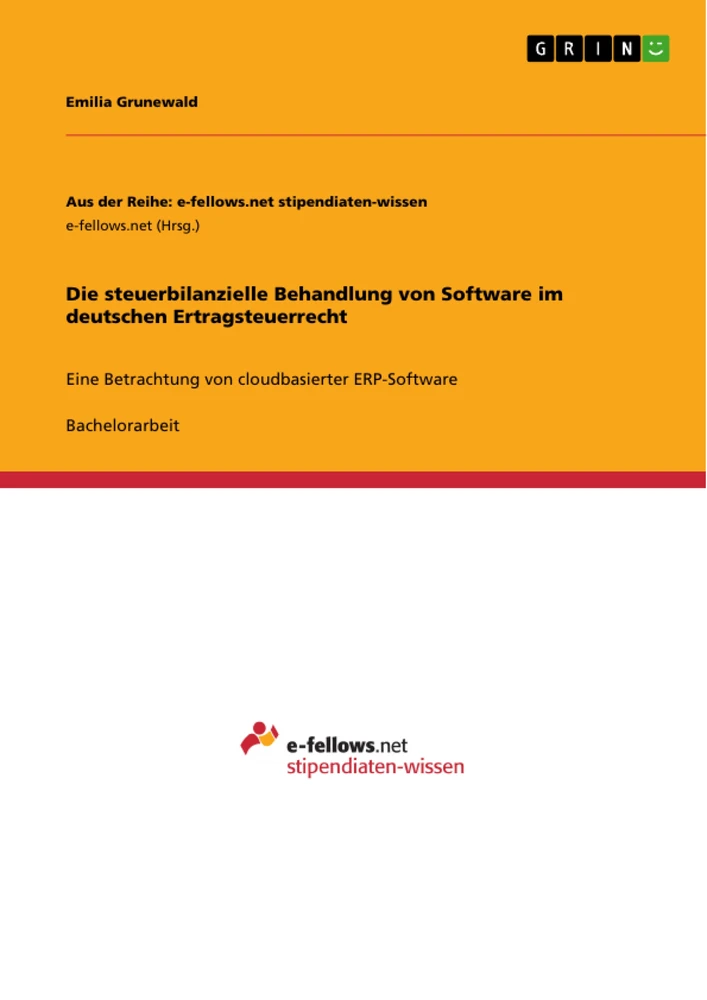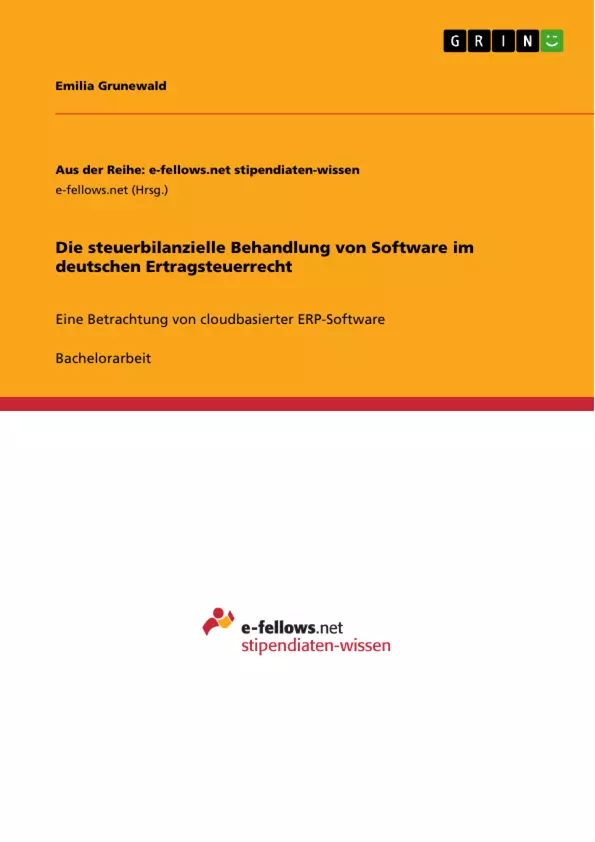Diese Arbeit untersucht die steuerbilanzielle Behandlung von cloudbasierten ERP-Systemen im SaaS-Modell.
Das Ziel besteht darin, die Möglichkeiten der steuerbilanziellen Abbildung von "Enterprise Resource Planning as a Service" auf Grundlage der steuerrechtlichen Vorschriften, der Rechtsprechung sowie unter Berücksichtigung der in der Fachliteratur vertretenen Ansichten zu untersuchen, um die SaaS-Lösung korrekt und optimal darzustellen.
Zunächst werden die begrifflichen und technischen Grundlagen erarbeitet. Anschließend wird die steuerbilanzielle Behandlung der Nutzungsvereinbarung und der Implementierung betrachtet. Im Fokus steht jeweils, ob die Kosten als Betriebsausgaben sofort abzuziehen sind oder ob eine Aktivierung als Wirtschaftsgut infrage kommt. Abschließend werden die Erkenntnisse thesenartig zusammengefasst.
Die fortschreitende Digitalisierung hat alle Bereiche der Wirtschaft grundlegend verändert. Auch bei Anwendungssoftware vollzieht sich ein Wandel: Klassische On-Premise-Software wird zunehmend durch cloudbasierte ,,Software as a Service“ -Lösungen ersetzt. Unternehmen müssen Soft- und Hardware nicht mehr erwerben und selbst betreiben, sondern nutzen die Software bedarfsabhängig über das Internet. Insbes. cloudbasierte Enterprise-Resource-Planning-Systeme (ERP) spielen eine Schlüsselrolle in der Steuerung von Geschäftsprozessen. Deren steuerbilanzielle Abbildung beim Anwenderunternehmen stellt jedoch eine Herausforderung dar.
Ein Beispiel veranschaulicht die Problematik: Ein mittelständisches Produktionsunternehmen entscheidet sich seine ressourcenintensive IT-Infrastruktur durch die Einführung eines cloudbasierten ERP-System im SaaS-Modell zu modernisieren. Dieses System soll eine zentrale Verwaltung und Steuerung sämtlicher Unternehmensprozesse – von der Finanzbuchhaltung bis zur Lagerverwaltung – ermöglichen, ohne dass das Unternehmen eigene Ressourcen für den Betrieb des Systems aufwenden muss. Neben den monatlichen Lizenzgebühren fallen hohe Kosten für die Implementierung an, um das System an die spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen. Fraglich ist nun, wie diese Aufwendungen steuerbilanziell erfasst werden sollen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Begriffliche und technische Grundlagen
- I. Definition des Cloud-Computing
- II. SaaS im Kontext von cloudbasierten ERP-Systemen
- 1. Bedeutung des „Customizings“ bei ERP-Systemen
- 2. Überblick über die Softwarelizenzmodelle
- C. Steuerbilanzielle Behandlung von Softwarelizenzen im Rahmen von ERPaaS
- I. Aktivierungsfähigkeit der Softwarelizenz
- II. Subjektive Zurechnung der Softwarelizenz
- D. Steuerbilanzielle Behandlung der Implementierung von ERP-Systemen
- I. Implementierungskosten als Inbetriebnahmekosten der Softwarelizenz
- II. Implementierung als selbstständiges immaterielles Wirtschaftsgut
- E. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die steuerbilanzielle Behandlung von cloudbasierter ERP-Software im deutschen Ertragsteuerrecht. Ziel ist es, die Aktivierungsfähigkeit der Softwarelizenz und der Implementierungskosten zu klären und die subjektive Zurechnung der Softwarelizenz im Kontext verschiedener Lizenzmodelle zu analysieren.
- Aktivierungsfähigkeit von cloudbasierter ERP-Software
- Subjektive Zurechnung der Softwarelizenz bei verschiedenen Lizenzmodellen (Kauf, Miete)
- Steuerbilanzielle Behandlung der Implementierungskosten
- Unterschiede zwischen Kauf- und Mietlizenzmodellen
- Anwendbarkeit von Leasingregelungen auf Softwarelizenzen
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der steuerbilanziellen Behandlung von cloudbasierter ERP-Software ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Es wird die Relevanz des Themas im Kontext der zunehmenden Verbreitung von Cloud-Computing-Lösungen im Unternehmensbereich hervorgehoben und die Forschungsfrage präzisiert.
B. Begriffliche und technische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die notwendigen Begrifflichkeiten und technischen Grundlagen für das Verständnis der Arbeit fest. Es definiert Cloud-Computing und erläutert SaaS (Software as a Service) im Kontext cloudbasierter ERP-Systeme. Die Bedeutung von Customizing bei ERP-Systemen und verschiedene Softwarelizenzmodelle werden detailliert beschrieben, um ein umfassendes Verständnis der technischen Rahmenbedingungen zu schaffen, die die steuerbilanzielle Behandlung beeinflussen.
C. Steuerbilanzielle Behandlung von Softwarelizenzen im Rahmen von ERPaaS: Dieses Kapitel analysiert die steuerbilanzielle Behandlung von Softwarelizenzen im Rahmen von ERPaaS (Enterprise Resource Planning as a Service). Es befasst sich sowohl mit der Aktivierungsfähigkeit der Softwarelizenz – unter Berücksichtigung von Kauf- und Mietlizenzmodellen sowie Aspekten des Software-Leasings – als auch mit der subjektiven Zurechnung der Lizenz. Die Kapitelteile untersuchen die verschiedenen Kriterien und Rechtsprechungen, die für die Beurteilung der Aktivierbarkeit und Zurechnung relevant sind, und bieten eine differenzierte Betrachtung der rechtlichen Situation.
D. Steuerbilanzielle Behandlung der Implementierung von ERP-Systemen: Dieses Kapitel widmet sich der steuerbilanziellen Behandlung der Implementierungskosten von ERP-Systemen. Es untersucht die Behandlung dieser Kosten als Inbetriebnahmekosten der Softwarelizenz und die Alternative, die Implementierung als eigenständiges immaterielles Wirtschaftsgut zu aktivieren. Die Analyse betrachtet verschiedene juristische Ansätze und deren Vor- und Nachteile, einschließlich einer Diskussion der Analogie zu Mieterbauten. Die Ausführungen berücksichtigen sowohl die Fälle der Eigenherstellung als auch die Einschaltung Dritter.
Schlüsselwörter
Cloudbasierte ERP-Software, Steuerbilanzierung, Softwarelizenzen, Implementierungskosten, Aktivierungsfähigkeit, Subjektive Zurechnung, Kauflizenzmodell, Mietlizenzmodell, Softwareleasing, ERPaaS, Immaterielles Wirtschaftsgut, Deutsches Ertragsteuerrecht.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Analyse von cloudbasierter ERP-Software?
Diese Analyse befasst sich mit der steuerbilanziellen Behandlung von cloudbasierter ERP-Software im deutschen Ertragsteuerrecht. Sie untersucht die Aktivierungsfähigkeit von Softwarelizenzen und Implementierungskosten sowie die subjektive Zurechnung von Softwarelizenzen in verschiedenen Lizenzmodellen.
Was sind die Themenschwerpunkte dieser Bachelorarbeit?
Die Themenschwerpunkte sind:
- Aktivierungsfähigkeit von cloudbasierter ERP-Software
- Subjektive Zurechnung der Softwarelizenz bei verschiedenen Lizenzmodellen (Kauf, Miete)
- Steuerbilanzielle Behandlung der Implementierungskosten
- Unterschiede zwischen Kauf- und Mietlizenzmodellen
- Anwendbarkeit von Leasingregelungen auf Softwarelizenzen
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik der steuerbilanziellen Behandlung von cloudbasierter ERP-Software ein, skizziert den Aufbau der Arbeit und präzisiert die Forschungsfrage. Sie betont die Relevanz des Themas angesichts der zunehmenden Verbreitung von Cloud-Computing-Lösungen.
Welche Begrifflichkeiten werden in den Grundlagen erläutert?
Die Grundlagen definieren Cloud-Computing und erläutern SaaS (Software as a Service) im Kontext cloudbasierter ERP-Systeme. Die Bedeutung von Customizing bei ERP-Systemen und verschiedene Softwarelizenzmodelle werden detailliert beschrieben.
Wie wird die steuerbilanzielle Behandlung von Softwarelizenzen im Rahmen von ERPaaS analysiert?
Die steuerbilanzielle Behandlung von Softwarelizenzen im Rahmen von ERPaaS wird hinsichtlich der Aktivierungsfähigkeit (Kauf, Miete, Softwareleasing) und der subjektiven Zurechnung der Lizenz analysiert. Kriterien und Rechtsprechungen für die Beurteilung der Aktivierbarkeit und Zurechnung werden untersucht.
Was umfasst die steuerbilanzielle Behandlung der Implementierung von ERP-Systemen?
Die steuerbilanzielle Behandlung der Implementierungskosten von ERP-Systemen untersucht die Behandlung dieser Kosten als Inbetriebnahmekosten der Softwarelizenz sowie die Aktivierung der Implementierung als eigenständiges immaterielles Wirtschaftsgut. Verschiedene juristische Ansätze und deren Vor- und Nachteile werden betrachtet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für dieses Thema?
Relevante Schlüsselwörter sind: Cloudbasierte ERP-Software, Steuerbilanzierung, Softwarelizenzen, Implementierungskosten, Aktivierungsfähigkeit, Subjektive Zurechnung, Kauflizenzmodell, Mietlizenzmodell, Softwareleasing, ERPaaS, Immaterielles Wirtschaftsgut, Deutsches Ertragsteuerrecht.
- Quote paper
- Emilia Grunewald (Author), 2024, Die steuerbilanzielle Behandlung von Software im deutschen Ertragsteuerrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1582346