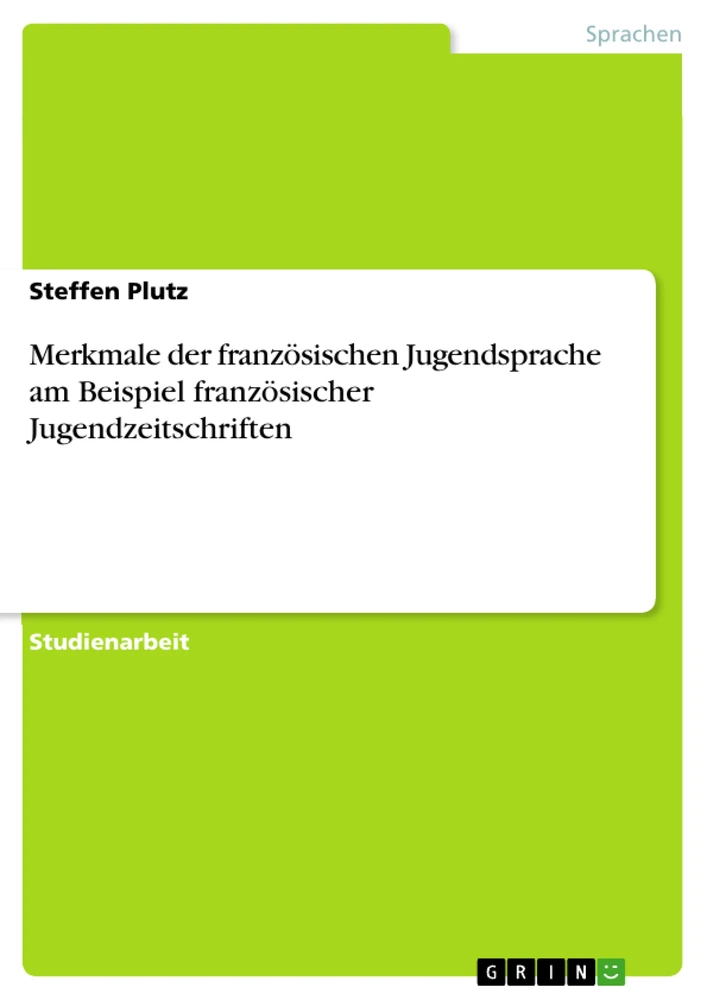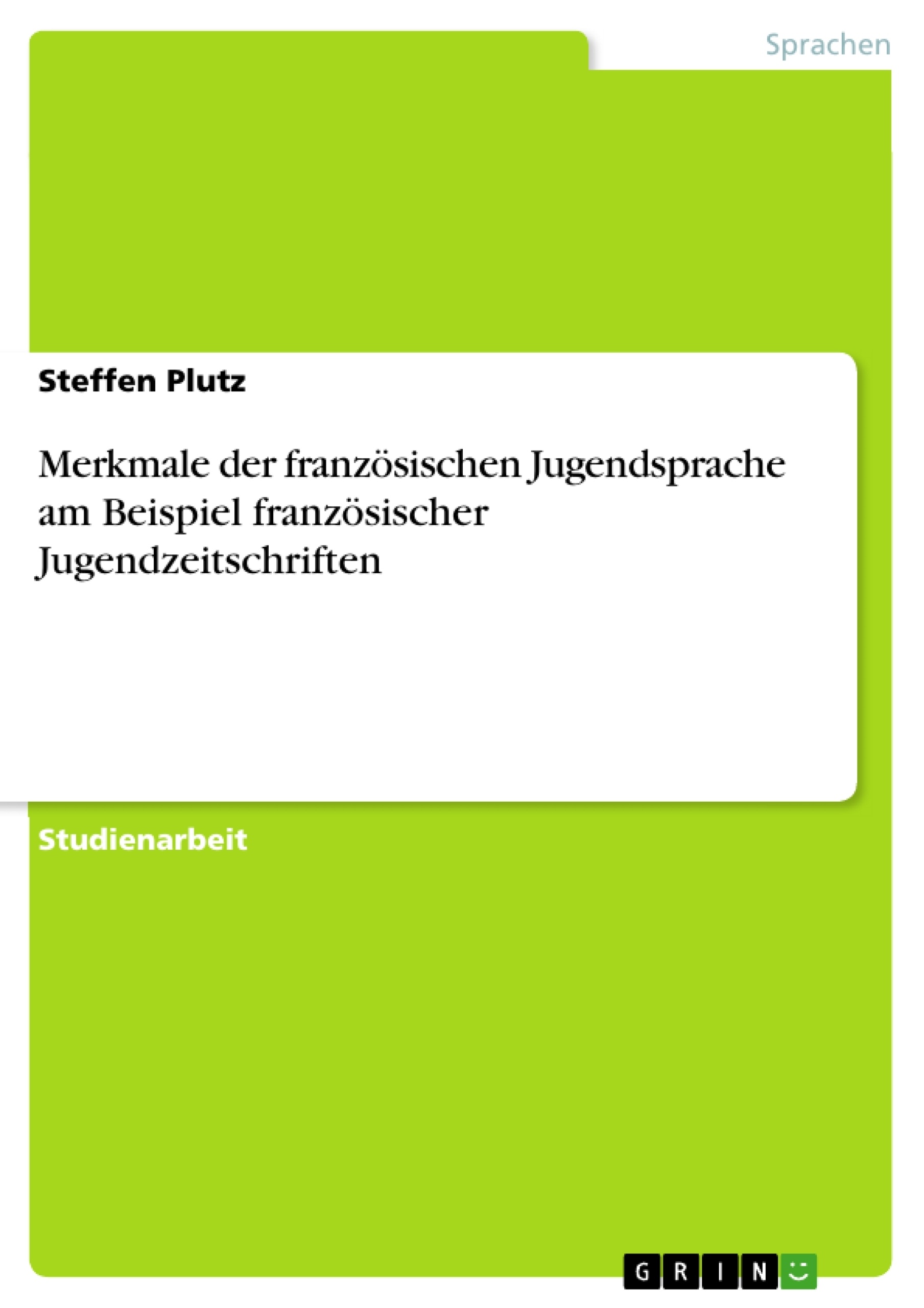In der heutigen Gesellschaft wird der Jugend immer mehr Aufmerksamkeit durch die Medien und die Öffentlichkeit entgegengebracht (vgl. Chun 2007, 1). Auch das wissenschaftliche Interesse an Jugend und Jugendsprache ist immer größer geworden
Die Jugendsprachforschung stellt somit ein interessantes und besonders umfassendes Thema dar. In dieser Seminararbeit befasse ich mich mit den Merkmalen von französischer Jugendsprache und deren Auftreten in französischen Jugendzeitschriften. Obwohl es sich bei Jugendsprachlichen Merkmalen primär um orale Äußerungen handelt, die nur begrenzt in schriftlicher Form verwendet werden, lassen sich dennoch einige Besonderheiten der französischen Jugendsprache in Jugendzeitschriften feststellen. Zunächst sollen die Begriffe Jugend und Jugendsprache genauer definiert werden, wobei die im folgenden genannten Begriffsdefinitionen nur mögliche Definitionen darstellen und dementsprechend nicht allgemein gültig sind, da es sich bei den Begriffen vielmehr um eine Ansammlung von bestimmten Merkmalen bzw. Funktionen (wie Alter, Dresscode, gebrauchspezifische Sprachelemente) handelt (vgl. Kundegraber 2008, 51f). Im weiteren Verlauf der Arbeit soll kurz eine (mögliche) und im weiteren Verlauf von mir verwendete Definition von französischer Jugendsprache gegeben, sowie auf die nicht-sprachlichen Merkmale der französischen Jugendsprache eingegangen, werden. Im Anschluss daran werde ich mich mit der konkreten Analyse der sprachlichen Merkmale französischer Jugendsprache in Jugendzeitschriften beschäftigen. Ziel dieser Arbeit soll es sein, einen „aktuellen“ Überblick über die in den von mir untersuchten Jugendzeitschriften besonders häufig vorkommenden Merkmale jugendlicher Sprache in Frankreich zu geben, indem deren typische Verwendung in den von mir untersuchten Zeitschriften aufgezeigt werden soll. Das Aufzeigen aller vorkommenden Merkmale, sowie die Unterscheidung zwischen geschlechterspezifischen und altersspezifischen Merkmalen, würde den Rahmen dieser Arbeit nicht gerecht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Jugend?
- Was ist Jugendsprache?
- Französische Jugendsprache
- Nicht-sprachliche Merkmale französischer Jugendsprache
- Sprachbewusstseinsmerkmal
- Merkmale der sozialen Funktion
- Merkmale der sozialen Reichweite
- Merkmale der historischen Reichweite
- Sprachliche Merkmale französischer Jugendsprache
- Sprachliche Merkmale französischer Jugendsprache aufgezeigt an französischen Jugendzeitschriften
- Vorstellung der französischen Zeitschriften
- Muteen
- Phospore
- Girls!
- Muteen
- Verwendung von Superlativen
- Ableitungen
- Präfigierung
- Suffigierung
- Entlehnungen aus anderen Sprachen/Dialekten
- Anglizismen
- Verlan
- Metaphern
- Wortkürzungen
- Schlussbemerkung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Merkmale französischer Jugendsprache und deren Auftreten in französischen Jugendzeitschriften zu untersuchen. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse sprachlicher Merkmale und deren typischen Verwendung in den ausgewählten Zeitschriften.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Jugend und Jugendsprache
- Nicht-sprachliche Merkmale französischer Jugendsprache
- Sprachliche Merkmale französischer Jugendsprache, insbesondere in Jugendzeitschriften
- Analyse der sprachlichen Besonderheiten anhand ausgewählter französischer Jugendzeitschriften
- Einordnung der Ergebnisse in den Kontext der Jugendsprachforschung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Jugendsprache ein und stellt die Relevanz der Forschung dar. Sie erläutert die Problematik der Definition von Jugend und Jugendsprache und skizziert die Ziele und den Aufbau der Arbeit.
- Französische Jugendsprache: In diesem Kapitel werden die nicht-sprachlichen Merkmale französischer Jugendsprache beleuchtet. Es werden Aspekte wie Sprachbewusstsein, soziale Funktion, soziale Reichweite und historische Reichweite thematisiert.
- Sprachliche Merkmale französischer Jugendsprache aufgezeigt an französischen Jugendzeitschriften: Dieses Kapitel befasst sich mit der Analyse sprachlicher Merkmale französischer Jugendsprache anhand von ausgewählten Jugendzeitschriften. Es werden verschiedene Merkmale, wie die Verwendung von Superlativen, Ableitungen, Entlehnungen, Metaphern und Wortkürzungen, untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Merkmalen französischer Jugendsprache, insbesondere anhand ihrer Verwendung in Jugendzeitschriften. Wichtige Schlüsselwörter sind: Jugendsprache, französische Jugendsprache, Jugendzeitschriften, Sprachbewusstsein, soziale Funktion, soziale Reichweite, historische Reichweite, Superlative, Ableitungen, Entlehnungen, Anglizismen, Verlan, Metaphern, Wortkürzungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist "Verlan" in der französischen Jugendsprache?
Verlan ist ein weit verbreitetes Phänomen, bei dem Silben von Wörtern vertauscht werden (z.B. "l'envers" wird zu "verlan"). Es dient der Abgrenzung und Identitätsbildung Jugendlicher.
Welche Rolle spielen Jugendzeitschriften für die Jugendsprache?
Zeitschriften wie "Muteen" oder "Girls!" greifen orale Merkmale der Jugendsprache auf, um eine Nähe zur Zielgruppe herzustellen, obwohl Jugendsprache primär mündlich existiert.
Welche sprachlichen Merkmale sind typisch für französische Jugendliche?
Typisch sind die häufige Verwendung von Superlativen, spezifische Ableitungen (Präfixe/Suffixe), Wortkürzungen sowie Entlehnungen aus dem Englischen oder arabischen Dialekten.
Dient Jugendsprache nur der Kommunikation?
Nein, sie hat wichtige soziale Funktionen: Sie schafft Gruppenzugehörigkeit, dient der Abgrenzung von der Erwachsenenwelt und ist Ausdruck eines spezifischen Sprachbewusstseins.
Gibt es Unterschiede zwischen geschlechterspezifischer Jugendsprache?
Obwohl die Arbeit den Fokus auf allgemeine Merkmale legt, wird angemerkt, dass es durchaus Unterschiede gibt, die jedoch den Rahmen einer kompakten Analyse oft überschreiten würden.
- Quote paper
- Steffen Plutz (Author), 2010, Merkmale der französischen Jugendsprache am Beispiel französischer Jugendzeitschriften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158271