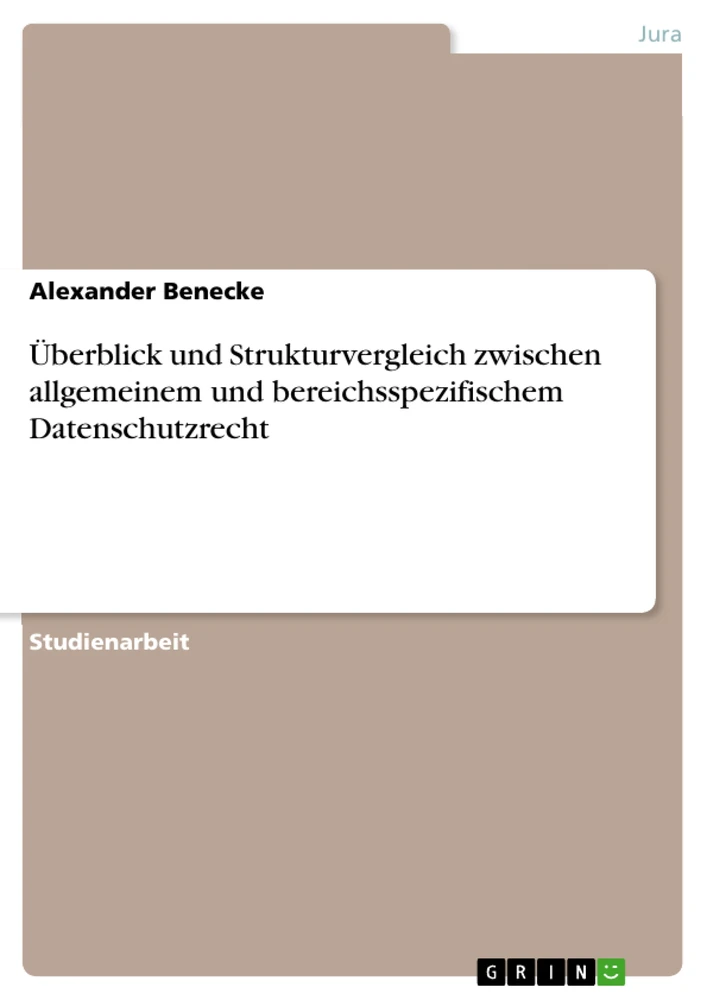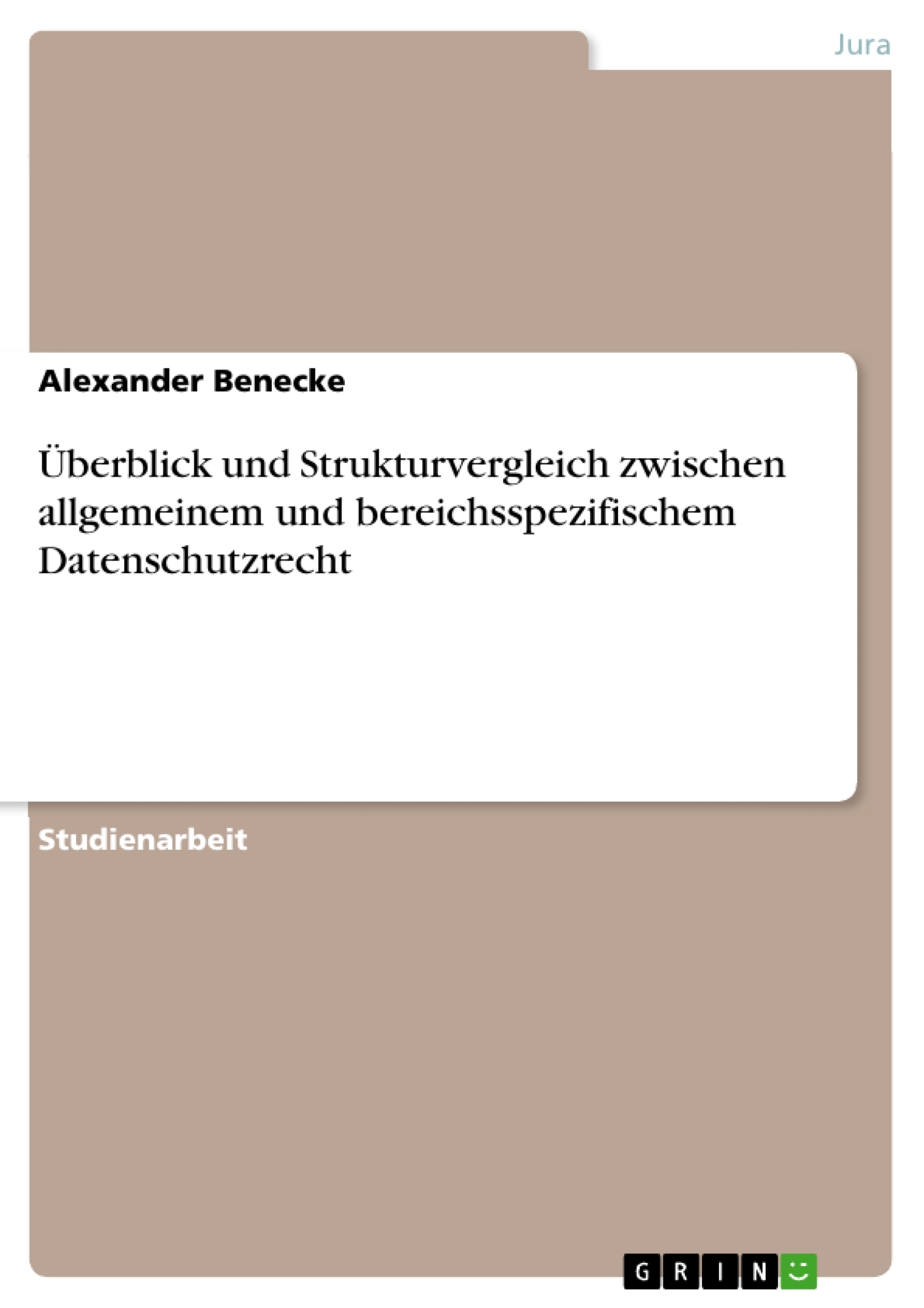„Experience should teach us to be most on our guard to protect liberty when the Government’s purposes are beneficent. Men born to freedom are naturally alert to repel invasion of their liberty by evil-minded rulers. The greatest dangers to liberty lurk in insidious encroachments by men of zeal, wellmeaning but without understanding.” Mit diesem Ausspruch bewies der amerikanische Bundesrichter Justice Brandeis bereits 1928 das Gespür und die Vernunft zu erkennen, dass sich ein wohltätiger und behütender Staat durch sein Bestreben, sich Bedrohungen des Gemeinwohls durch umfassende Regelungssysteme zu erwehren, immer auch der Gefahr ausufernder Kritik aussetzt. Bereits seit der Entscheidung des deutschen Gesetzgebers, die Verarbeitung personenbezogener Daten nur unter gesetzlichen Voraussetzungen zuzulassen, haben ebensolche Kritik und Zweifel am Datenschutz einen Nährboden gefunden. Zwar gehört der Datenschutz zu den seltenen Problemfeldern in unserer technisierten Gesellschaft, die von Politik und Jurisprudenz bereits angegangen wurden, bevor ein entsprechender Regelungsbedarf in der Öffentlichkeit gefordert wurde - schließlich waren Gefahren durch Computer und immer größere Speicherungsmöglichkeiten im Jahr 1979, den Jahr, in dem das erste Bundesdatenschutzgesetzes in Kraft getreten ist, längst nicht in der heutigen Form bekannt. Dennoch flaute die Kritik an einem einerseits zu intensiven, aber andererseits nicht umfassenden Datenschutzkonzept des Gesetzgebers auch nach mehreren Novellierungen des BDSG nicht ab. Infolge dieser Diskussionen trat schließlich im Rahmen der Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte 1996 das Telekommunikationsgesetz in Kraft, welches in § 89 TKG bereits eine eigene Norm zur Bekämpfung datenschutzrechtlicher Problemstellungen im Telekommunikationssektor kannte. Eine Differenzierung zwischen allgemeinem und bereichsspezifischem Datenschutzrecht in BDSG und TKG war somit für das deutsche Recht besiegelt.
Die vorliegende Arbeit soll einerseits klären, inwieweit es dem Gesetzgeber bis zum heutigen Tage gelungen ist, an dieser Konzeption festzuhalten und anderseits die Praktikabilität dieser Konzeption durch einen Strukturvergleich zwischen dem allgemeinen Datenschutzrecht des BDSG und dem bereichsspezifischem Datenschutzrecht des TKG kritisch hinterfragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeines Datenschutzrecht
- Die informationelle Selbstbestimmung
- Die Rechtsgrundlagen des allgemeinen Datenschutzrechts
- Die Rechtsnatur des allgemeinen Datenschutzrechts
- Die Grenzen des allgemeinen Datenschutzrechts
- Bereichsspezifisches Datenschutzrecht
- Das Telekommunikationsrecht
- Das Datenschutzrecht im Telekommunikationsbereich
- Das neue Datenschutzrecht im Telekommunikationsbereich
- Der Datenschutz bei Location Based Services
- Strukturvergleich zwischen allgemeinem und bereichsspezifischem Datenschutzrecht
- Die Rechtsgrundlagen
- Die Rechtsnatur
- Die Grenzen
- Das Prinzip der Verhältnismässigkeit
- Das Prinzip der Datensparsamkeit
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Struktur des Datenschutzrechts in Deutschland. Sie beleuchtet das allgemeine Datenschutzrecht und vergleicht es mit dem bereichsspezifischen Datenschutzrecht im Telekommunikationsbereich. Das Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen beiden Rechtsbereichen aufzuzeigen und die Bedeutung des Datenschutzes in der digitalen Welt hervorzuheben.
- Die informationelle Selbstbestimmung als zentrales Prinzip des Datenschutzes
- Die Rechtsgrundlagen des allgemeinen und des bereichsspezifischen Datenschutzrechts
- Die Regulierung des Datenschutzes im Telekommunikationsbereich
- Der Vergleich der Rechtsnatur und der Grenzen beider Rechtsbereiche
- Die Bedeutung des Datenschutzes im Kontext von Location Based Services
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet eine kurze Einführung in das Thema Datenschutz und skizziert die Relevanz des Datenschutzes in der heutigen Zeit. Das Kapitel über das allgemeine Datenschutzrecht beleuchtet das Prinzip der informationellen Selbstbestimmung, die Rechtsgrundlagen des allgemeinen Datenschutzrechts und die Grenzen dieses Rechtsbereichs. Der Fokus liegt hier auf der rechtlichen Grundlage des Datenschutzes und seiner Bedeutung für die individuelle Freiheit. Die Kapitel über das bereichsspezifische Datenschutzrecht und den Strukturvergleich zwischen beiden Rechtsbereichen untersuchen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten des allgemeinen und des bereichsspezifischen Datenschutzes. Dabei werden die Rechtsgrundlagen, die Rechtsnatur, die Grenzen und die Prinzipien des Datenschutzes im Telekommunikationsbereich im Vergleich zum allgemeinen Datenschutzrecht betrachtet.
Schlüsselwörter
Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung, Telekommunikationsrecht, Datenschutzrecht, Datenschutz im Telekommunikationsbereich, allgemeine Datenschutzgrundsätze, Rechtssicherheit, Datensparsamkeit, Verhältnismässigkeit, Location Based Services.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung?
Es ist das Recht des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu bestimmen.
Was ist der Unterschied zwischen allgemeinem und bereichsspezifischem Datenschutz?
Der allgemeine Datenschutz (BDSG) gilt universell, während bereichsspezifische Gesetze (wie das TKG) spezielle Regeln für Branchen wie die Telekommunikation festlegen.
Was regelt das Telekommunikationsgesetz (TKG) beim Datenschutz?
Das TKG enthält spezifische Normen zur Bekämpfung datenschutzrechtlicher Probleme im Sektor, wie z.B. bei Location Based Services.
Was bedeutet das Prinzip der Datensparsamkeit?
Es besagt, dass so wenig personenbezogene Daten wie möglich erhoben und verarbeitet werden sollten.
Warum wurde Datenschutz bereits vor der breiten Computernutzung geregelt?
Politik und Jurisprudenz erkannten frühzeitig die Gefahren durch wachsende Speichermöglichkeiten, was 1979 zum ersten BDSG führte.
- Arbeit zitieren
- Alexander Benecke (Autor:in), 2010, Überblick und Strukturvergleich zwischen allgemeinem und bereichsspezifischem Datenschutzrecht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158299