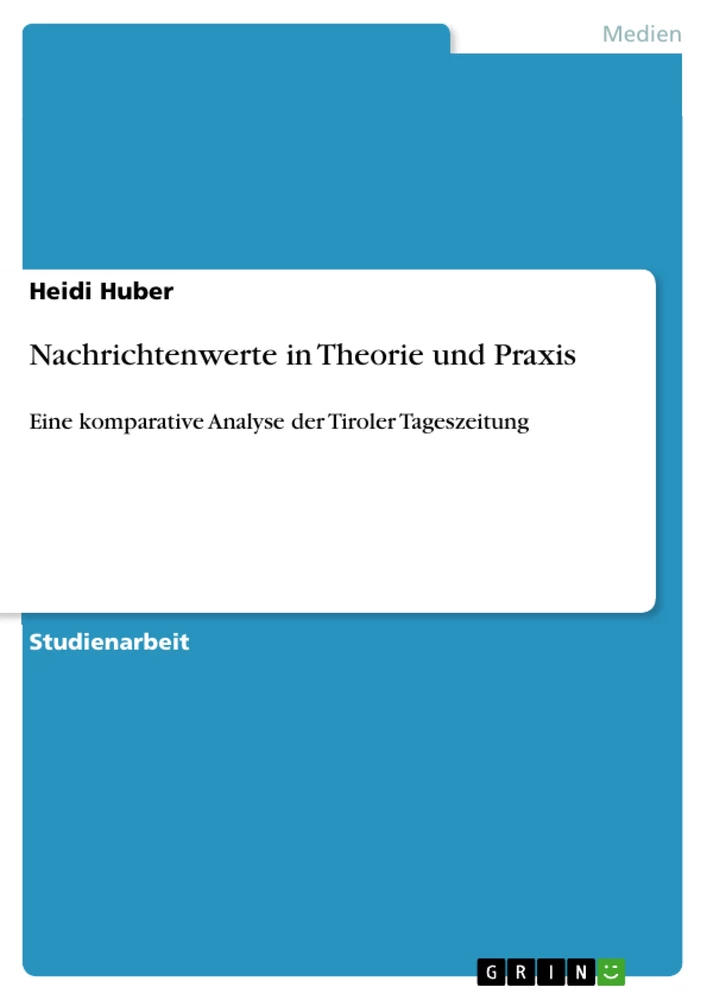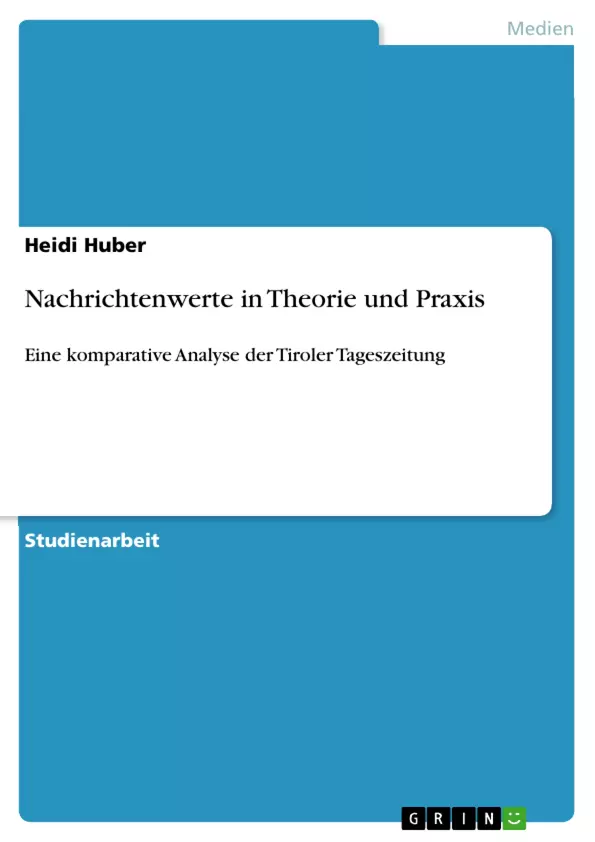„Qualität und Quote, und zwar in dieser Reihenfolge!“ – So lautete das Zitat der beiden Chefredakteure der Tiroler Tageszeitung (TT), Alois Vahrner und Mario Zenhäusern in der Ausgabe vom 11. März 2010. Ausgangspunkt für diese Wortspende der Chefredaktion war eine österreichweite Leseranalyse im Jahr 2009 unter Entscheidungsträgern, die der Tiroler Tageszeitung, so schreibt sie auch selbst in einem kurzen Aufreißer auf der Titelseite, einen historischen Höchstwert einbrachte. „80 Prozent der Entscheider lesen TT“ – dieser Artikel auf Seite 12 erstreckt sich als einziger der gesamten Ausgabe auf eine gesamte Seite.
Nun lässt diese Berichterstattung und Eigenwerbung des Mediums eine Schlussfolgerung zu: Die Tiroler Tageszeitung zählt sich selbst zu den Qualitätszeitungen und definiert sich auch als solche. Diese Aussage ist ambivalent, zumal die Tiroler Tageszeitung, forciert durch den Eigentümer Moser Holding, in den letzten Jahren verstärkt dem Druck der „Kronen Zeitung“ am Tageszeitungsmarkt ausgesetzt war und noch heute ist. Die kurzlebige „Neue“ der Moser Holding als Konkurrenzprodukt zur „Krone“ verschwand schon wieder vom Markt, dafür erschien eine abgespeckte Version der Tiroler Tageszeitung als Konkurrenzprodukt und die Zeitung selbst plötzlich sieben Tage die Woche. Geht die Tiroler Tageszeitung also doch in Richtung Boulevard? Diese Frage – Qualität oder Boulevard – gilt es in dieser Arbeit zu klären. Damit drängt sich unweigerlich eine Frage auf – wie kann man dies empirisch überprüfen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung und Relevanz
- 1.2. Zentrale Fragestellung
- 1.3. Operationalisierung und Aufbau der Arbeit
- 2. Theoretischer Background
- 2.1. Theorie und Praxis im Spannungsverhältnis
- 2.2. Die Nachrichtenwerttheorie im Zeitraffer
- 2.3. Vor- und Nachteile der NWT
- 2.4. Adaptierung der NRW-Theorie: Codierbogen und Analyserahmen
- 2.5. Qualität vs. Boulevard: Selektion der Zeitungen
- 3. Die Tiroler Tageszeitung
- 3.1. Geschichte und Bedeutung der TT
- 3.2. Produktanalyse
- 3.4. Die Erkenntnisse der komparativen Produktanalyse
- 4. Empirische Auswertung: Die Nachrichtenwertfaktoren
- 4.1. Die Ergebnisse der TT im Detail
- 4.2. Qualität vs. Boulevard: Die Nachrichtenwerte im Vergleich
- 4.3. Quo vadis TT?
- 5. Konklusion
- 5.1. Resümee
- 5.2. Beantwortung der Forschungsfragen
- 5.3. Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die Tiroler Tageszeitung hinsichtlich ihrer Berichterstattung im Hinblick auf Nachrichtenwerte zu analysieren und im Kontext österreichischer Qualitäts- und Boulevardzeitungen zu positionieren. Die Arbeit untersucht, inwieweit die TT in ihrer Themenauswahl und Nachrichtenselektion den Kriterien von Qualitäts- oder Boulevardzeitungen entspricht.
- Die Rolle der Nachrichtenwerttheorie in der journalistischen Praxis
- Die Analyse der Tiroler Tageszeitung als regionales Medium
- Der Vergleich der Nachrichtenwerte in der Tiroler Tageszeitung mit österreichischen Qualitäts- und Boulevardzeitungen
- Die Relevanz von Nachrichtenwerten für die journalistische Berichterstattung
- Die Positionierung der Tiroler Tageszeitung im Medienmarkt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problemstellung ein und stellt die Relevanz des Themas dar. Sie erläutert die zentrale Fragestellung der Arbeit und die Operationalisierung des Forschungsprozesses.
Das Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem theoretischen Hintergrund der Arbeit und beleuchtet die Nachrichtenwerttheorie in ihren verschiedenen Facetten. Es werden die Vor- und Nachteile der NWT diskutiert und die Adaptierung der Theorie für die Analyse der Tiroler Tageszeitung dargestellt.
Kapitel 3 stellt die Tiroler Tageszeitung als Medium vor, beleuchtet ihre Geschichte und Bedeutung und analysiert ihr Produkt im Vergleich zu anderen Tageszeitungen.
Im vierten Kapitel werden die empirischen Ergebnisse der Analyse der Nachrichtenwerte in der Tiroler Tageszeitung präsentiert und im Detail diskutiert. Die Ergebnisse werden mit den Nachrichtenwerten in Qualitäts- und Boulevardzeitungen verglichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Nachrichtenwerttheorie, Qualitätsjournalismus, Boulevardjournalismus, Tiroler Tageszeitung, Produktanalyse, Medienvergleich, empirische Forschung, regionale Medien, Nachrichtenselektion, Themenauswahl.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Nachrichtenwerttheorie?
Die Theorie besagt, dass Journalisten Nachrichten nach bestimmten Faktoren (wie Prominenz, Nähe, Konflikt oder Aktualität) selektieren. Je mehr Faktoren zutreffen, desto höher ist der Nachrichtenwert.
Gilt die Tiroler Tageszeitung als Qualitäts- oder Boulevardzeitung?
Die Arbeit untersucht genau dieses Spannungsfeld. Während die TT sich selbst als Qualitätsmedium definiert, führen Marktdruck und Konkurrenz zur "Kronen Zeitung" zu boulevardesken Tendenzen.
Was ist ein Codierbogen in der Medienanalyse?
Ein Codierbogen ist ein Instrument zur empirischen Auswertung, mit dem Nachrichtenartikel systematisch nach bestimmten Kriterien (Nachrichtenfaktoren) erfasst und verglichen werden.
Wie beeinflusst der Wettbewerb die Nachrichtenselektion?
Starker Wettbewerb kann dazu führen, dass Medien verstärkt auf emotionale oder reißerische Themen setzen (Boulevardisierung), um die Leserquote zu sichern.
Welche Rolle spielen regionale Medien im Vergleich zu nationalen Zeitungen?
Regionale Medien wie die TT haben einen hohen Stellenwert für die lokale Identität und weisen oft eine sehr hohe Reichweite in ihrer spezifischen Region auf.
- Quote paper
- BA Bakk.Komm. Heidi Huber (Author), 2010, Nachrichtenwerte in Theorie und Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158308