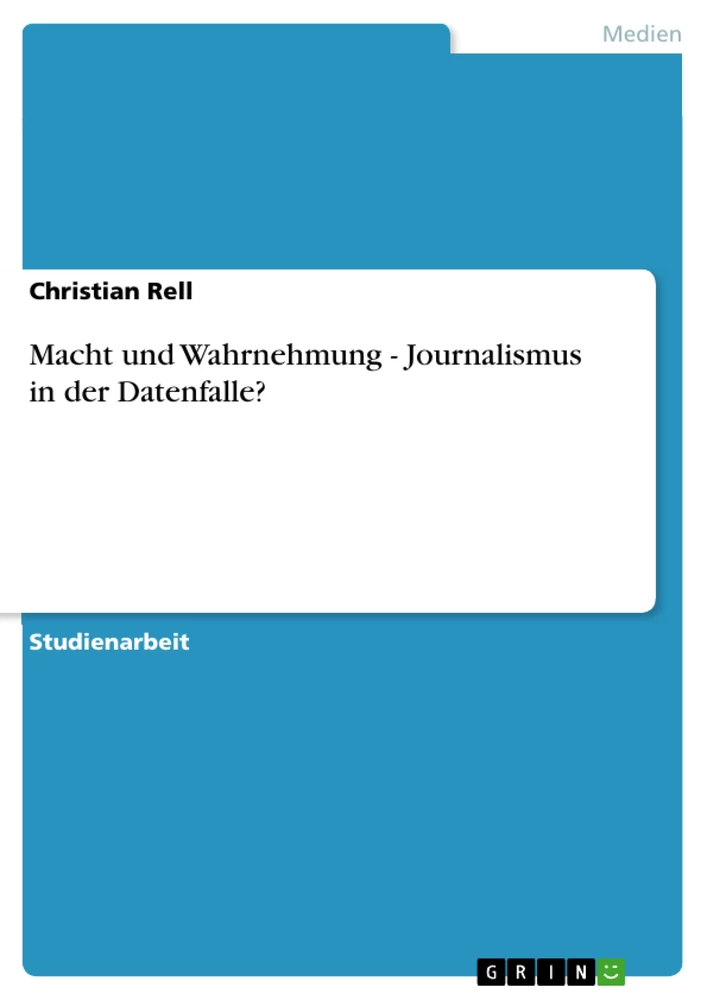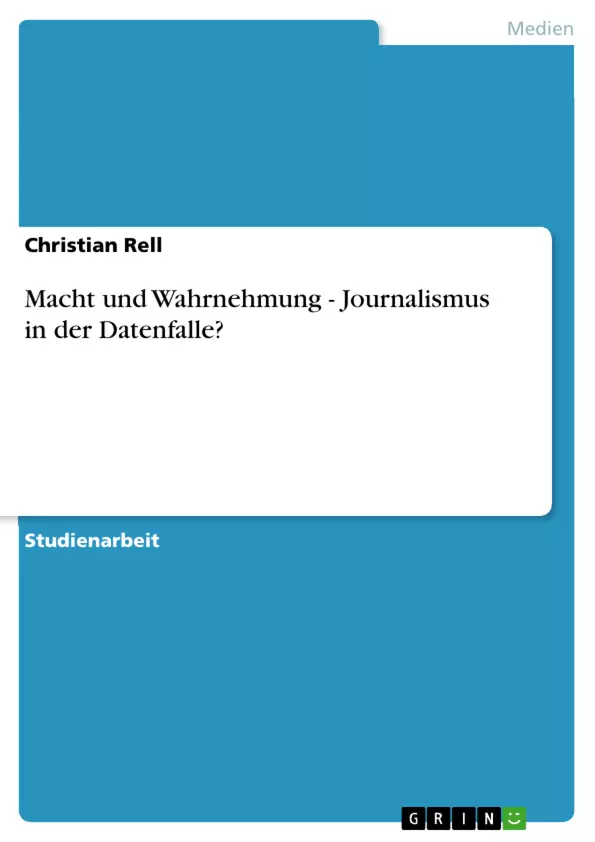Im Journalismus gewinnt die Statistik immer mehr an Bedeutung. Die Zahl und die Komplexität politischer Fragen haben – nicht zuletzt als Folge der Globalisierung und technischer Entwicklungen im Informations- und Kommunikationsbereich – in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Wer die Politik und wer die öffentliche Meinung bestimmt ist immer schwerer zu beantworten, zumal sich neben den technischen Möglichkeiten2 auch die Messinstrumente von Macht, die Arbeitswut der Demoskopen und anderer Rechenkünstler und damit die Fülle von Informationen die dadurch produziert wird exponentiell gesteigert haben und einen – theoretisch – tagtäglich, rund um die Uhr, rund um den Globus überschwämmen. Die neuen Technologien der digitalisierten Welt waren "Einschläge die den Berufsalltag verändern" und hatten laut BRUNS neben anderen Gründen eine "Beschleunigung und das damit verbundene Anschwellen der Menge von Informationen und Nachrichten" zur Folge. Und diese Welt mit ihrer schier grenzenlosen Sozialstruktur und ihren zahllosen politischen Bühnen ist der Arbeitsplatz der politischen Journalisten. Mit diesem Thema soll sich die vorliegende Arbeit, welche im Rahmen des Hauptseminars "Politischer Journalismus" bei Dr. Richard Meng entstanden ist, auseinandersetzen.
Es wird gezeigt, welchen Nutzen der Einsatz von Zahlenmaterial und die Verwendung empirischer Daten im politischen Journalismus bringt und welche Funktion Meinungsumfragen somit für die Gesellschaft und die Demokratie im besonderen haben. Hierbei sollen nachrichtenwerttheoretische Überlegungen im Vordergrund stehen, die sich im Zusammenhang mit statistischen Daten ergeben. Auf der Gegenseite sollen aber auch die Fehler aufgezeigt werden, die der Journalist im Umgang mit empirisch ermittelten Daten machen kann, wobei insbesondere auf die unterschiedliche Verwendung dieser Daten und den unterschiedlichen journalistischen Anspruch im Qualitäts- und im Boulevardjournalismus eingegangen werden soll. In diesem Zusammenhang werden auch die Interpretationsspielräume die im Journalismus genutzt werden dargestellt.
Im politischen Journalismus ist der Umgang mit Zahlen ebenso wichtig wie Kenntnisse über politische Strukturen und von Politikern, und daher setzen Journalisten nicht nur das Publikum einem „Information overload“ aus, sondern stehen auch selbst unter Dauerbeschuss.
Der Korrektor bescheinigt dem Autoren dieser Arbei, dass die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema "vieles vieles zu Tage gefördert" hat.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1 JOURNALISMUS IM DYNAMISCHEN UMFELD: WAS ERZEUGT DIE ZAHLENFLUT?
- 1.1 Der Journalist unter Dauerbeschuss
- 1.2 Die Demoskopie ist als Datenproduzent gefragt wie nie
- 1.3 Auskunftspflicht der Behörden und die Leistung der amtlichen Statistik
- 1.3.1 Die Auskunftspflicht der Behörden
- 1.3.2 Informationsleistung der amtlichen Statistik
- 1.4 Der Journalist im Datendschungel
- 1.5 Eine sich verändernde Gesellschaft
- 1.6 Praktische Auswirkungen auf den journalistischen Arbeitsalltag
- 2. DER NUTZEN VON ZAHLEN FÜR DEN JOURNALISTEN
- 2.1 Zahlen - notwendiges Übel oder Bereicherung?
- 2.2 ,,Umfragewerte als Nachricht“
- 3. UMGANG UND MÖGLICHER MACHTMISSBRAUCH VON DATEN
- 3.1 Der Umgang mit Zahlen als Qualitätsmaßstab
- 3.2 Verantwortlichkeit der Medien
- 3. 3 Journalismus und Demoskopie: ein Konkurrenzverhältnis?
- 4. JOURNALISTEN IM UMGANG MIT ZAHLEN
- 4.1 Haben Journalisten überhaupt Ahnung von Statistik?
- 4.2 Lösungsvorschläge
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die zunehmende Bedeutung von Daten und Statistiken im Journalismus, insbesondere im politischen Kontext. Sie analysiert die Ursachen der Datenflut und die damit verbundenen Herausforderungen für Journalisten. Darüber hinaus wird der Einfluss von Daten auf die Wahrnehmung politischer Prozesse sowie das Potenzial für Machtmissbrauch beleuchtet.
- Die wachsende Rolle von Daten und Statistiken im Journalismus
- Die Ursachen und Folgen der Datenflut im politischen Kontext
- Der Umgang mit Daten im politischen Journalismus und die Gefahr von Manipulation
- Die Bedeutung von Meinungsforschung und Umfragen für die politische Berichterstattung
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten des Journalismus im Umgang mit komplexen Daten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die zunehmende Datenflut im politischen Kontext und die Herausforderungen, die diese für Journalisten darstellt. Es werden die Ursachen der Datenflut beleuchtet, darunter die Globalisierung, technische Entwicklungen und die zunehmende Bedeutung von Meinungsforschung und Statistik. Das Kapitel beleuchtet auch die Auswirkungen dieser Entwicklung auf den journalistischen Arbeitsalltag.
Kapitel zwei befasst sich mit dem Nutzen von Zahlen für den Journalisten. Es werden die Vorteile und Herausforderungen der Verwendung von Daten in der politischen Berichterstattung diskutiert. Außerdem wird die Rolle von Umfrageergebnissen in der Nachrichtenproduktion untersucht.
Im dritten Kapitel wird der Umgang mit Daten und das Potenzial für Machtmissbrauch im politischen Bereich beleuchtet. Es werden die Herausforderungen im Umgang mit Zahlen als Qualitätsmaßstab sowie die Verantwortung der Medien in diesem Kontext diskutiert. Außerdem wird das Verhältnis von Journalismus und Demoskopie untersucht.
Kapitel vier widmet sich der Frage, inwiefern Journalisten über die notwendigen statistischen Kenntnisse verfügen, um mit der Datenflut umgehen zu können. Es werden Lösungsansätze für die Herausforderungen im Umgang mit komplexen Daten präsentiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Datenflut, politischer Journalismus, Meinungsforschung, Statistik, Machtmissbrauch, Datenanalyse, Journalismusqualität, Informationsgesellschaft, Digitalisierung, und politische Berichterstattung.
Häufig gestellte Fragen
Warum nimmt die Bedeutung von Statistiken im politischen Journalismus zu?
Durch die Globalisierung und technische Entwicklungen sind politische Fragen komplexer geworden. Journalisten nutzen Daten, um diese Komplexität zu bewältigen und die öffentliche Meinung messbar zu machen.
Was wird unter dem Begriff "Information Overload" im Journalismus verstanden?
Es beschreibt die Beschleunigung und das Anschwellen der Nachrichtenmenge durch digitale Technologien, wodurch Journalisten ständig unter "Dauerbeschuss" von Informationen stehen.
Welche Gefahren bestehen beim Umgang mit empirischen Daten?
Es besteht das Risiko von Interpretationsfehlern, Manipulationen und Machtmissbrauch, insbesondere wenn statistische Kenntnisse fehlen oder Daten im Boulevardjournalismus anders gewichtet werden.
Welche Funktion haben Meinungsumfragen für die Demokratie?
Meinungsumfragen dienen als Nachrichtenfaktor und Instrument zur Messung von Machtverhältnissen, bringen jedoch auch ein Konkurrenzverhältnis zwischen Journalismus und Demoskopie mit sich.
Haben Journalisten ausreichende Kenntnisse in Statistik?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob Journalisten über das notwendige Fachwissen verfügen, und schlägt Lösungen vor, um die Qualität im Umgang mit komplexen Daten zu sichern.
- Citation du texte
- Christian Rell (Auteur), 2009, Macht und Wahrnehmung - Journalismus in der Datenfalle?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158310