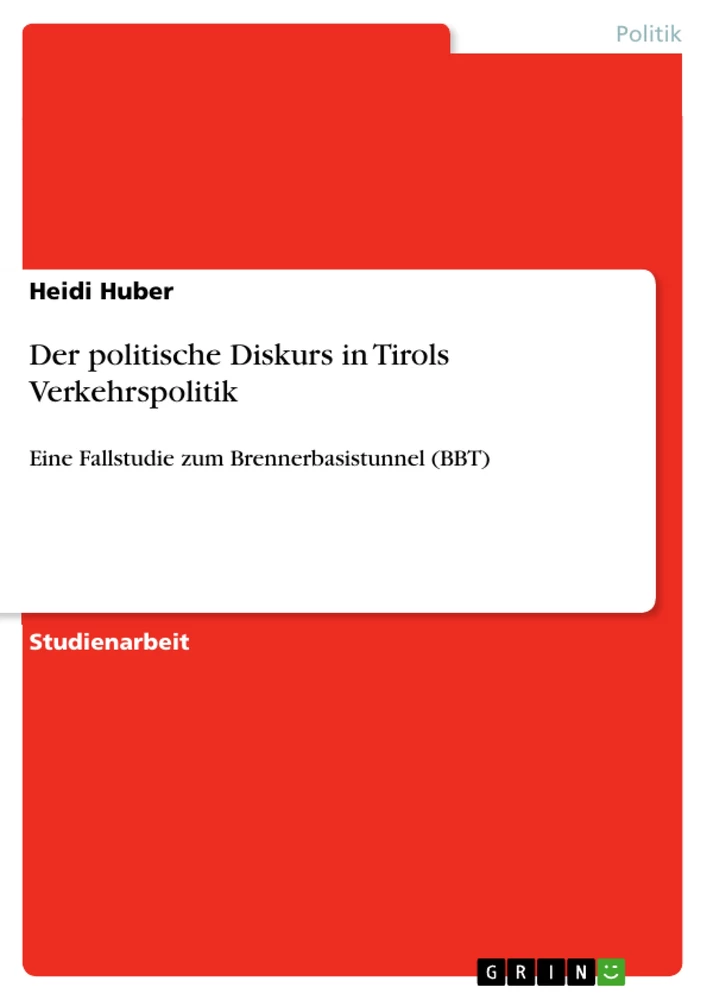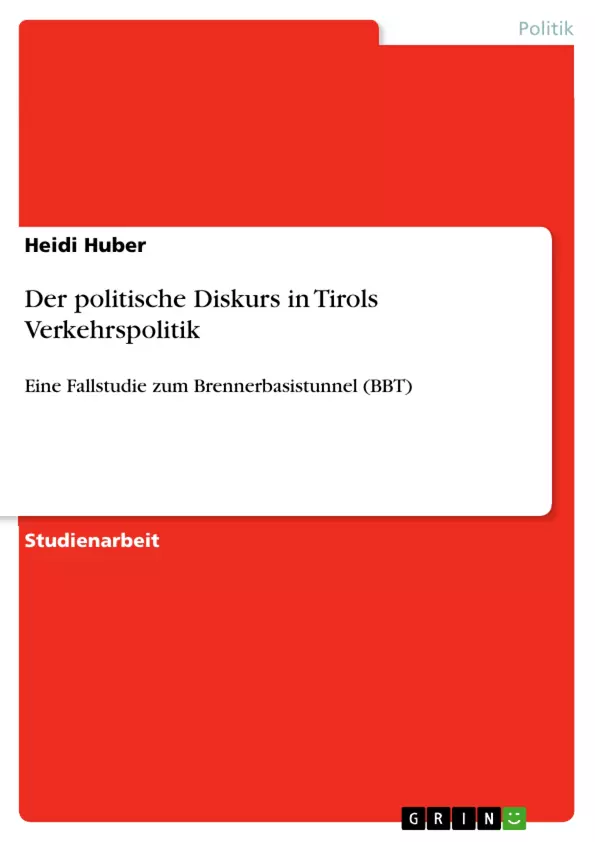Tirol ist ein Bundesland, das stark vom Transitverkehr in Mitleidenschaft gezogen ist. Eine Hauptverkehrsverbindung, nämlich die Brenner-Autobahn, soll durch ein milliardenschweres Verkehrsprojekt entlastet werden – der Brenner Basistunnel, kurz BBT. Im Herbst 2006 wurden die Pläne für den Bau konkret. Seit etwa 20 Jahren aber denkt man schon an einen solchen 55 Kilometer langen Tunnel unter dem Brennerpass. Der BBT ist neben dem Schweizer Gotthardtunnel der längste Alpentunnel und das wichtigste Teilstück im Rahmen des Transeuropäischen Netzes (TEN).
Das Projekt rund um den BBT bezieht eine Vielzahl an Akteuren mit ein. Zum einen ist hier die Bevölkerung entlang des Wipptales und der Brenner Autobahn, die mit dem zunehmenden Verkehrsaufkommen auch unter Lärm und Umweltverschmutzung leidet. Der Tunnel ist ein Projekt zweier EU-Länder (und damit auch der Landesregierungen), die sich die Finanzierung gemeinsam mit der Europäischen Union teilen. Auch die Frächterlobby ist im Diskurs um den Brenner Basistunnel integriert, ebenso wie die Baulobby und Umweltschützer wie das Transitforum Tirol und Südtirol.
Das Megaprojekt BBT soll 2010 in Bau gehen und zwischen 2020 und 2022 fertig gestellt werden.
Der Diskurs um den BBT zielt in verschiedene Richtungen und ist ausgehend von zwei theoretischen Konzepten, nämlich Maarten Hajers „Discourse coalition“ und Paul Sabatiers „Advocacy Coalition“ analysierbar. Zum einen stellt der Tunnel in den Augen vieler nicht die Lösung für das Problem rund um den Verkehr im Wipptal dar (die Bevölkerung der einzelnen Gemeinden ist hier gespalten). Ein sektorales Lkw-Fahrverbot oder ein Nachtfahrverbot wird beispielsweise schon längst gefordert. Zudem wird die Rentabilität des Tunnels, der immerhin mit Steuergeldern finanziert wird, in Frage gestellt. Bis zur Fertigstellung wird der Verkehr über den Brennerpass und damit der Brenner-Autobahn weiter anwachsen. Der Tunnel wäre nach Meinung vieler also nur in der Lage, die bis dahin zusätzlichen Schwertransporte zu kompensieren, nicht jedoch das bereits bis jetzt sehr hohe Verkehrsaufkommen zu reduzieren, sondern nur das Anwachsen zu verlangsamen. Es stellt sich daher die Frage, ob der Tunnel in 20 Jahren noch gebraucht wird. Auf der anderen Seite sehen zahlreiche Bürgermeister der betroffenen Gemeinden den BBT als Ideallösung an. Auch von wirtschaftlicher Seite kommen Bedenken, ob sich der Tunnel rentiert oder ob er einfach nur ein Milliardengrab darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Themenrelevanz
- Zentrale Fragestellung
- Aufbau der Arbeit
- Theoretischer Background: Policy Change
- Der ,,Discourse coalition“-Ansatz nach M. Hajer
- Sabatiers Advocacy Coalition Approach
- Discourse vs. Advocacy-Coalitions
- Der Brenner Basistunnel: Ein länderübergreifendes Politikum
- Der BBT: Geschichte, Zahlen, Daten, Fakten
- Geteilte Meinungen
- Analyse des vorherrschenden Diskurses
- Policy Change in Tirols Verkehrspolitik
- Konklusion
- Resümee
- Beantwortung der Forschungsfrage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Proseminararbeit befasst sich mit dem politischen Diskurs um den Brenner Basistunnel (BBT) in Tirol. Das Ziel der Arbeit ist es, die Faktoren des Policy Change im Kontext des Verkehrsprojekts zu untersuchen. Dazu werden die theoretischen Ansätze von Maarten Hajer und Paul Sabatier herangezogen, um die Dynamik des Diskurses und die beteiligten Akteure zu analysieren.
- Politischer Diskurs und Policy Change im Bereich der Verkehrspolitik in Tirol
- Analyse des Brenner Basistunnels als länderübergreifendes Politikum
- Anwendung von Diskurs- und Advocacy-Koalitionsmodellen auf die Debatte um den BBT
- Identifizierung von Einflussfaktoren und Akteuren im Diskurs um den Brenner Basistunnel
- Bewertung der Auswirkungen des BBT auf Tirols Verkehrspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und Relevanz des Themas vor und führt die zentrale Fragestellung sowie den Aufbau der Arbeit aus. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Modelle von Maarten Hajer (Diskurskoalitionen) und Paul Sabatier (Advocacy-Coalitions) zur Analyse von Policy Change präsentiert. Kapitel drei beschäftigt sich detailliert mit dem Brenner Basistunnel, seinen Fakten und den kontroversen Debatten in der Öffentlichkeit. Hier werden die relevanten Akteure und Diskurse mit Bezug auf die Modelle von Hajer und Sabatier analysiert. Das vierte Kapitel wird die Forschungsfrage beantworten und die Hypothese verifizieren oder falsifizieren, indem es die Auswirkungen des BBT auf Tirols Verkehrspolitik beleuchtet.
Schlüsselwörter
Policy Change, Brenner Basistunnel, Diskurskoalitionen, Advocacy-Coalitions, Verkehrspolitik, Tirol, Umweltverschmutzung, Transitverkehr, Transportlobby, Finanzierung, Nachhaltigkeit, Public Policy.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Brenner Basistunnel (BBT)?
Der BBT ist ein 55 Kilometer langes Tunnelprojekt unter dem Brennerpass, das den Transitverkehr entlasten soll und Teil des Transeuropäischen Netzes (TEN) ist.
Welche theoretischen Ansätze werden zur Analyse der Verkehrspolitik genutzt?
Die Arbeit nutzt den „Discourse coalition“-Ansatz nach Maarten Hajer und den „Advocacy Coalition“-Approach nach Paul Sabatier.
Warum ist das Projekt BBT in Tirol umstritten?
Kritiker zweifeln an der Rentabilität, befürchten ein "Milliardengrab" und fordern stattdessen sofortige Maßnahmen wie Lkw-Fahrverbote zur Lärmreduktion.
Welche Akteure sind am Diskurs um den BBT beteiligt?
Beteiligt sind die EU, die Regierungen von Österreich und Italien, die lokale Bevölkerung, die Frächter- und Baulobby sowie Umweltschutzorganisationen.
Was versteht man unter "Policy Change" in diesem Kontext?
Es beschreibt den Wandel in der politischen Strategie und Entscheidungsfindung der Tiroler Verkehrspolitik durch den Einfluss verschiedener Koalitionen und Diskurse.
- Quote paper
- BA Bakk.Komm. Heidi Huber (Author), 2010, Der politische Diskurs in Tirols Verkehrspolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158378