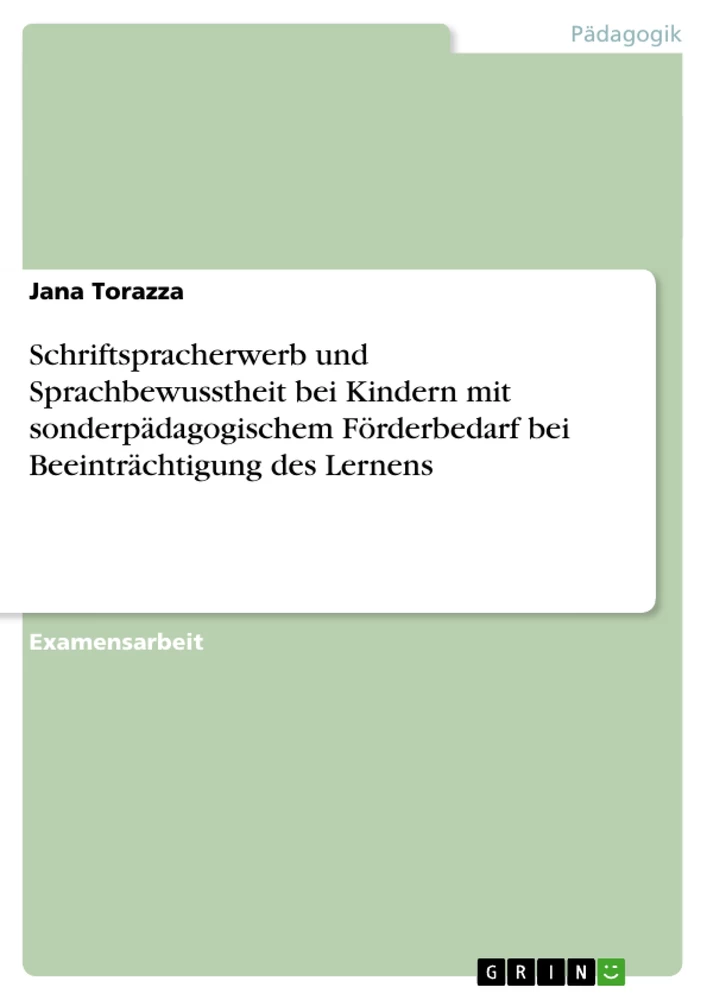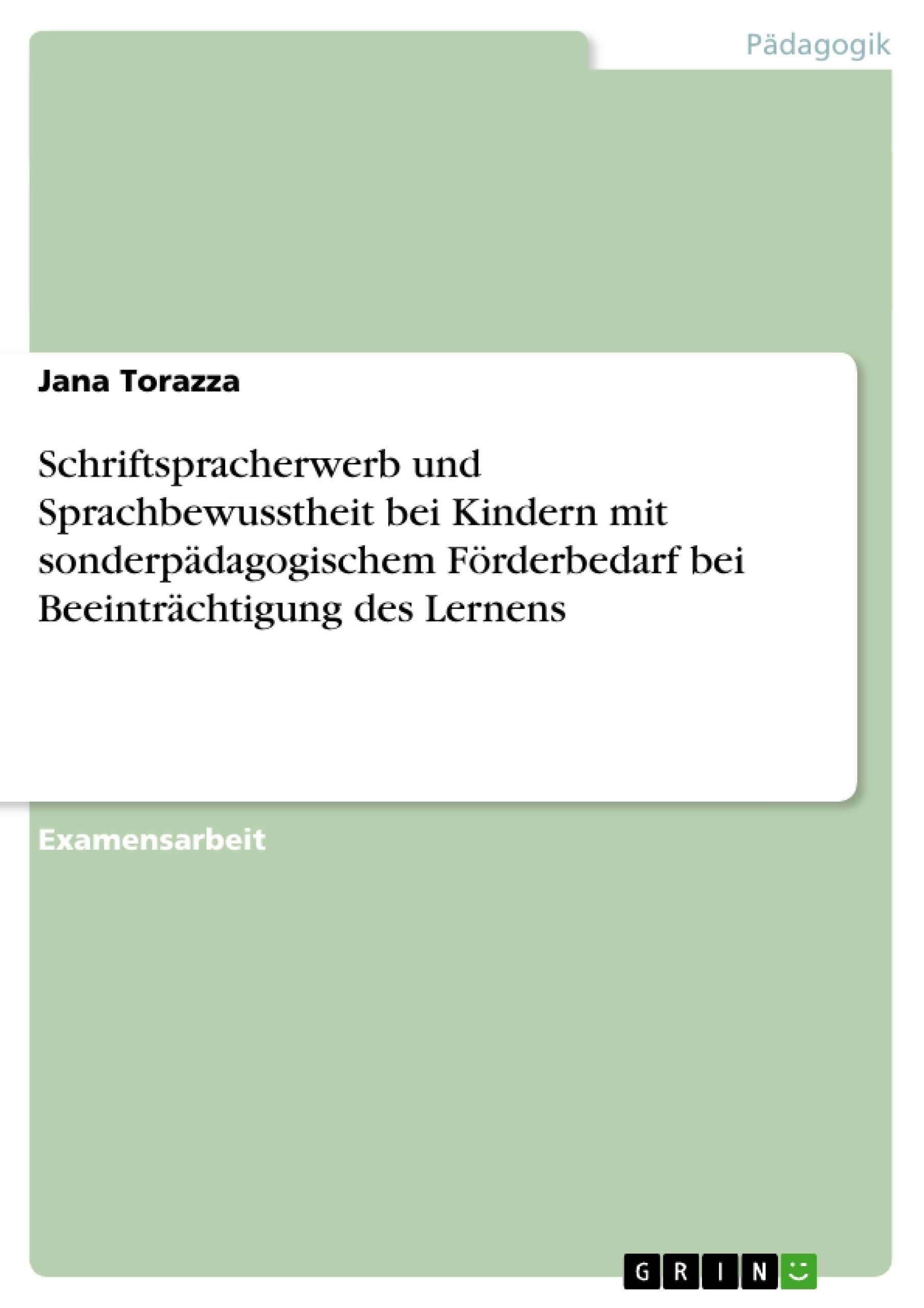[...] In der Erforschung der Vorhersagbarkeit von Lese- und Rechtschreibleistungen
wird im Besonderen die Teilkompetenz „phonologische Bewusstheit“
als gute Vorhersagevariable diskutiert (vgl. 5.1). Allerdings
ist noch offen, in welchem Verhältnis Schriftspracherwerb und
phonologische Bewusstheit stehen. Es gibt eine Reihe von
Untersuchungen, die die jeweilige Position zu bestätigen scheinen.
Exemplarisch sollen daher Studien vorgestellt werden, wobei bezüglich
unterschiedlicher Begrifflichkeiten die Vergleichbarkeit erschwert wird
(vgl. 5.1.).
Die Phasen des Schriftspracherwerbs werden von den Kindern individuell
durchlaufen. Es gibt Rückschritte und es werden Lernplateaus
eingelegt. Fehler sind auf diesem Weg nicht vermeidbar und werden
von allen Kindern gemacht. Allerdings gibt es auch Schüler, die besondere
Schwierigkeiten haben, sich die Schriftsprache anzueignen. Als
besonderes Problem soll der Übergang von der logographemischen
Phase zur alphabetischen Phase des Schriftspracherwerbs herausgearbeitet
werden. Auch die anderen Phasenübergänge bereiten Kindern
mit sonderpädagogischem Förderbedarf des Lernens Probleme, allerdings
beruht die alphabetische Strategie auf der phonologischen Bewusstheit
(vgl. 5.2.). Es soll aufgezeigt werden, warum Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf des Lernens möglicherweise phonologische Defizite zeigen,
die zum Versagen im Schriftspracherwerb führen können (vgl.
5.3.). Wenn davon ausgegangen werden kann, dass phonologische
Bewusstheit eine zentrale Rolle im Schriftspracherwerb spielt und dass
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf häufig an dieser Hürde
versagen, dann bleibt dies nicht ohne Konsequenzen. Daher soll dargestellt
werden, wie mangelnde phonologische Bewusstheit zu Schriftspracherwerbsstörungen
führen kann (vgl. 5.4.).
Für andere Teilkompetenzen existieren sicherlich auch wichtige Verbindungen
zum Schriftspracherwerb. Allerdings ist der Stellenwert der
Vorhersagbarkeit der Lese- und Rechtschreibleistungen eher gering
und soll daher nicht eingehend dargestellt werden.
Im Anschluss daran müssten normalerweise Fragen beantwortet werden,
die sich auf die Förderung und die Lernangebote in den ersten
Schuljahren beziehen. Diese Fragestellungen erachte ich für maßgeblich,
da sie vielleicht einige Kinder davor bewahren könnten, zu Schülern
mit sonderpädagogischem Förderbedarf des Lernens zu werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Die Beziehung zwischen der gesprochenen und der geschriebenen deutschen Sprache
- Die Beziehung zwischen der Laut- und der Schriftstruktur
- Der Schriftspracherwerb aus heutiger Sicht
- Legasthenie - eine ältere Sicht auf den Schriftspracherwerb
- Kritik am klassischen Konzept der Legasthenie
- Die Umorientierung in der Lese-Rechtschreibforschung
- Modelle zum Erwerb der Schriftsprache
- Zusammenfassende Betrachtung über gewonnene Einsichten im Verlauf des Schriftspracherwerbs
- Sprachbewusstheit
- Vorbemerkungen
- Definitionsprobleme
- Allgemeine Charakterisierung der Sprachbewusstheit
- Enge und weite Definitionen von Sprachbewusstheit
- Teilkkompetenzen der Sprachbewusstheit
- Sprachbewusstheit und Schriftspracherwerb
- Zusammenfassung
- Die Bedeutung von phonologischer Bewusstheit für den gestörten Schriftspracherwerb
- Phonologische Bewusstheit als Voraussetzung des Schriftspracherwerbs?
- Schwierigkeiten von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf bei Beeinträchtigung des Lernens beim Erwerb der Schriftsprache
- Erklärungsansätze für mangelnde phonologische Bewusstheit bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf bei Beeinträchtigung des Lernens
- Konsequenzen mangelnder phonologischer Bewusstheit
- Zusammenfassung
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Schriftspracherwerb und Sprachbewusstheit bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf bei Beeinträchtigung des Lernens. Sie analysiert die Herausforderungen, die diese Kinder beim Erlernen des Lesens und Schreibens haben, und untersucht, wie Sprachbewusstheit den Schriftspracherwerb beeinflussen kann.
- Bedeutung von Schriftspracherwerb und Sprachbewusstheit im Kontext von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- Entwicklung und Kritik des klassischen Legasthenie-Konzepts
- Phonologische Bewusstheit als wesentlicher Faktor für den Schriftspracherwerb
- Mögliche Ursachen für Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb bei Kindern mit Beeinträchtigung des Lernens
- Konsequenzen und mögliche Ansätze zur Förderung der Sprachbewusstheit bei dieser Schülergruppe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Relevanz von Schriftspracherwerb und Sprachbewusstheit für den schulischen und gesellschaftlichen Erfolg von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf heraus. Kapitel 2 bietet eine theoretische Grundlage, indem es die Beziehung zwischen der gesprochenen und der geschriebenen Sprache sowie die Verbindung von Laut- und Schriftstruktur untersucht. Kapitel 3 befasst sich mit dem Schriftspracherwerb aus heutiger Sicht und analysiert das klassische Legasthenie-Konzept sowie die Umorientierung der Lese-Rechtschreibforschung. Kapitel 4 widmet sich dem Thema Sprachbewusstheit, beleuchtet verschiedene Definitionen und Teilkompetenzen sowie den Zusammenhang zwischen Sprachbewusstheit und Schriftspracherwerb. Kapitel 5 untersucht die Bedeutung von phonologischer Bewusstheit für den gestörten Schriftspracherwerb, analysiert Schwierigkeiten von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und präsentiert Erklärungsansätze für mangelnde phonologische Bewusstheit. Schließlich werden in Kapitel 6 die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und ein Ausblick gegeben.
Schlüsselwörter
Schriftspracherwerb, Sprachbewusstheit, phonologische Bewusstheit, sonderpädagogischer Förderbedarf, Beeinträchtigung des Lernens, Legasthenie, Lese-Rechtschreibforschung, Modelle zum Erwerb der Schriftsprache, Schwierigkeiten, Erklärungsansätze, Förderung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist phonologische Bewusstheit?
Die Fähigkeit, die Lautstruktur der Sprache zu erkennen, wie z.B. Reime zu bilden oder Laute in Wörtern zu identifizieren.
Warum haben Kinder mit Lernbehinderung Probleme beim Lesen?
Oft fehlen grundlegende Kompetenzen in der Sprachbewusstheit, was den Übergang zur alphabetischen Strategie erschwert.
Hängt Legasthenie mit der Intelligenz zusammen?
Das klassische Konzept der Legasthenie trennte Lese-Rechtschreibstörungen von der Intelligenz, was heute jedoch kritisch hinterfragt wird.
Was ist die logographemische Phase?
Eine frühe Phase des Schriftspracherwerbs, in der Kinder Wörter wie Bilder erkennen, ohne die Laut-Buchstaben-Zuordnung zu verstehen.
Wie kann man die Sprachbewusstheit fördern?
Durch gezielte Übungen zur Lautanalyse und spielerischen Umgang mit Sprache in den ersten Schuljahren.
- Citar trabajo
- Jana Torazza (Autor), 2003, Schriftspracherwerb und Sprachbewusstheit bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf bei Beeinträchtigung des Lernens, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15840