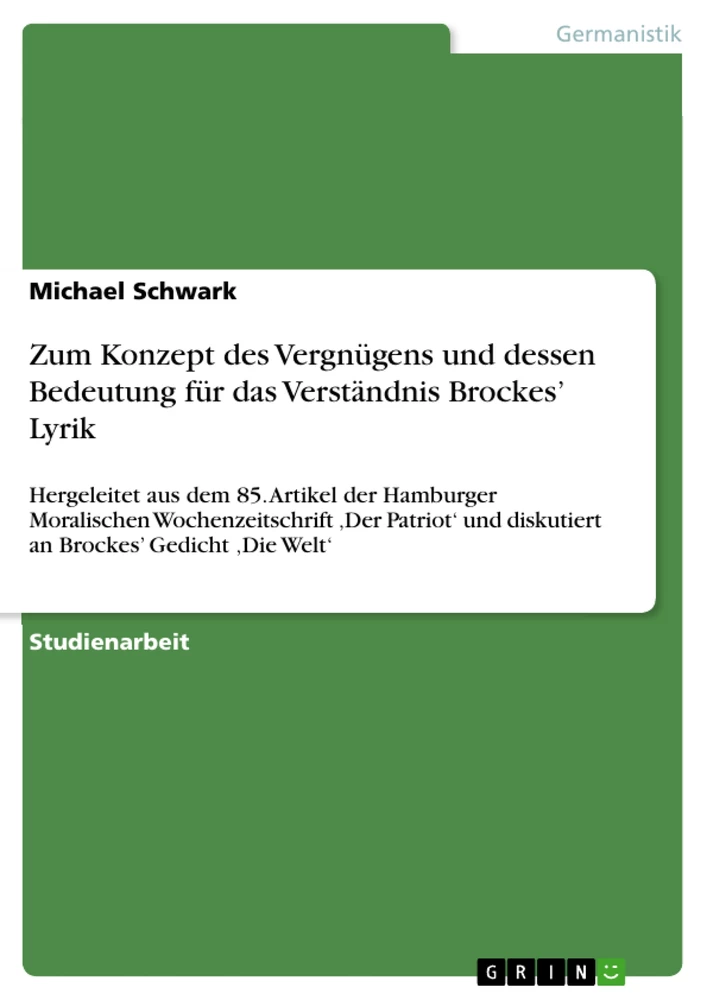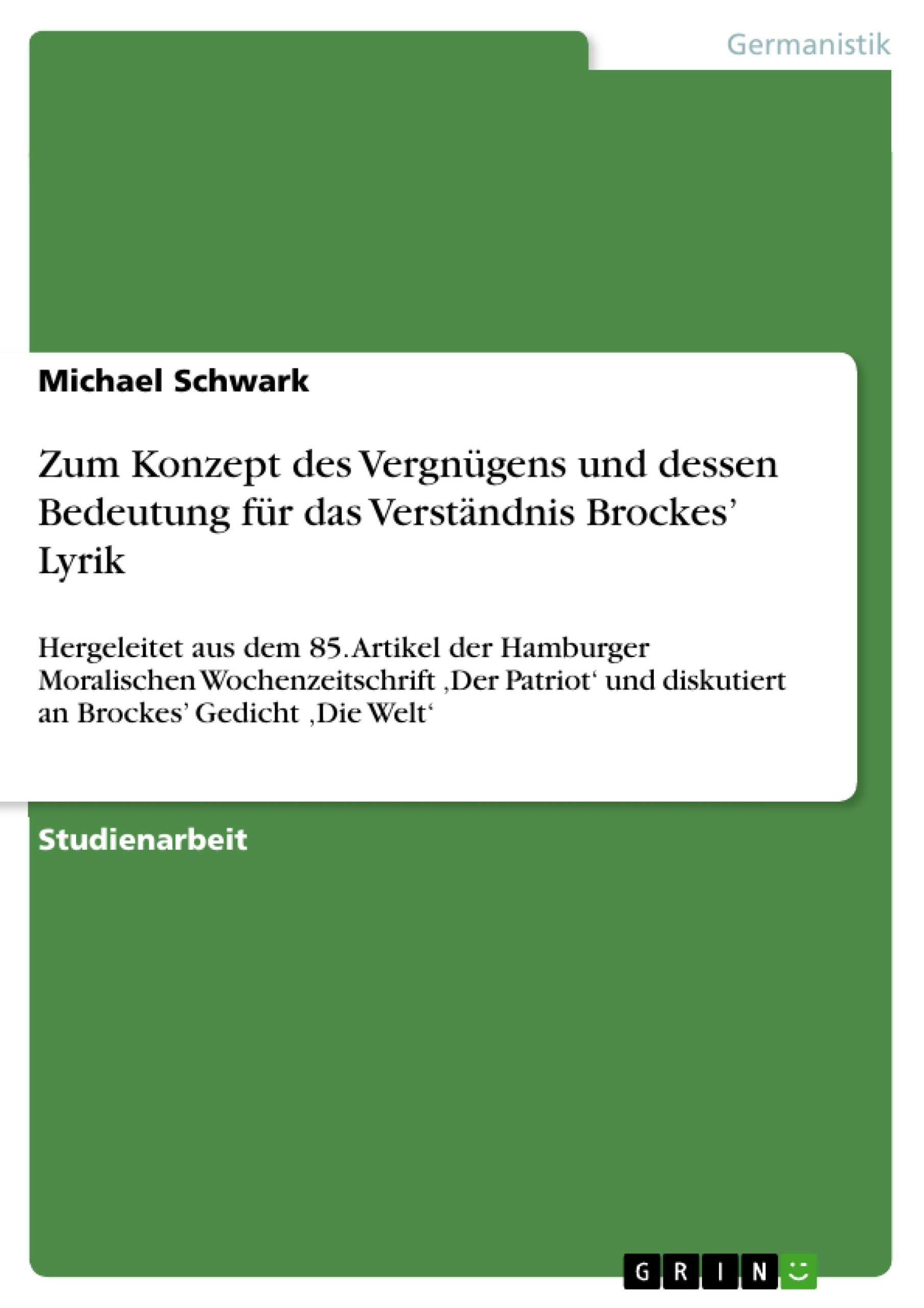Das Gros der jüngeren Forschung begreift Brockes‘ Lyrik traditionell immer noch hauptsächlich in dem Versuch der Verschränkung von Gott und Natur, christlicher Gotteserkenntnis und wissenschaftlicher Beobachtung der Natur. In den meisten Untersuchungen kommt deshalb der physikotheologischen Ausrichtung seines Werks große Bedeutung zu. Die Idee der vorliegenden Arbeit ist es, einmal nicht die Betrachtung der Lyrik des Dichters zu ihrem Ausgang zu wählen. Es soll sich ihr vielmehr über das Verständnis eines Primärtexts genähert werden, den Brockes als Mitherausgeber der frühaufklärerischen Hamburger Moralischen Wochenzeitschrift „Der Patriot“ als deren 85. Artikel am 16. August 1725, im zweiten Jahr ihres insgesamt dreijährigen Erscheinens, publizierte.
Diese Arbeit wird beweisen, dass das im besagten Artikel diskutierte Konzept des Vergnügens die lyrische Suche der Dichtung Brockes‘ nach der Entsprechung zwischen einer natürlichen, göttlichen und weltlichen Ordnung reflektiert. Sie offenbart unter ihrem zweiten Gliederungspunkt, inwiefern diese Suche in Form der Vergnügung zeitgleich als ein Ausdruck weltlicher Tugendhaftigkeit und Weg zu „ewiger Glückseligkeit“ zu betrachten ist.
Im folgenden Schritt ist unter dem dritten Punkt und unter Berücksichtigung der Arbeit von Wolfram Mauser zu belegen, wie sich aus dem Konzept des Vergnügens eine eigenständige Existenzberechtigung des Bürgertums formuliert. Diese, so wird gezeigt, folgt der Gotteserkenntnis, ohne dabei mit der Progressivität der sozialhistorischen Verhältnisse im bürgerlich prosperierenden Hamburg des angehenden 18. Jahrhunderts in Konflikt zu geraten.
Unter dem vierten Punkt der vorliegenden Arbeit werden die bis dahin getroffenen Erkenntnisse an ausgewählten Textstellen von Brockes Gedicht „Die Welt“ nachvollzogen und überprüft. Sie schließt mit einer kritischen Betrachtung ihres Erkenntnisgewinns und einem Umriss möglichen weiteren Forschungspotentials ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Konzept des Vergnügens im 85. Artikel Brockes' und Richeys Moralischer Wochenschrift „Der Patriot“
- Zur Bedeutung des Konzepts und dessen Einfluss auf das lyrische Verständnis Brockes'
- Widerhall des Konzepts des Vergnügens in Brockes' Gedicht „Die Welt“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept des Vergnügens, wie es im 85. Artikel der Hamburger Moralischen Wochenzeitschrift „Der Patriot“ von Barthold Heinrich Brockes und Michael Richey diskutiert wird. Die Arbeit zeigt auf, wie dieses Konzept die lyrische Suche Brockes' nach einer natürlichen, göttlichen und weltlichen Ordnung reflektiert und wie Vergnügung als Ausdruck weltlicher Tugendhaftigkeit und Weg zu „ewiger Glückseligkeit“ verstanden werden kann. Darüber hinaus wird untersucht, wie sich aus diesem Konzept eine eigenständige Existenzberechtigung des Bürgertums formuliert, die mit der Gotteserkenntnis in Einklang steht und gleichzeitig die progressiven sozialhistorischen Verhältnisse des 18. Jahrhunderts widerspiegelt.
- Das Konzept des Vergnügens in der „Hamburger Moralischen Wochenzeitschrift“
- Die lyrische Suche Brockes' nach einer Ordnung
- Vergnügung als Ausdruck von Tugendhaftigkeit und Glückseligkeit
- Die Existenzberechtigung des Bürgertums
- Der Einfluss des Vergnügenskonzepts auf Brockes' Gedicht „Die Welt“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit argumentiert, dass Brockes' Lyrik nicht nur durch eine Verschränkung von Gott und Natur, sondern auch durch das Konzept des Vergnügens geprägt ist, wie es im 85. Artikel der „Hamburger Moralischen Wochenzeitschrift“ dargestellt wird.
Zum Konzept des Vergnügens im 85. Artikel Brockes' und Richeys Moralischer Wochenschrift „Der Patriot“
Dieser Abschnitt analysiert den 85. Artikel der „Hamburger Moralischen Wochenzeitschrift“, der eine Unterscheidung zwischen wahrem und eingebildetem Vergnügen trifft. Der Text argumentiert, dass das wahre Vergnügen aus der Gotteserkenntnis und der sinnvollen Nutzung der vom Menschen gegebenen Kräfte entsteht.
Zur Bedeutung des Konzepts und dessen Einfluss auf das lyrische Verständnis Brockes'
Dieser Abschnitt untersucht die Bedeutung des Vergnügenskonzepts für Brockes' Lyrik und zeigt auf, wie es die Suche des Dichters nach einer Ordnung widerspiegelt.
Widerhall des Konzepts des Vergnügens in Brockes' Gedicht „Die Welt“
Dieser Abschnitt untersucht, wie das Vergnügenskonzept in ausgewählten Textstellen von Brockes' Gedicht „Die Welt“ zum Ausdruck kommt.
Schlüsselwörter
Vergnügung, Brockes, „Der Patriot“, Hamburger Moralische Wochenzeitschrift, Lyrik, Gotteserkenntnis, Natur, Ordnung, Tugendhaftigkeit, Glückseligkeit, Bürgertum, „Die Welt“
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema des 85. Artikels der Zeitschrift „Der Patriot“?
Der Artikel diskutiert das Konzept des Vergnügens und unterscheidet zwischen wahrem und eingebildetem Vergnügen.
Wie definiert Brockes „wahres Vergnügen“?
Wahres Vergnügen entsteht aus der Gotteserkenntnis und der sinnvollen Nutzung der menschlichen Kräfte in Einklang mit der Natur.
Welches Gedicht von Brockes wird zur Überprüfung der Thesen herangezogen?
Die Erkenntnisse werden am Gedicht „Die Welt“ nachvollzogen und überprüft.
Welche Rolle spielt das Bürgertum in Brockes' Konzept?
Das Konzept des Vergnügens formuliert eine eigenständige Existenzberechtigung des Bürgertums, die Tugendhaftigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg verbindet.
Was ist das Ziel von Brockes' lyrischer Suche?
Er sucht nach der Entsprechung zwischen einer natürlichen, göttlichen und weltlichen Ordnung.
Wie wird Vergnügung im Kontext der Aufklärung gesehen?
Sie wird als Ausdruck weltlicher Tugendhaftigkeit und als legitimer Weg zur „ewigen Glückseligkeit“ betrachtet.
- Arbeit zitieren
- Michael Schwark (Autor:in), 2010, Zum Konzept des Vergnügens und dessen Bedeutung für das Verständnis Brockes’ Lyrik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158412