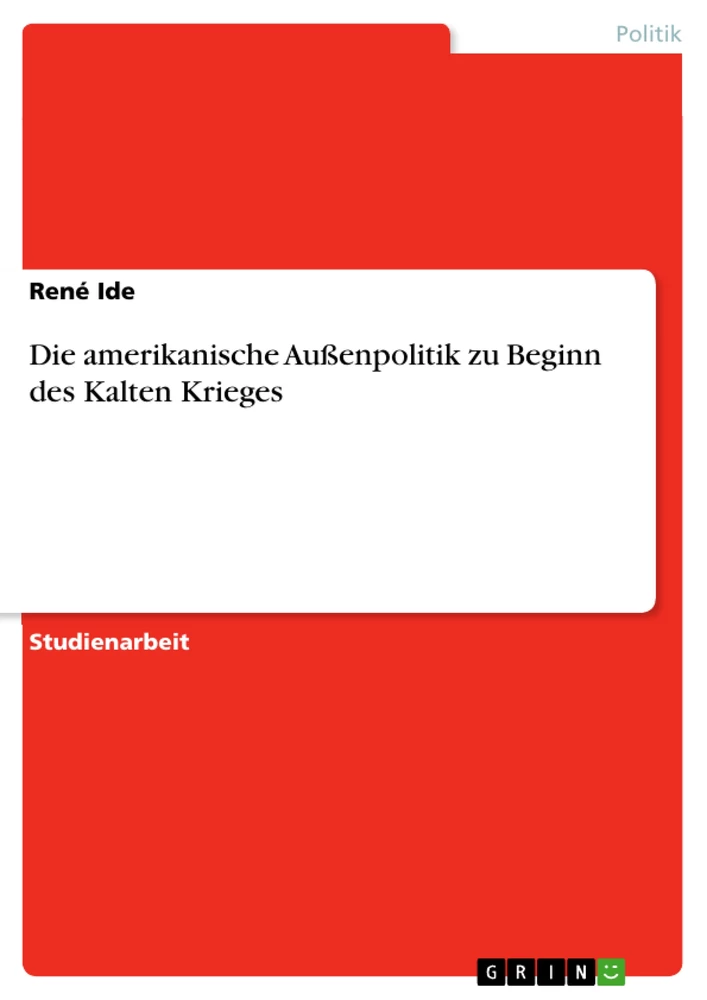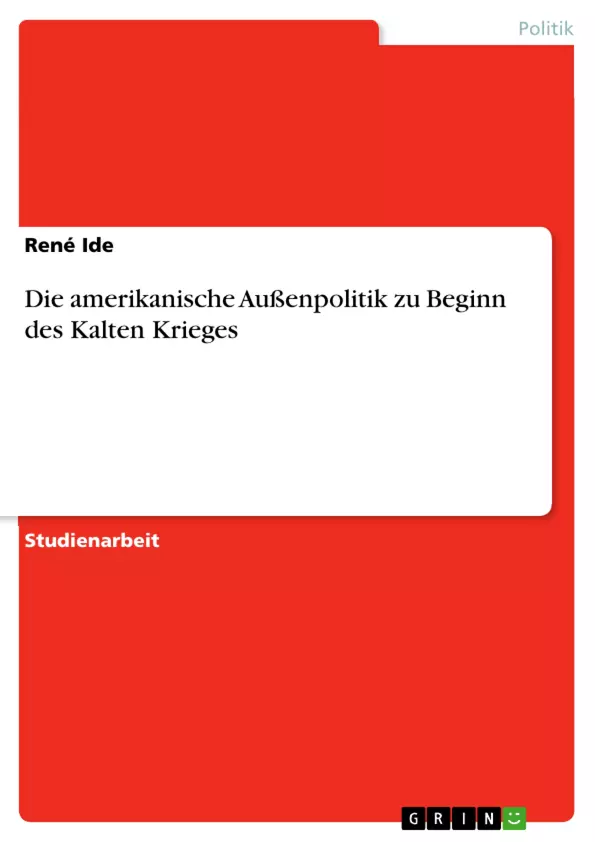Das 20. Jahrhundert, von vielen Leuten als das „Jahrhundert der Kriege“ bezeichnet, war für die USA der Schritt aus der Isolations- bzw. Neutralitätspolitik zum Aufstieg zur Supermacht. Das noch sehr junge Land, das erst 1776 seine Unabhängigkeit erlangte verknüpfte seine außenpolitische Zielsetzung und Vorgehensweise unmittelbar mit denen der Innenpolitik. Diese sind vor allem das Streben nach Sicherheit, sowie die Stärkung der eigenen Wirtschaft. Dies bedeutet, dass die Dominanz der USA als Supermacht auf militärischer und wirtschaftlicher Stärke beruht. Die Strategien der Außenpolitik nach 1945 spiegeln das wieder.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Außenpolitik der USA im 20. Jahrhundert. Der Schwerpunkt wird dabei auf den Beginn des Kalten Krieges gelegt. Betrachtet werden die außenpolitischen Strategien von Containment zu Roll Back. Ein besonderer Blick richtet sich dabei auf den Koreakrieg, welcher den ersten großen Konflikt zwischen den beiden Großmächten, der USA und der Sowjetunion, darstellt.
Um die von Traditionen der Gründerväter geprägte Außenpolitik der USA verstehen zu können ist ein Rückblick auf die Entwicklung des relativ jungen Staates von Nöten. Hierbei werden im ersten Teil der Arbeit Einschnitte für die außenpolitische Entwicklung und deren Wirkung betrachtet. Weiterhin wird hier dabei die Rolle der Präsidenten, die eine herausragende Rolle für die Außenpolitik Amerikas spielen, untersucht.
Das zweite Kapitel der Arbeit befasst sich mit der Entstehung der Containment Politik unter Präsident Truman. Hierbei wird der Unterschied zwischen dem idealistischen Denken Roosevelts und der Realität mit der sich Truman konfrontiert sah, deutlich gemacht. Ausführlich wird dabei auf die Nachkriegsordnung und das Kräfteverhältnis der beiden Großmächte USA und Sowjetunion eingegangen.
Das dritte Kapitel widmet sich der Betrachtung des ersten großen militärischen Konflikts beider Großmächte, dem Koreakrieg. Dabei wird zunächst die politische Situation Koreas, welche der Nachkriegssituation in Deutschland durchaus ähnlich war, herausgearbeitet. Danach wird auf den Koreakrieg an sich eingegangen. Dabei werden weniger der militärische Verlauf, als vielmehr die außenpolitischen Auswirkungen sowie die innenpolitischen Konflikte im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen. Im Anschluss daran werden die Folgen, vor allem die Politik der Eisenhower-Administration und der Wechsel von der Containment Politik zur roll-back Politik herausgearbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Fragestellung
- Forschungsstand
- Die Außenpolitik der USA bis 1945: Vom Isolationismus zur Grundlegung der amerikanischen Weltmacht
- Die Außenpolitik der USA bis zum Ersten Weltkrieg
- Der Erste Weltkrieg und die Veränderungen der US-Außenpolitik in dessen Folge
- Der Beginn des Kalten Krieges: Die Entwicklung der Containment policy und die Verschärfung des Kalten Krieges
- Der Koreakrieg: der erste militärische Konflikt im Kalten Krieg
- Die politische Situation Koreas
- Die Reaktion der USA auf den Einmarsch der nordkoreanischen Truppen
- Folgen des Koreakrieges und der Wandel in der Außenpolitik
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die amerikanische Außenpolitik im 20. Jahrhundert, mit besonderem Fokus auf den Beginn des Kalten Krieges. Dabei wird die Entwicklung von der Containment- zur Roll-Back-Strategie analysiert, wobei der Koreakrieg als erster großer militärischer Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion im Vordergrund steht.
- Die Entwicklung der amerikanischen Außenpolitik vom Isolationismus zur Supermacht
- Die Entstehung der Containment-Politik unter Präsident Truman
- Der Koreakrieg als Beispiel für den ersten großen Konflikt zwischen den beiden Großmächten
- Die Auswirkungen des Koreakrieges auf die amerikanische Außenpolitik
- Der Wandel von der Containment- zur Roll-Back-Strategie
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel behandelt die außenpolitische Entwicklung der USA vom Gründungsmythos bis zum Ersten Weltkrieg, mit besonderem Augenmerk auf die Rolle der Präsidenten und die Monroe-Doktrin.
- Das zweite Kapitel untersucht die Entstehung der Containment-Politik unter Präsident Truman, die sich aus der veränderten Nachkriegsordnung und dem neuen Kräfteverhältnis zwischen den USA und der Sowjetunion entwickelte.
- Das dritte Kapitel analysiert den Koreakrieg, wobei die politische Situation Koreas, die Reaktion der USA auf den Einmarsch der nordkoreanischen Truppen sowie die Folgen des Konflikts für die amerikanische Außenpolitik im Mittelpunkt stehen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: amerikanische Außenpolitik, Containment, Roll-Back, Kalter Krieg, Koreakrieg, Isolationismus, Supermacht, Monroe-Doktrin, Präsident Truman, Koreakrieg, Eisenhower-Administration, Nachkriegsordnung.
Häufig gestellte Fragen
Wie wandelte sich die US-Außenpolitik im 20. Jahrhundert?
Die USA entwickelten sich von einer Politik des Isolationismus und der Neutralität hin zum Aufstieg als globale Supermacht nach 1945.
Was ist der Unterschied zwischen Containment- und Roll-Back-Politik?
Containment (Eindämmung) zielte unter Präsident Truman darauf ab, die Ausbreitung des Kommunismus zu verhindern, während Roll-Back (unter Eisenhower) das Ziel verfolgte, den kommunistischen Einfluss aktiv zurückzudrängen.
Welche Rolle spielt der Koreakrieg in dieser Analyse?
Der Koreakrieg wird als der erste große militärische Konflikt des Kalten Krieges zwischen den USA und der Sowjetunion sowie als Wendepunkt in der US-Außenpolitik untersucht.
Welche Bedeutung hat die Monroe-Doktrin für die US-Außenpolitik?
Sie ist Teil des historischen Rückblicks auf die Entwicklung des Staates und markiert eine frühe Phase der Abgrenzung und Einflussnahme in der westlichen Hemisphäre.
Wie unterschieden sich die Ansätze von Roosevelt und Truman?
Die Arbeit kontrastiert das idealistische Denken Roosevelts mit der harten Realität der Nachkriegsordnung, mit der Truman konfrontiert war.
Auf welchen Grundlagen beruht die Dominanz der USA als Supermacht?
Die Dominanz beruht auf einer Kombination aus militärischer Stärke und wirtschaftlicher Macht, die unmittelbar mit innenpolitischen Zielen wie Sicherheit verknüpft ist.
- Quote paper
- René Ide (Author), 2009, Die amerikanische Außenpolitik zu Beginn des Kalten Krieges, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158416