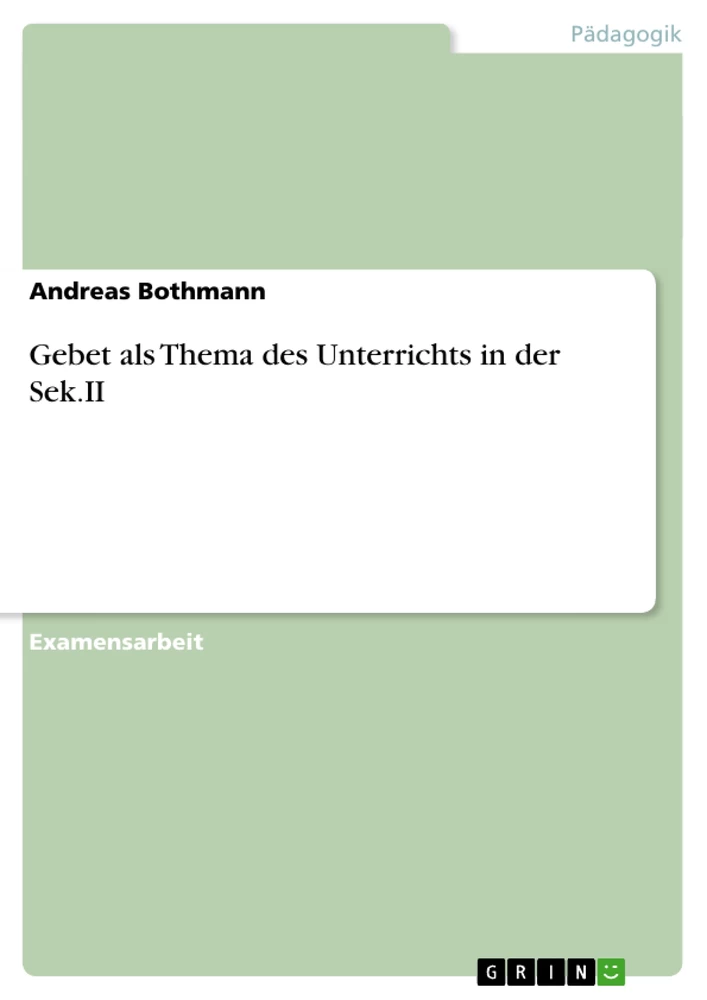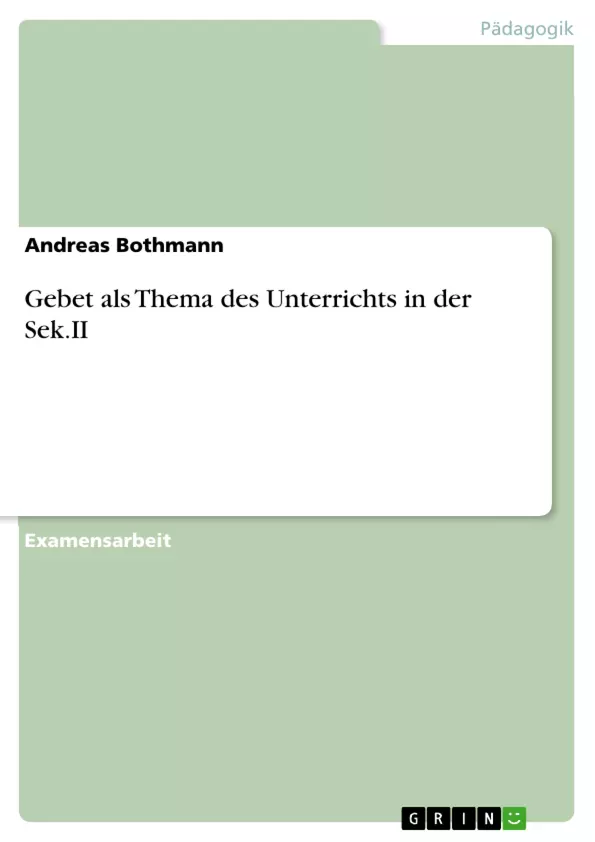Das Gebet ist ein zentraler Akt der Glaubenspraxis, in dem der Beter seinen Gott anspricht. Das bedeutet: der Beter hat einen Glauben und er hat eine Gottesvorstellung. Das Gebet kann ebenfalls ein sehr persönlicher Akt sein, der für den Betenden in seiner Suche nach Antworten auf existentielle Fragen entscheidende Bedeutung hat. Die hier vorliegende Arbeit will Wege aufzeigen, wie das Gebet als Thema des Unterricht an einer gymnasialen Oberstufe behandelt werden kann. Im Zuge der Vorbereitungen fiel mir auf, dass es reichlich Gebetsliteratur gibt, die sich vor allem aus Gebetsbüchern, Gebetsanleitungen und Sammlungen erbaulicher Texte für schwierige Lebenslagen zusammenstellt. Wenn man hingegen die theologische oder gar die religionspädagogische Fachliteratur konsultiert, hat es fast den Anschein, als sei vor allem letztere darum bemüht, das Thema Gebet im Unterricht geflissentlich weiträumig zu umfahren.
Das ist insofern bedauerlich, da sich ja gerade Schülerinnen und Schüler in einer Lebensphase befinden, in der existentielle Fragen hinsichtlich der Lebensdeutung im Bezug auf jugendliche Wirklichkeitswahrnehmung nicht selten sind. Auch beim Blick in den Lehrplan muss man schon sehr genau suchen, wo das Gebet seinen Platz finden könnte.
Der Grund für diesen Mangel an literarischer Präsenz liegt möglicherweise darin, dass heute einfach nicht mehr gebetet wird und dadurch das Gebet nicht mehr in seiner für den Menschen so bedeutenden Rolle erkannt wird. Man kann seit einiger Zeit unter Jugendlichen einen deutlichen Rückgang an Religiosität beobachten, der sich aber vor allem auf den Bereich institutioneller Religionspraxis erstreckt.
Für den Umgang mit dem Thema Gebet im Unterricht scheint es mir daher wichtig, auch danach zu fragen, wo jugendliche Religiosität heute noch zu finden ist, und wie sie sich äußert. Da die Grundbedürfnisse des Menschen auch in einer sich stetig verändernden Welt gleich bleiben, liegt es nahe, zu erfragen, auf welchen Wegen Jugendliche heute ihre Probleme zur Sprache bringen.
Die vorliegende Arbeit will dies anhand populärer Texte deutschsprachiger Musikinterpreten tun, die für Jugendliche als Idole gefeiert und verehrt werden.
Wie zeigt sich die jugendliche Wirklichkeit und welchen Einfluss hat das auf jugendliche Religiosität? Welche Ausdrucksformen finden sich heutzutage im Repertoire jugendlicher Sprache und wie können Lehrkräfte darin ein zum Gebet möglicherweise analoges Sprechen erkennen?
Inhaltsverzeichnis
- Das Gebet als Thema im Unterricht der Sekundarstufe II
- Systematische Betrachtung und Einordnung
- Blick in den Lehrplan Evangelische Religion für den gymnasialen Bildungsgang (G8)
- Lernschwerpunkt I: Individuelle Erfahrung
- Lernschwerpunkt II: Biblisch-christliche Tradition
- Lernschwerpunkt III: Geschichte und Gegenwart Christliches Leben in
- Lernschwerpunkt IV: Ethik
- Lernschwerpunkt V: Religion und Weltdeutung
- Stellung des Gebetes innerhalb der Lernschwerpunkte
- Das Gebet als Thema des Religionsunterrichts – Versuch einer Einordnung
- Das Thementableau der Grundkurse
- Das Thementableau der Leistungskurse
- Schulstufenzuweisung und Abgrenzung
- Themenverankerung in der 12G.2
- Grund- oder Leistungskurs
- Religion und das Gebet als religiöse Praxis – eine Bildungsaufgabe
- Ein allgemeines Bildungsgut
- Sozialisationsprobleme Jugendlicher
- Methodische Konsequenzen für den Unterricht - Chancen der partiellen Monoedukation
- Aktuelle Bezüge zum Thema Gebet im Unterricht
- Jugendliche und ihre Religiosität
- Die Bedeutung des jugendlichen Sprachcodes
- Wie äußert sich Religiosität bei Jugendlichen?
- Stellung der Religion in der Gesellschaft und die Konsequenzen für den Unterricht
- Staat und Gesellschaft
- Der pluralistische Gesellschaftsaspekt
- Der säkulare Gesellschaftsaspekt
- Einbeziehung der Religionskritik
- Gebete und Lieder der Popkultur als Ausdruck von Lebensfragen und Lebensdeutung
- Einleitung
- Die Sprache des Gebetes
- Exemplarische Texte
- Das 18-Bitten-Gebet
- Das Vaterunser
- Die 1. Sure Al Fatiha
- Strukturelle Merkmale des Gebetes
- Wer spricht?
- Was wird zur Sprache gebracht?
- Mit wem redet der Betende?
- Die Sprache der Lieder der Popkultur
- Menschliche Existenz und Sprache
- Die Behandlung des Themas Gebet im Unterricht
- Hinführung
- Schritt 1: Vergleich eines Liedes mit einem Gebet
- Schritt 2: Vergleich eines jüdischen, christlichen und islamischen Gebetes
- Schritt 3: Ein neuzeitliches Gebet im Vergleich mit einem profanen Text
- Schritt 4: Schweigen und Stille - Meditation
- Erarbeitung von Konzepten und Methoden zur Integration des Gebets in den Religionsunterricht
- Analyse des jugendlichen Sprachcodes und seiner Verbindung zu religiösen Ausdrucksformen
- Vergleich von Gebet und Popkulturtexten im Hinblick auf Lebensfragen und Lebensdeutung
- Entwicklung von Unterrichtssequenzen, die die Integration von Gebeten in den Unterricht ermöglichen
- Reflexion des Einflusses von Gesellschaft und Religion auf das Gebet und seine Relevanz für Jugendliche
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht die Relevanz und Einsetzbarkeit des Gebets als Thema im Religionsunterricht der gymnasialen Oberstufe. Der Fokus liegt dabei auf der Auseinandersetzung mit jugendlicher Religiosität und dem Vergleich von Gebetsformen mit sprachlichen Ausdrucksformen der Popkultur.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer systematischen Betrachtung des Gebets als Thema im Religionsunterricht der Sekundarstufe II und einer Einordnung in den Lehrplan Evangelische Religion. Es wird aufgezeigt, wie das Gebet als Bildungsaufgabe fungieren kann und welche methodischen Konsequenzen sich daraus für den Unterricht ergeben. Anschließend werden verschiedene Aspekte der jugendlichen Religiosität beleuchtet, wobei der Fokus auf dem Einfluss des jugendlichen Sprachcodes liegt.
In den folgenden Kapiteln werden die Stellung der Religion in der Gesellschaft und die Konsequenzen für den Unterricht diskutiert. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Analyse von Gebete und Liedern der Popkultur als Ausdruck von Lebensfragen und Lebensdeutung. Die Arbeit zeigt strukturelle Merkmale des Gebetes auf und untersucht Parallelen zwischen der Sprache des Gebetes und der Sprache von Popkulturtexten.
Abschließend werden Möglichkeiten der Behandlung des Themas Gebet im Unterricht aufgezeigt und verschiedene Schritte zur Umsetzung in der Praxis vorgestellt. Die Arbeit bietet einen praxisorientierten Leitfaden zur Integration des Themas Gebet in den Religionsunterricht der Sekundarstufe II.
Schlüsselwörter
Religionsunterricht, Gebet, Jugend, Religiosität, Popkultur, Sprachcode, Lebensdeutung, Lebensfragen, Unterrichtssequenzen, Methodische Konsequenzen, Sozialisation, Staat, Gesellschaft, Pluralismus, Säkularisierung, Religionskritik, Bildungsaufgabe.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann das Thema Gebet Jugendlichen heute vermittelt werden?
Ein moderner Ansatz ist der Vergleich von Gebeten mit Texten aus der Popkultur (Musik), die ähnliche existentielle Lebensfragen und Hoffnungen ausdrücken.
Welche Rolle spielt das Gebet im Lehrplan für die Oberstufe?
Das Gebet findet sich in verschiedenen Lernschwerpunkten wie "Individuelle Erfahrung", "Biblisch-christliche Tradition" oder "Religion und Weltdeutung".
Gibt es Parallelen zwischen Pop-Songs und Gebeten?
Ja, beide Ausdrucksformen behandeln oft Themen wie Suche nach Sinn, Klage, Dank oder die Bitte um Hilfe in schwierigen Lebenslagen.
Werden auch nicht-christliche Gebete im Unterricht behandelt?
Die Arbeit schlägt den Vergleich zwischen jüdischen, christlichen (Vaterunser) und islamischen Gebeten (Al-Fatiha) vor.
Warum nimmt die Religiosität bei Jugendlichen ab?
Beobachtet wird vor allem ein Rückgang in der institutionellen Religionspraxis, während existentielle Fragen und individuelle Religiosität oft in neuen Formen (z. B. Musik) weiterbestehen.
- Arbeit zitieren
- Andreas Bothmann (Autor:in), 2009, Gebet als Thema des Unterrichts in der Sek.II, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158550