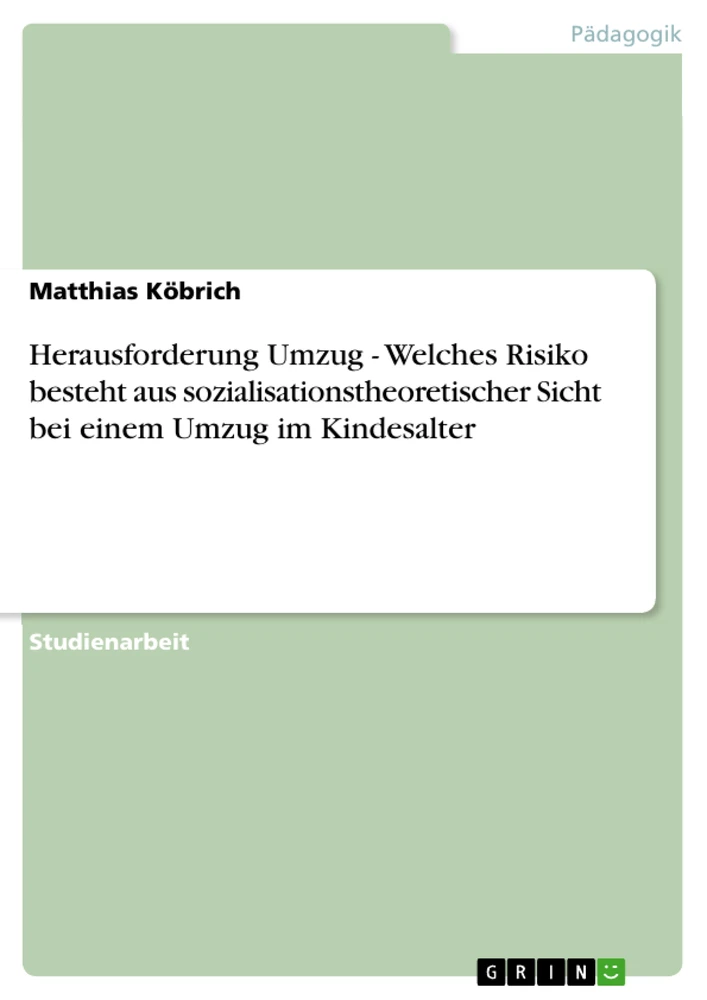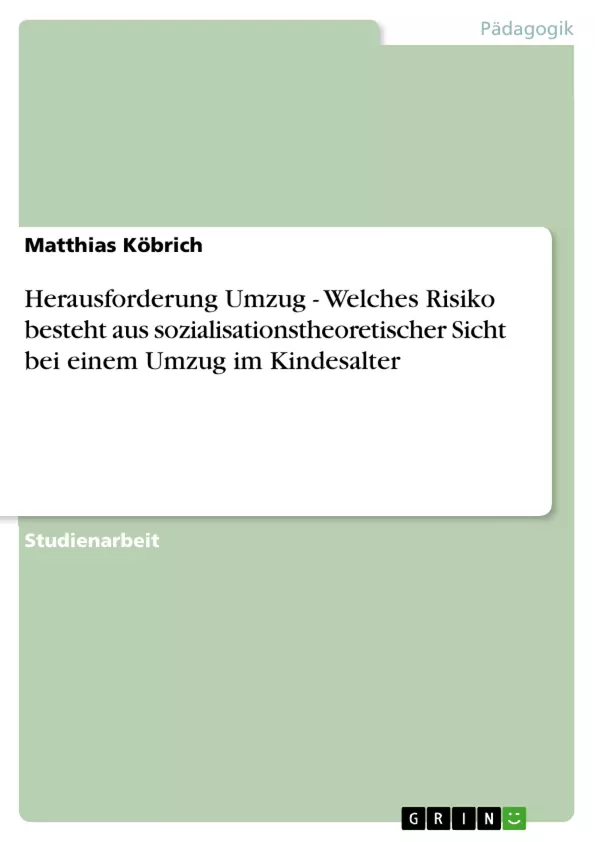Inhaltsverzeichnis
A. Einleitung ....................................................3
B. Hauptteil .....................................................4
1. Die Bedeutung des sozialen Umfelds im Kindesalter ........4
2. Soziale Kompetenzen ......................................6
3. Soziales Kapital .........................................7
4. Konkrete Risiken bei einem Umzug im Kindesalter .........10
4.1. Auswirkungen auf die schulischen Leistungen.10
4.2. Auswirkungen auf die Gesundheit ............11
4.3. Fallbeispiel ...............................11
C. Fazit ........................................................12
Literaturverzeichnis .................................................................14
Abbildungsverzeichnis .................................................................15
Der Terminus „soziales Kapital“ ist ein zentraler Begriff in Pierre Bourdieus Sozialisationstheorie. Bourdieu hat durch diese Theorie deutlich gemacht, dass das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in einem sozialen Umfeld weit mehr von der gesellschaftlich ungleichen Verteilung verschiedener Kapitalformen1 abhängt, als vom erzieherischen Handeln von Pädagoginnen und Pädagogen.2 Deswegen ist es wichtig, in Zusammenhang mit dem Sozialisationsprozess eines Kindes, und speziell mit dem Umzug in der Kindheit, zumindest auf eine Form des Kapitals, nämlich die des sozialen Kapitals, einzugehen.
„Während – bei gleichzeitiger Kontrolle des sozioökonomischen Status und des sozialen Kapitals innerhalb der Familie – durchschnittlich knapp 12% der Kinder, die seit der 5. Klasse nicht umgezogen sind, die Schule vorzeitig abbrechen, erhöht sich dieser Anteil bei jenen Kindern, die von einem Umzug in diesem Zeitraum berichten, auf 17%, bei zwei Umzügen auf 23%.“22
Der anhand von sozialen Kompetenzen, sozialem Kapital und den konkreten Risiken dargelegte negative Einfluss, den ein Umzug auf die Persönlichkeitsentwicklung und den Sozialisationsprozess haben kann, zeigt deutlich auf, wie risikoreich ein Wohnortwechsel sein kann. Sollte kein angemessenes Konfliktbewältigungsmuster vorliegen, kann dies erhebliche Folgen für die sozialräumliche Orientierung (z.B. soziale Kontakte knüpfen, Anpassungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Eigenverantwortung) des Kindes bedeuten.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Hauptteil
- 1. Die Bedeutung des sozialen Umfelds im Kindesalter
- 2. Soziale Kompetenzen
- 3. Soziales Kapital
- 4. Konkrete Risiken bei einem Umzug im Kindesalter.
- 4.1. Auswirkungen auf die schulischen Leistungen
- 4.2. Auswirkungen auf die Gesundheit
- 4.3. Fallbeispiel
- C. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Risiken, die ein Umzug im Kindesalter aus sozialisationstheoretischer Sicht mit sich bringt. Sie untersucht die Bedeutung des sozialen Umfelds, soziale Kompetenzen und soziales Kapital in Bezug auf die Auswirkungen eines Umzugs auf die Entwicklung des Kindes.
- Die Bedeutung des sozialen Umfelds für die kindliche Entwicklung
- Die Rolle von sozialen Kompetenzen im Sozialisationsprozess
- Das Konzept des sozialen Kapitals nach Pierre Bourdieu
- Die konkreten Risiken von Umzügen im Kindesalter, insbesondere Auswirkungen auf die schulischen Leistungen und die Gesundheit
- Ein Fallbeispiel zur Veranschaulichung der Herausforderungen im Zusammenhang mit einem Umzug
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik des Umzugs im Kindesalter als potenzielles Problem für die Orientierung und Sozialisation dar. Sie erläutert, dass der Begriff „Umzug“ in der Arbeit im Kontext des Wechsels des sozialen Umfelds betrachtet wird und die Arbeit sich auf die Risiken von Umzügen fokussiert.
Der Hauptteil behandelt zunächst die Bedeutung des sozialen Umfelds für die Entwicklung von Kindern. Dabei wird die Sozialisation als ein wechselseitiges Zusammenspiel von Anlage und Umwelt betrachtet, wobei das soziale Umfeld als Schauplatz der Sozialisation fungiert. Der Text geht dann auf soziale Kompetenzen und soziales Kapital ein, wobei er das Konzept des sozialen Kapitals nach Pierre Bourdieu als zentrale Grundlage für die Analyse des Sozialisationsprozesses heranzieht. Im weiteren Verlauf werden die konkreten Risiken von Umzügen im Kindesalter beleuchtet, wobei sich die Arbeit auf Auswirkungen auf die schulischen Leistungen und die Gesundheit konzentriert. Abschließend wird ein Fallbeispiel präsentiert, um die Herausforderungen im Zusammenhang mit einem Umzug zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Sozialisation, soziales Umfeld, soziale Kompetenzen, soziales Kapital, Pierre Bourdieu, Umzug, Kindesalter, Risiken, schulische Leistungen, Gesundheit, Fallbeispiel.
Häufig gestellte Fragen
Welche Risiken birgt ein Umzug für Kinder?
Ein Umzug kann negative Einflüsse auf die Persönlichkeitsentwicklung, die schulischen Leistungen und die Gesundheit haben, insbesondere wenn kein angemessenes Konfliktbewältigungsmuster vorliegt.
Was versteht Pierre Bourdieu unter „sozialem Kapital“?
Soziales Kapital ist eine Form von Ressourcen, die aus sozialen Beziehungen und Netzwerken resultieren. Ein Umzug führt oft zum Verlust dieses Kapitals, da das soziale Umfeld wechselt.
Wie wirkt sich ein Wohnortwechsel auf schulische Leistungen aus?
Statistiken zeigen, dass Kinder, die umziehen, ein höheres Risiko für einen vorzeitigen Schulabbruch haben. Bei zwei Umzügen steigt der Anteil der Abbrecher auf bis zu 23%.
Was ist die Bedeutung des sozialen Umfelds im Kindesalter?
Das soziale Umfeld fungiert als Schauplatz der Sozialisation. Es beeinflusst die Entwicklung sozialer Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit und Selbstvertrauen maßgeblich.
Was sind die Folgen fehlender sozialräumlicher Orientierung nach einem Umzug?
Kinder können Schwierigkeiten haben, neue Kontakte zu knüpfen, und Probleme mit der Anpassungsfähigkeit, Kritikfähigkeit oder Eigenverantwortung entwickeln.
- Quote paper
- Matthias Köbrich (Author), 2010, Herausforderung Umzug - Welches Risiko besteht aus sozialisationstheoretischer Sicht bei einem Umzug im Kindesalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158621