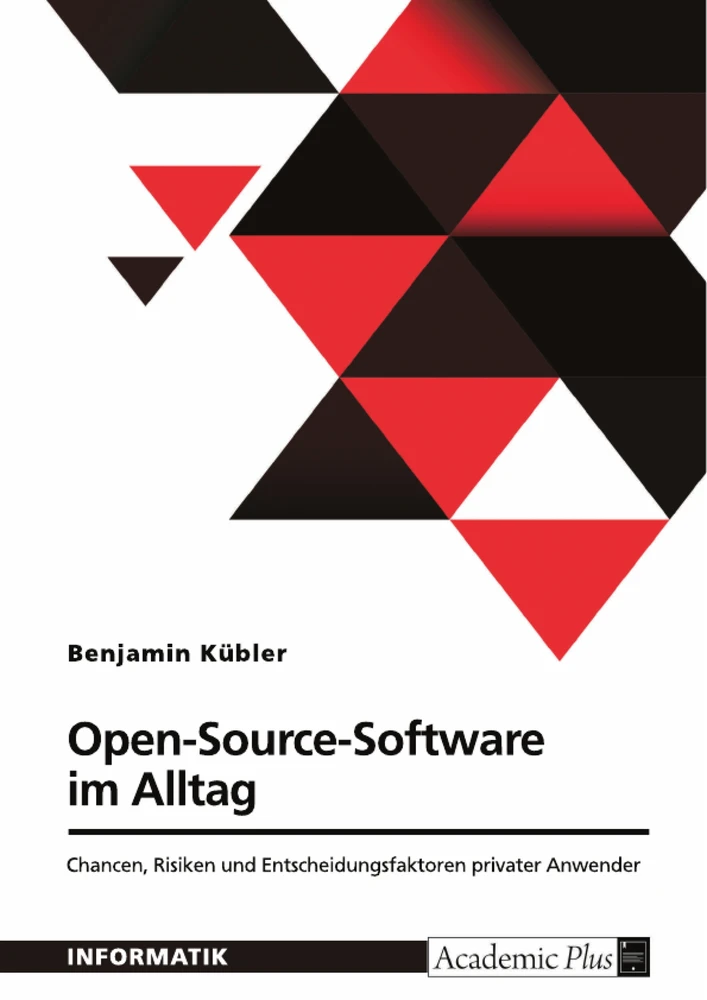Die vorliegende Arbeit untersucht die subjektiv wahrgenommenen Chancen und Risiken von Open-Source-Software (OSS) aus der Perspektive privater Anwender sowie deren Beweg-gründe, sich für oder gegen die Nutzung von OSS zu entscheiden. In einer umfassenden theoretischen Analyse werden die Begriffe proprietäre Software, OSS freie Software gegeneinander abgegrenzt und die verschiedenen Lizenzmodelle, unter denen OSS veröffentlicht werden kann, und deren Eigenschaften vorgestellt. Zudem werden konkrete Beispiele für OSS wie Linux, Audacity und LibreOffice diskutiert, um die Vielfalt und praktische Relevanz von OSS für private Anwender zu illustrieren. Der empirische Teil der Arbeit stützt sich auf eine standardisierte Umfrage, die gemäß der Theorie des geplanten Verhaltens nach Icek Ajzen gestaltet wurde. Deren Ergebnisse werden mittels multipler Regressionsanalyse ausgewertet und interpretiert. Die Ergebnisse zeigen, dass besonders die wahrgenommenen Vorteile von OSS aus-schlaggebend für die Nutzungsentscheidung sind. Zudem spielt der Einfluss des sozialen Umfelds eine große Rolle. Technische Komplexität wird hingegen kaum als Hindernis wahrgenommen. Auf Basis dieser Erkenntnisse werden Handlungsempfehlungen für die weitere Forschung sowie die weitere Förderung der Nutzung von OSS gegeben. Die Arbeit möchte damit einen Beitrag zur Erforschung der Nutzungsdynamiken von OSS im privaten Bereich leisten und bietet praxisnahe Implikationen für Entwickler, Communitys und Forschungstreibende liefern.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Motivation und Problemstellung
- 1.2 Zielvorstellung und Forschungsfrage
- 1.3 Aufbau
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Open Source
- 2.1.1 Definition
- 2.1.2 Lizenzmodelle
- 2.1.3 Stellenwert und Bedeutung
- 2.1.4 Abgrenzung: Open-Source-Software, freie Software und proprietäre Software
- 2.1.5 Aktueller Forschungsstand
- 2.1.6 Vor- und Nachteile von Open-Source-Software im Vergleich zu proprietären Produkten
- 2.2 Beispiele für OSS
- 2.2.1 Linux
- 2.2.2 Android
- 2.2.3 Audacity
- 2.2.4 Arduino
- 2.2.5 7-Zip
- 2.2.6 Mozilla Firefox
- 2.2.7 GIMP
- 2.2.8 LibreOffice
- 2.3 Theorie des geplanten Verhaltens
- 3 Methodik
- 3.1 Forschungsdesign
- 3.2 Hypothesenentwicklung
- 3.3 Fragebogen
- 3.4 Datenerhebung und Zielgruppe
- 4 Datenauswertung
- 4.1 Vorgehensweise
- 4.2 Demografische Analyse
- 4.3 Transformation der Likert-Skalen
- 4.4 Darstellung der Umfrageergebnisse
- 4.5 Intention und tatsächliche Nutzung von OSS
- 4.6 Statistische Auswertung der Ergebnisse
- 4.6.1 Reliabilitätsanalyse der Skalen
- 4.6.2 Regressionsanalyse
- 4.6.3 Korrelationsanalyse nach Pearson
- 4.7 Überprüfung der Hypothesen
- 5 Interpretation der Ergebnisse
- 5.1 Implikationen für die Forschung
- 5.2 Implikationen für die Praxis
- 5.3 Limitationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die subjektiv wahrgenommenen Chancen und Risiken von Open-Source-Software (OSS) aus der Sicht privater Anwender. Ziel ist es, die Entscheidungsgründe für oder gegen die Nutzung von OSS zu erforschen und Handlungsempfehlungen für Forschung und Praxis abzuleiten. Die Arbeit verbindet theoretische Analysen mit empirischen Ergebnissen einer standardisierten Umfrage.
- Chancen und Risiken von Open-Source-Software aus Nutzersicht
- Einflussfaktoren auf die Nutzungsentscheidung von OSS
- Analyse verschiedener Lizenzmodelle und deren Auswirkungen
- Anwendung der Theorie des geplanten Verhaltens auf die Nutzung von OSS
- Ableitung von Handlungsempfehlungen für Entwickler, Communities und Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, beschreibt die Motivation und Problemstellung der Arbeit und formuliert die Forschungsfrage sowie die Zielsetzung. Es wird der Aufbau der Arbeit erläutert und der Kontext der Untersuchung im Bereich der Wirtschaftsinformatik dargelegt.
2 Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel bietet eine umfassende theoretische Grundlage für die empirische Untersuchung. Es definiert Open-Source-Software, erläutert verschiedene Lizenzmodelle und grenzt OSS von proprietärer Software und freier Software ab. Der aktuelle Forschungsstand wird zusammengefasst, und die Vor- und Nachteile von OSS werden im Vergleich zu proprietären Produkten diskutiert. Schließlich wird die Theorie des geplanten Verhaltens nach Icek Ajzen vorgestellt, die als theoretisches Fundament für die empirische Untersuchung dient. Konkrete Beispiele für OSS wie Linux, Audacity und LibreOffice veranschaulichen die Vielfalt und Relevanz von OSS für private Anwender.
3 Methodik: In diesem Kapitel wird die Methodik der empirischen Untersuchung detailliert beschrieben. Es wird das Forschungsdesign, die Hypothesenbildung, der Aufbau des Fragebogens sowie die Datenerhebung und die Zielgruppe der Untersuchung erläutert. Die Wahl des Forschungsdesigns und die Operationalisierung der Variablen werden begründet.
4 Datenauswertung: Dieses Kapitel präsentiert die Auswertung der erhobenen Daten. Es beschreibt das Vorgehen bei der Datenanalyse, einschließlich der demografischen Analyse, der Transformation der Likert-Skalen und der Darstellung der Umfrageergebnisse. Die statistische Auswertung mittels Regressions- und Korrelationsanalyse wird detailliert dargestellt, wobei die Ergebnisse der Reliabilitätsanalyse der Skalen ebenfalls berücksichtigt werden. Die Überprüfung der im vorherigen Kapitel formulierten Hypothesen erfolgt auf Basis dieser statistischen Auswertungen.
5 Interpretation der Ergebnisse: Dieses Kapitel interpretiert die Ergebnisse der Datenauswertung und zieht Schlussfolgerungen für die Forschung und die Praxis. Es werden die Implikationen der Ergebnisse für die Weiterentwicklung von OSS und deren Akzeptanz diskutiert. Zudem werden die Limitationen der Studie benannt und potenzielle zukünftige Forschungsfragen identifiziert.
Schlüsselwörter
Open-Source-Software, Theorie des geplanten Verhaltens, Lizenzmodelle, Nutzerakzeptanz, empirische Forschung, Regressionsanalyse, Linux, LibreOffice, Nutzen, Risiken.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Masterarbeit?
Diese Masterarbeit untersucht die subjektiv wahrgenommenen Chancen und Risiken von Open-Source-Software (OSS) aus der Sicht privater Anwender. Ziel ist es, die Entscheidungsgründe für oder gegen die Nutzung von OSS zu erforschen und Handlungsempfehlungen für Forschung und Praxis abzuleiten. Die Arbeit verbindet theoretische Analysen mit empirischen Ergebnissen einer standardisierten Umfrage.
Was sind die Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die Themenschwerpunkte sind: Chancen und Risiken von Open-Source-Software aus Nutzersicht, Einflussfaktoren auf die Nutzungsentscheidung von OSS, Analyse verschiedener Lizenzmodelle und deren Auswirkungen, Anwendung der Theorie des geplanten Verhaltens auf die Nutzung von OSS, und Ableitung von Handlungsempfehlungen für Entwickler, Communities und Forschung.
Was behandelt Kapitel 1 (Einleitung)?
Kapitel 1 führt in die Thematik ein, beschreibt die Motivation und Problemstellung der Arbeit und formuliert die Forschungsfrage sowie die Zielsetzung. Es wird der Aufbau der Arbeit erläutert und der Kontext der Untersuchung im Bereich der Wirtschaftsinformatik dargelegt.
Was sind die Schwerpunkte in Kapitel 2 (Theoretische Grundlagen)?
Kapitel 2 bietet eine umfassende theoretische Grundlage für die empirische Untersuchung. Es definiert Open-Source-Software, erläutert verschiedene Lizenzmodelle und grenzt OSS von proprietärer Software und freier Software ab. Der aktuelle Forschungsstand wird zusammengefasst, und die Vor- und Nachteile von OSS werden im Vergleich zu proprietären Produkten diskutiert. Schließlich wird die Theorie des geplanten Verhaltens nach Icek Ajzen vorgestellt. Konkrete Beispiele für OSS wie Linux, Audacity und LibreOffice werden genannt.
Was wird in Kapitel 3 (Methodik) beschrieben?
In Kapitel 3 wird die Methodik der empirischen Untersuchung detailliert beschrieben. Es werden das Forschungsdesign, die Hypothesenbildung, der Aufbau des Fragebogens sowie die Datenerhebung und die Zielgruppe der Untersuchung erläutert. Die Wahl des Forschungsdesigns und die Operationalisierung der Variablen werden begründet.
Was wird in Kapitel 4 (Datenauswertung) präsentiert?
Kapitel 4 präsentiert die Auswertung der erhobenen Daten. Es beschreibt das Vorgehen bei der Datenanalyse, einschließlich der demografischen Analyse, der Transformation der Likert-Skalen und der Darstellung der Umfrageergebnisse. Die statistische Auswertung mittels Regressions- und Korrelationsanalyse wird detailliert dargestellt, wobei die Ergebnisse der Reliabilitätsanalyse der Skalen ebenfalls berücksichtigt werden. Die Überprüfung der im vorherigen Kapitel formulierten Hypothesen erfolgt auf Basis dieser statistischen Auswertungen.
Was beinhaltet Kapitel 5 (Interpretation der Ergebnisse)?
Kapitel 5 interpretiert die Ergebnisse der Datenauswertung und zieht Schlussfolgerungen für die Forschung und die Praxis. Es werden die Implikationen der Ergebnisse für die Weiterentwicklung von OSS und deren Akzeptanz diskutiert. Zudem werden die Limitationen der Studie benannt und potenzielle zukünftige Forschungsfragen identifiziert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind: Open-Source-Software, Theorie des geplanten Verhaltens, Lizenzmodelle, Nutzerakzeptanz, empirische Forschung, Regressionsanalyse, Linux, LibreOffice, Nutzen, Risiken.
- Quote paper
- Benjamin Kübler (Author), 2025, Open-Source-Software im Alltag, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1586562