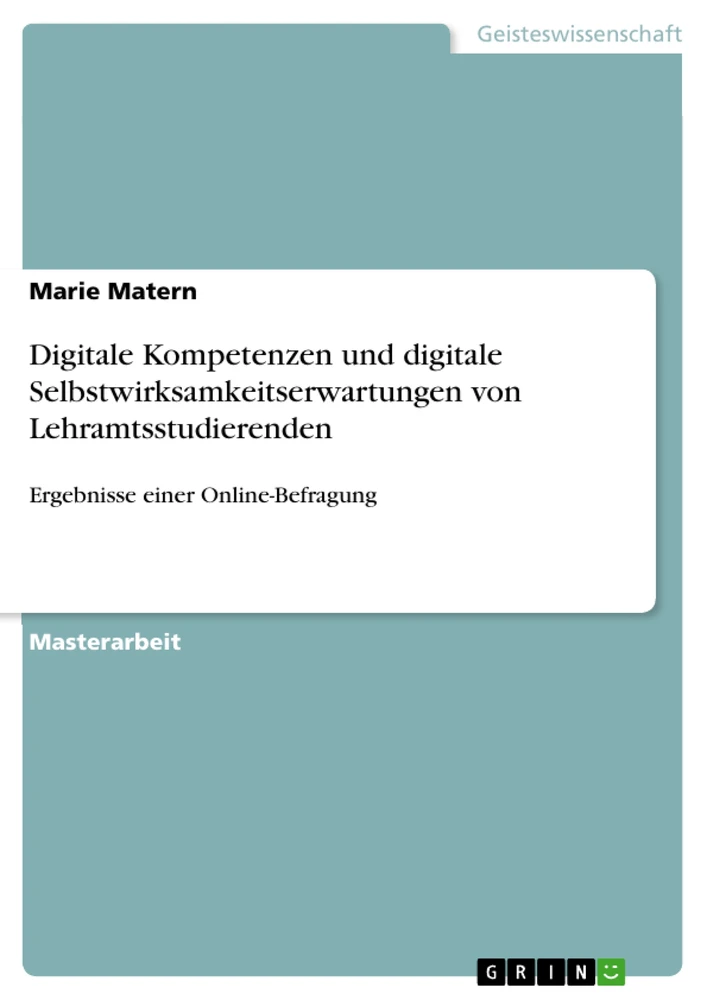Wie unterscheiden sich digitale Kompetenzen und digitale Selbstwirksamkeitserwartungen von Lehramtsstudierenden in Abhängigkeit von dem Studienabschnitt, dem Geschlecht und der Fachrichtung – und besteht eine Korrelation zwischen diesen beiden Konstrukten?
Ziel dieser Masterarbeit ist es, zu untersuchen, über welche digitalen Kompetenzen Lehramtsstudierende verfügen und wie stark ihre digitale Selbstwirksamkeit ausgeprägt ist.
Für diese Masterarbeit wurde eine quantitative Online-Befragung unter 126 Lehramtsstudierenden durchgeführt, wobei die Mehrheit der Teilnehmenden an der Freien Universität Berlin studierte. Erfasst wurden die digitalen Kompetenzen mittels der Skala zur Selbsteinschätzung digitaler Kompetenzen bei Lehramtsstudierenden von Rubach und Lazarides (2019) und die digitale Selbstwirksamkeit anhand der SWIT-Skala – Skala zur Erfassung der Selbstwirksamkeit von Lehrkräften im Hinblick auf die unterrichtliche Integration digitaler Technologien von Doll und Meyer (2021). Die Datenanalyse erfolgte mit dem Statistikprogramm JASP.
Die Ergebnisse zeigen, dass männliche Lehramtsstudierende eine signifikant höhere digitale Selbstwirksamkeitserwartung aufweisen als weibliche. Hinsichtlich der digitalen Kompetenz ergaben sich tendenziell höhere Mittelwerte bei männlichen Studierenden, Masterstudierenden sowie Studierenden mit MINT-Fächern, jedoch waren diese Unterschiede statistisch nicht signifikant. Es zeigte sich zudem eine hochsignifikante positive Korrelation zwischen digitaler Kompetenz und digitaler Selbstwirksamkeitserwartung.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Zentrale Definitionen
- 2.1.1 Digitale Kompetenz
- 2.1.2 Selbstwirksamkeitserwartung
- 2.2 Aktueller Forschungsstand und Forschungsdefizite
- 2.1 Zentrale Definitionen
- 3 Forschungsfragen und Forschungshypothesen
- 4 Methodik
- 4.1 Stichprobe
- 4.2 Forschungsdesign und Erhebungsinstrumente
- 4.2.1 Der Fragebogen zur Selbsteinschätzung digitaler Kompetenzen bei Lehramtsstudierenden
- 4.2.2 Der Fragebogen zur digitalen Selbstwirksamkeitserwartung
- 4.3 Datenauswertung
- 4.4 Hypothesenprüfung und statistische Verfahren
- 4.5 Kategorisierung der ergänzenden Fragen
- 5 Ergebnisdarstellung
- 5.1 Auswertung der Hypothesen
- 5.2 Auswertung der ergänzenden Fragen
- 6 Diskussion
- 6.1 Diskussion der Hypothesen
- 6.2 Diskussion der ergänzenden Fragen
- 6.3 Ergebnisse vor dem Hintergrund bisheriger Forschung
- 6.4 Praktische Implikationen für die kontinuierliche Professionalisierung
- 6.5 Limitationen der vorliegenden Untersuchung
- 6.6 Anschlussfragestellungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die digitalen Kompetenzen und die digitale Selbstwirksamkeitserwartung von Lehramtsstudierenden. Das zentrale Ziel ist es, Unterschiede in Bezug auf Studienabschnitt, Geschlecht und Fachrichtung zu identifizieren und die Korrelation zwischen diesen beiden Konstrukten zu analysieren. Die Arbeit trägt somit zum Verständnis der digitalen Kompetenzen zukünftiger Lehrkräfte bei.
- Digitale Kompetenzen von Lehramtsstudierenden
- Digitale Selbstwirksamkeitserwartung von Lehramtsstudierenden
- Einfluss von Studienabschnitt, Geschlecht und Fachrichtung auf digitale Kompetenzen und Selbstwirksamkeit
- Korrelation zwischen digitalen Kompetenzen und digitaler Selbstwirksamkeit
- Implikationen für die Lehrerausbildung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der digitalen Transformation im Lehrberuf ein und hebt die Bedeutung digitaler Kompetenzen und der digitalen Selbstwirksamkeitserwartung für zukünftige Lehrkräfte hervor. Es wird die Forschungsfrage formuliert und die Struktur der Arbeit erläutert.
2 Theoretischer Hintergrund: Dieser Abschnitt definiert die zentralen Begriffe „digitale Kompetenz“ und „Selbstwirksamkeitserwartung“. Es werden verschiedene theoretische Ansätze diskutiert und der aktuelle Forschungsstand zu diesen Themen kritisch beleuchtet, wobei bestehende Forschungslücken identifiziert werden, die die vorliegende Arbeit zu schließen versucht.
3 Forschungsfragen und Forschungshypothesen: Hier werden die konkreten Forschungsfragen präzise formuliert und auf deren Basis werden überprüfbare Hypothesen aufgestellt, die im weiteren Verlauf der Arbeit empirisch getestet werden. Die Hypothesen beziehen sich auf die vermuteten Zusammenhänge zwischen den untersuchten Variablen (digitale Kompetenz, digitale Selbstwirksamkeit, Studienabschnitt, Geschlecht, Fachrichtung).
4 Methodik: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der durchgeführten Studie. Es wird die Stichprobe charakterisiert (126 Lehramtsstudierende, mehrheitlich von der Freien Universität Berlin), das Forschungsdesign (quantitative Online-Befragung) erläutert und die verwendeten Erhebungsinstrumente (Skala zur Selbsteinschätzung digitaler Kompetenzen und SWIT-Skala zur digitalen Selbstwirksamkeit) vorgestellt. Die Datenanalyse mittels JASP wird ebenfalls detailliert beschrieben.
5 Ergebnisdarstellung: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung präsentiert. Es werden die Ergebnisse zur Überprüfung der aufgestellten Hypothesen dargestellt, wobei sowohl die statistische Signifikanz als auch die Effektstärken berücksichtigt werden. Zusätzlich werden Ergebnisse aus ergänzenden Fragen der Befragung analysiert und präsentiert.
6 Diskussion: Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt in diesem Kapitel. Die Ergebnisse werden im Kontext des theoretischen Hintergrunds und des aktuellen Forschungsstands interpretiert. Die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis der Lehrerausbildung wird diskutiert, die Limitationen der Studie werden kritisch reflektiert und Anschlussfragen für zukünftige Forschung werden formuliert.
Schlüsselwörter
Digitale Kompetenzen, Digitale Selbstwirksamkeitserwartung, Lehramtsstudierende, Online-Befragung, Quantitative Forschung, MINT-Fächer, Geschlecht, Studienabschnitt, Korrelation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus der Masterarbeit über digitale Kompetenzen von Lehramtsstudierenden?
Die Masterarbeit untersucht die digitalen Kompetenzen und die digitale Selbstwirksamkeitserwartung von Lehramtsstudierenden. Das zentrale Ziel ist es, Unterschiede in Bezug auf Studienabschnitt, Geschlecht und Fachrichtung zu identifizieren und die Korrelation zwischen diesen beiden Konstrukten zu analysieren. Die Arbeit trägt somit zum Verständnis der digitalen Kompetenzen zukünftiger Lehrkräfte bei.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen:
- Digitale Kompetenzen von Lehramtsstudierenden
- Digitale Selbstwirksamkeitserwartung von Lehramtsstudierenden
- Einfluss von Studienabschnitt, Geschlecht und Fachrichtung auf digitale Kompetenzen und Selbstwirksamkeit
- Korrelation zwischen digitalen Kompetenzen und digitaler Selbstwirksamkeit
- Implikationen für die Lehrerausbildung
Was wird im ersten Kapitel (Einleitung) behandelt?
Das erste Kapitel führt in die Thematik der digitalen Transformation im Lehrberuf ein und hebt die Bedeutung digitaler Kompetenzen und der digitalen Selbstwirksamkeitserwartung für zukünftige Lehrkräfte hervor. Es wird die Forschungsfrage formuliert und die Struktur der Arbeit erläutert.
Was wird im zweiten Kapitel (Theoretischer Hintergrund) behandelt?
Dieser Abschnitt definiert die zentralen Begriffe „digitale Kompetenz“ und „Selbstwirksamkeitserwartung“. Es werden verschiedene theoretische Ansätze diskutiert und der aktuelle Forschungsstand zu diesen Themen kritisch beleuchtet, wobei bestehende Forschungslücken identifiziert werden, die die vorliegende Arbeit zu schließen versucht.
Was wird im dritten Kapitel (Forschungsfragen und Forschungshypothesen) behandelt?
Hier werden die konkreten Forschungsfragen präzise formuliert und auf deren Basis werden überprüfbare Hypothesen aufgestellt, die im weiteren Verlauf der Arbeit empirisch getestet werden. Die Hypothesen beziehen sich auf die vermuteten Zusammenhänge zwischen den untersuchten Variablen (digitale Kompetenz, digitale Selbstwirksamkeit, Studienabschnitt, Geschlecht, Fachrichtung).
Was wird im vierten Kapitel (Methodik) behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der durchgeführten Studie. Es wird die Stichprobe charakterisiert (126 Lehramtsstudierende, mehrheitlich von der Freien Universität Berlin), das Forschungsdesign (quantitative Online-Befragung) erläutert und die verwendeten Erhebungsinstrumente (Skala zur Selbsteinschätzung digitaler Kompetenzen und SWIT-Skala zur digitalen Selbstwirksamkeit) vorgestellt. Die Datenanalyse mittels JASP wird ebenfalls detailliert beschrieben.
Was wird im fünften Kapitel (Ergebnisdarstellung) behandelt?
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung präsentiert. Es werden die Ergebnisse zur Überprüfung der aufgestellten Hypothesen dargestellt, wobei sowohl die statistische Signifikanz als auch die Effektstärken berücksichtigt werden. Zusätzlich werden Ergebnisse aus ergänzenden Fragen der Befragung analysiert und präsentiert.
Was wird im sechsten Kapitel (Diskussion) behandelt?
Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt in diesem Kapitel. Die Ergebnisse werden im Kontext des theoretischen Hintergrunds und des aktuellen Forschungsstands interpretiert. Die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis der Lehrerausbildung wird diskutiert, die Limitationen der Studie werden kritisch reflektiert und Anschlussfragen für zukünftige Forschung werden formuliert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Digitale Kompetenzen, Digitale Selbstwirksamkeitserwartung, Lehramtsstudierende, Online-Befragung, Quantitative Forschung, MINT-Fächer, Geschlecht, Studienabschnitt, Korrelation.
- Quote paper
- Marie Matern (Author), 2025, Digitale Kompetenzen und digitale Selbstwirksamkeitserwartungen von Lehramtsstudierenden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1586821