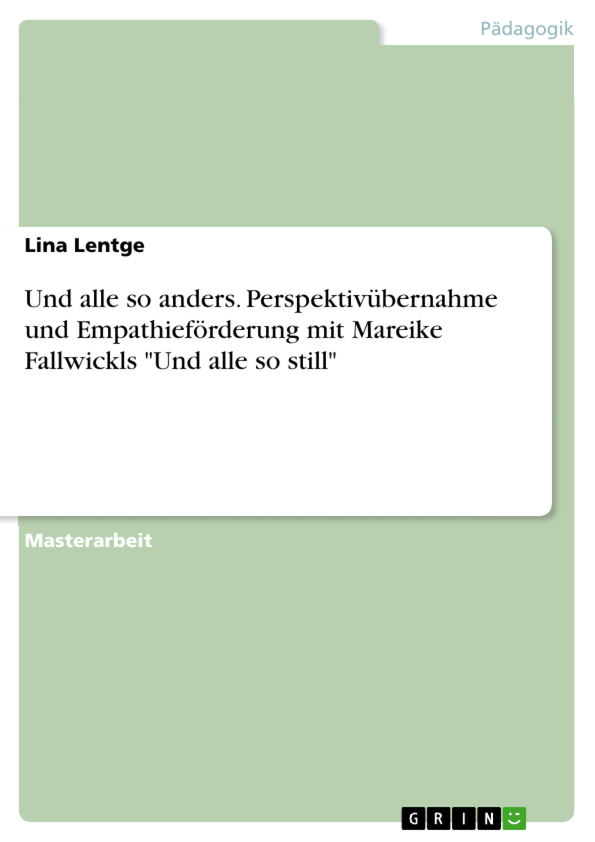Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, die didaktischen Potentiale des Romans „Und alle so still“ von Mareike Fallwickl zu untersuchen. Der Fokus liegt dabei auf der Förderung von Perspektivübernahme und Empathiebildung im Literaturunterricht der Sekundarstufe II in Niedersachsen. Es soll erörtert werden, wie Fallwickls narrative Darstellung der ProtagonistInnen als literarisches Werkzeug genutzt werden kann, um SchülerInnen dazu anzuregen, sich in verschiedene Lebenswelten hineinzuversetzen und so ihre soziale Sensibilität und ihr kritisches Denkvermögen zu stärken. Das Zentrum dieser Untersuchung bildet die Frage, wie die multiperspektiv angelegte Struktur des Romans nicht nur als ästhetisches Gestaltungsmittel, sondern auch als didaktisches Instrument sein Potential entfalten kann. Die Arbeit zielt darauf ab, anhand des Romans Strategien zu entwickeln, die eine gezielte Reflexion von Geschlechter- und Rollenbildern ermöglichen und den Transfer von Kompetenzen zur literarischen Perspektivübernahme auf andere Diskurse fördern.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Perspektivübernahme im Literaturunterricht - Theoretischer Rahmen und didaktische Konzepte
2.1 . Grundlagen der Perspektivübernahme
2.1.1 Aufriss des Fachdiskurses
2.1.2 Perspektivübernahme und Empathie: Kognitive und emotionale Aspekte
2.2 Bedeutung von Perspektivwechseln in literarischen Texten
2.3 Reflexions- und Empathiepotentiale durch literarische Figuren und Erzählstrukturen
2.4 Ziele von Perspektivübernahme und Empathiebildung im Literaturunterricht der SEK II
2.5 Kompetenzorientierte Förderung von Perspektivübernahme und Empathiebildung
3. Romananalyse
3.1 Figurenanalyse und Perspektivstruktur
3.1.1 Untersuchung der Figurenkonstellationen und deren Perspektiven
3.1.2 Rolle der Perspektivwechsel und deren Wirkung auf Leser*innen
3.1.3 Selbstermächtigung und Selbstreflexion der Figuren als Mittel zur Förderung von Empathie
3.2 Narrative Mittel und ihre didaktische Bedeutung
3.2.1 Erzählstrukturen zur Förderung von Perspektivübernahme und kritischer Reflexion
3.2.2 Symbolik und Themen: Identität, Machtverhältnisse und soziale Rollen
4. Didaktische Hinweise für den Literaturunterricht in der Sekundarstufe II
4.1 . Perspektivübernahme und Reflexion als didaktische Ziele
4.2 Analyse von Figurenperspektiven und kritische Reflexion gesellschaftlicher Rollenbilder
4.3 Evaluation und Transfer von Perspektivübernahme und Empathiebildung
5. Ausblick
6. Literaturverzeichnis
7. Anhang
1. Einleitung
Wer spricht, wenn alle schweigen? Wer bleibt, wenn alle verschwinden? In „ Und alle so still “ erzählt Mareike Fallwickl von den Stimmen, die in gesellschaftlichen Machtstrukturen zu oft ungehört verhallen. Durch ihr multiperspektivisches Erzählen und die gezielte Brechung narrativer Erwartungsmuster fordert sie die Leser*innen1 dazu auf, sich aktiv mit unterschiedlichen Erfahrungen, Machtverhältnissen und gesellschaftlichen Rollenbildern auseinanderzusetzen - ein Potential, das insbesondere im Literaturunterricht gezielt genutzt werden kann. Die Bedeutung der Perspektivübernahme und der Empathiebildung im Literaturunterricht lässt sich sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus gesellschaftlicher Sicht ableiten. In einer Zeit, in der gesellschaftliche Polarisierung, starke Emotionalisierung, Identitätskonflikte und ein zunehmender digitaler Diskurs zentrale Herausforderungen für die Gesellschaft darstellen, bietet die Literatur einen besonderen Raum, um durch narrative Erfahrungen Verständnis und Empathie zu fördern. Literarische Texte besitzen das Potential, in die vielfältigen Lebenswelten anderer Menschen einzutauchen und dadurch eigene Sichtweisen zu hinterfragen. Spinner betont, dass die Perspektivübernahme von der mitfühlenden Empathie bis zur kognitiven Auseinandersetzung mit Fremdheit reichen kann.2 Die Fähigkeit, verschiedene Perspektiven einzunehmen, wird in der aktuellen Debatte um die Bedeutung von Empathie als Grundlage gesellschaftlicher Kohäsion immer wieder als Schlüsselkompetenz hervorgehoben. Vor allem Texte aus einer persönlichen Perspektive entfalten diesbezüglich ein großes Potential.3 So kann Literatur zu einem Instrument werden, das Menschen dazu befähigt, moralische und ethische Empathie zu entwickeln - eine These, die auch in der bildungspolitischen Diskussion zunehmend an Bedeutung gewinnt.4 Aus wissenschaftlicher Perspektive ist die Perspektivübernahme ein interessanter Ansatzpunkt, der sowohl als kognitiver Prozess als auch als bedeutender Bestandteil der Empathiefähigkeit verstanden werden kann. Ausführungen des literaturdidaktischen Fachdiskurses, aber vor allem die von Spinner, zu Perspektivübernahme und Empathiebildung zeigen, dass Schüler, die durch literarische Texte in die Innenwelt anderer Figuren eintauchen, eine höhere Sensibilität gegenüber fremden Lebensrealitäten entwickeln können.
Diese Empathiebildung kann dazu beitragen, stereotype Denkmuster aufzubrechen und eine kritisch-reflektierte Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen und Identitätsbildern zu fördern.5 Darüber hinaus ist das Thema auch im Kontext der Identitätsbildung von zentraler Bedeutung. In aktuellen Debatten um die Frage, wie Jugendliche ihre eigene Identität in einer multikulturellen, digital geprägten Gesellschaft konstruieren, kann die Literatur zum Transformationsraum werden. Literarisches Lernen ermöglicht es, die eigene Position in einem komplexen sozialen Gefüge zu verorten und alternative Sichtweisen als Grundlage für persönliche und gesellschaftliche Weiterentwicklungen zu nutzen.6
Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, die didaktischen Potentiale des Romans „Und alle so still“ von Mareike Fallwickl zu untersuchen. Der Fokus liegt dabei auf der Förderung von Perspektivübernahme und Empathiebildung im Literaturunterricht der Sekundarstufe II in Niedersachsen (nachfolgend abgekürzt durch: SEK II). Es soll erörtert werden, wie Fallwickls narrative Darstellung der Protagonist*innen als literarisches Werkzeug genutzt werden kann, um Schüler*innen dazu anzuregen, sich in verschiedene Lebenswelten hineinzuversetzen und so ihre soziale Sensibilität und ihr kritisches Denkvermögen zu stärken. Das Zentrum dieser Untersuchung bildet die Frage, wie die multiperspektiv angelegte Struktur des Romans nicht nur als ästhetisches Gestaltungsmittel, sondern auch als didaktisches Instrument sein Potential entfalten kann. Die Arbeit zielt darauf ab, anhand des Romans Strategien zu entwickeln, die eine gezielte Reflexion von Geschlechter- und Rollenbildern ermöglichen und den Transfer von Kompetenzen zur literarischen Perspektivübernahme auf andere Diskurse fördern. Daraus ergeben sich für den Verlauf der Arbeit folgende zentrale Forschungsfragen:
I. Wie kann Fallwickls Darstellung der Protagonist*innen als literarisches Mittel im didaktischen Kontext genutzt werden, um Perspektivübernahme zu fördern? Diese Frage widmet sich der Analyse, inwiefern die narrative Struktur und die vielschichtige Darstellung der Figuren - etwa die kontrastreiche Inszenierung von Elin, Nuri und Ruth - als Grundlage für Unterrichtseinheiten dienen können, die die Fähigkeit zur Perspektivübernahme stärken.
II. Welche literaturdidaktischen Strategien bieten Potential zur Reflexion von Geschlechter- und Rollenbildern und zur empathischen Auseinandersetzung? Im Fokus dieser Frage steht, welche konkreten methodischen Ansätze geeignet sind, um stereotype Geschlechter- und Rollenbilder aufzubrechen und einen reflektierten Umgang mit diesen Themen zu fördern. Hierbei soll auch untersucht werden, wie interkulturelle und gesellschaftspolitische Dimensionen in den Unterricht integriert werden können, um ein umfassenderes Verständnis von Identität und sozialer Ungleichheit zu ermöglichen.
III. Wie lassen sich narrative Mittel wie Perspektivwechsel und Figurenkonstellationen gezielt einsetzen, um kritisches Denken und soziale Sensibilität bei Schüler*innen anzuregen? Diese dritte Forschungsfrage befasst sich mit der praktischen Umsetzung von narrativen Strategien im Unterricht. Es soll analysiert werden, wie narrative Techniken - etwa die Wechsel zwischen inneren Monologen, multiperspektivische Darstellungen und gezielte Strukturbrüche - als Impulsgeber für kritische Auseinandersetzung und die Entwicklung von Empathie genutzt werden können.
Die vorliegende Arbeit verfolgt somit einen integrativen Ansatz, der sowohl theoretische als auch praxisorientierte Aspekte verbindet. Sie leistet einen Beitrag zur aktuellen Diskussion über die Rolle von Empathie, Identitätsbildung und literarischem Lernen im Kontext einer pluralistischen Gesellschaft. Durch die Untersuchung des Romans „Und alle so still“ soll gezeigt werden, wie literarische Texte als Katalysator für die Entwicklung von Perspektivübernahme genutzt werden können - und wie diese Kompetenzen gezielt im Unterricht gefördert und auf andere literarische sowie gesellschaftliche Kontexte übertragen werden können.
Im ersten Part der Arbeit soll ein umfassender theoretischer Rahmen entwickelt werden, der die zentralen Konzepte der Perspektivübernahme und Empathiebildung im Kontext der Literaturdidaktik verortet. Dabei werden sowohl kognitive als auch emotionale Dimensionen der Identitätsbildung diskutiert und in den aktuellen wissenschaftlichen Diskurs eingeordnet. Die Ausführungen von Spinner und Kathrin Kloppert bilden für diesen Teil der Arbeit eine elementare Grundlage. Der zweite Teil fokussiert die detaillierte Analyse des Romans „Und alle so still“. Anhand einer Figurenanalyse und einer Untersuchung der narrativen Strukturen werden die spezifischen Mechanismen der multiperspektivischen Darstellung herausgearbeitet.
Hierbei wird untersucht, wie die wechselnden Perspektiven der Protagonist*innen als literarisches Mittel wirken und welche Potentiale sie im Hinblick auf die Förderung von Empathie und kritischer Reflexion bieten. Im dritten und abschließenden Teil wird schließlich die didaktische Umsetzung der theoretisch erarbeiteten Ansätze thematisiert. Es werden konkrete Hinweise und Ansätze skizziert, die den Transfer der im Roman gewonnenen Perspektivübernahme-Kompetenzen auf den allgemeinen Literaturunterricht ermöglichen. Hierbei werden verschiedene methodische Arbeitsformen vorgestellt. Ergänzt werden diese Ansätze durch Evaluationsinstrumente, die eine kontinuierliche Rückmeldung und die Messung des Lernfortschritts gewährleisten. Ziel ist es, einen sicheren und reflektierten Lernraum zu schaffen, in dem Schüler*innen nicht nur literarische Techniken erlernen, sondern auch in die Lage versetzt werden, ihre eigene Identitäts- und Empathiebildung kritisch zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Durch diese strukturierte Vorgehensweise wird ein integrativer Rahmen geschaffen, der theoretische Erkenntnisse mit praxisnahen Unterrichtsideen verbindet und somit einen nachhaltigen Beitrag zur Förderung von Perspektivübernahme und Empathie im Literaturunterricht leisten kann.
Aus didaktischer Sicht bietet diese Untersuchung einen Mehrwert, da sie konkrete Unterrichtsstrategien und methodische Interventionen skizziert, die den Transfer von literarischem Wissen in den schulischen Alltag erleichtern. Indem verschiedene Arbeitsformen miteinander verknüpft werden, wird ein sicherer und reflektierter Lernraum geschaffen, in dem nicht nur das Textverständnis, sondern auch die emotionale und kognitive Empathie der Lernenden nachhaltig gestärkt wird. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen, wie der zunehmenden Polarisierung und der Diskussion um interkulturelle Sensibilität, von Bedeutung. Darüber hinaus kann die Arbeit wertvolle Anknüpfungspunkte für weiterführende Forschungen in der Literaturdidaktik liefern. Die erarbeiteten Konzepte und Modelle können als Grundlage für empirische Studien dienen, die den Einsatz multiperspektivischer Literatur in unterschiedlichen schulischen und kulturellen Kontexten weiter untersuchen. Somit trägt diese Arbeit nicht nur zur theoretischen Weiterentwicklung der Literaturdidaktik bei, sondern bietet auch praxisrelevante Impulse für die Gestaltung zeitgemäßen, inklusiven und reflexiven Unterrichts. Insgesamt zeigt sich, dass die Förderung von Perspektivübernahme und Empathiebildung im Literaturunterricht nicht nur das individuelle Lernpotential der Schüler*innen stärkt, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe und zur Überwindung von Vorurteilen leisten kann - ein Ziel, das in der heutigen, pluralistischen Gesellschaft von zentraler Bedeutung ist.
2. Perspektivübernahme im Literaturunterricht - Theoretischer Rahmen und didaktische Konzepte
Die folgenden Unterkapitel widmen sich der theoretischen und didaktischen Fundierung der Perspektivübernahme und Empathie mit einem literaturdidaktischen Fokus. Dabei gliedert sich dieses Kapitel in mehrere theoretischen und didaktischen Bausteine. Zunächst wird in Kapitel 2.1 eine begriffliche und fachwissenschaftliche Grundlage geschaffen, indem zentrale Überlegungen sowie psychologische und literaturwissenschaftliche Sichtweisen auf Perspektivübernahme und Empathie dargestellt werden. Die Kapitel 2.2 und 2.3 untersuchen anschließend, welche Bedeutung Perspektivwechsel in literarischen Texten haben und welche Reflexions- und Empathiepotentiale sich durch literarische Figuren und Erzählstrukturen ergeben. Darauf aufbauend geht Kapitel 2.4 auf die konkreten Zielsetzungen der Perspektivübernahme im Literaturunterricht der SEK II ein. Hier soll erläutert werden, weshalb und in welcher Form Perspektivübernahme als didaktisches Lernziel gefasst werden kann und welche Kompetenzen Schüler*innen dadurch entwickeln können. Kapitel 2.5 stellt verschiedene methodische und didaktische Konzepte vor, die sich gezielt zur Förderung von Perspektivwechseln. Schließlich wird in Kapitel 2.6 der kompetenzorientierte Zugang zu Perspektivübernahme diskutiert und in den größeren Rahmen literarischer Bildung eingeordnet. Diese theoretischen und didaktischen Überlegungen bilden damit die Grundlage für die Analyse in Kapitel 3, in dem anhand Fallwickls Roman „Und alle so still“ untersucht wird, wie narrative Strukturen Perspektivübernahme begünstigen können. Die gewonnenen Erkenntnisse werden schließlich in Kapitel 4 in ein didaktisches Konzept überführt, das zeigt, wie Perspektivübernahme und Empathieförderung systematisch in den Literaturunterricht integriert werden können.
2.1. Grundlagen der Perspektivübernahme
Um Perspektivübernahme und Empathiebildung als literaturdidaktische Konzepte fundiert betrachten zu können, ist zunächst eine begriffliche Klärung und theoretische Verortung erforderlich. Perspektivübernahme wird in verschiedenen Disziplinen unterschiedlich definiert, wobei sich kognitive, emotionale und soziale Sichtweisen überlappen.
Insbesondere in der Literaturdidaktik wird sie als Schlüsselkompetenz des literarischen Lernens betrachtet, da sie nicht nur das Textverständnis vertieft, sondern auch zur kritischen
Reflexion gesellschaftlicher Diskurse beiträgt.7 Im Folgenden wird in Kapitel 2.1.1 zunächst ein Überblick über den Fachdiskurs gegeben. Hierbei werden zentrale Definitionen sowie psychologische und literaturwissenschaftliche Forschungsperspektiven zusammengeführt, um den Begriff theoretisch einzuordnen. Anschließend widmet sich Kapitel 2.1.2 der Verbindung zwischen Perspektivübernahme und Empathie. Dabei werden sowohl kognitive als auch emotionale Aspekte beleuchtet, um zu zeigen, wie literarische Texte Empathieprozesse anstoßen und welche Rolle sie für das Verstehen fremder Sichtweisen spielen.
2.1.1 Aufriss des Fachdiskurses
Die Untersuchung von Perspektivübernahme und Empathiebildung erfordert eine fundierte Betrachtung ihrer psychologischen und literaturwissenschaftlichen Grundlagen, um ihre Bedeutung für literarisches Verstehen und didaktische Zielsetzungen herauszustellen. Dieser Abschnitt untersucht deshalb, wie Perspektivübernahme, Multiperspektivität und Empathie im literaturwissenschaftlichen Diskurs begriffen und modelliert werden, um später ihre Bedeutung für den Literaturunterricht der SEK II zu verdeutlichen.
Der allgemeine Begriff Perspektive lässt sich vom mittellateinischen Substantiv perspectiva ableiten, was so viel bedeutet, wie etwas wahrnehmen oder durch etwas hindurchsehen.8 Seit dem 20. Jahrhundert wird Perspektive als die Voraussetzung verstanden, auf deren Basis ein Mensch seine subjektive Wahrnehmung der Welt beschreibt. Die Perspektive eines Individuums setzt sich also aus diversen Faktoren und Annahmen zusammen, die in die subjektive Weltansicht dieses Individuums einfließen. Diese Begriffserklärung eignet sich deshalb für eine erzähltheoretische Betrachtung, weil sie terminologisch exakt und auf einer operationalisierbaren Begriffstheorie gründet. Dennoch herrscht eine überaus große Unklarheit und vor allem Uneinheitlichkeit, wenn es darum geht, den Perspektivbegriff literaturwissenschaftlich zu verwenden.9
Ein Zusammenhang zwischen dem Erzählen und der Perspektivität, wird vor allem dann erkenntlich, wenn von multiperspektivischem Erzählen gesprochen wird. Grund dafür ist das zeitgleiche Nebeneinanderstehen mehrerer Versionen desselben Geschehens.
Dieses Konzept, das insbesondere in narrativen Texten eine wichtige Rolle spielt, wird hier kurz skizziert, um seine Relevanz für die Förderung von Empathie und Perspektivwechsel aufzuzeigen.10 Eine detaillierte Untersuchung der Multiperspektivität erfolgt im Rahmen der Romananalyse, in der die Erzählstruktur und Figurenperspektiven von Fallwickls „ Und alle so still “ analysiert werden. Im Verlauf der Arbeit soll sich auf die jüngste Konstruktion von Multiperspektivität gestützt werden. Prieske definiert Multiperspektivität 2023 als ein Spannungsfeld zwischen mindestens zwei einzelnen Perspektiven und die dazugehörige Präsentation verschiedener sozialer Positionen und Lebenswelten. Die Perspektiven innerhalb eines literarischen Textes interagieren, ergänzen oder widersprechen demzufolge einander. Er betrachtet Multiperspektivität dabei aber nicht als universell, sondern als werk- und kontextabhängig. Prieske betont außerdem, dass Multiperspektivität auf fragmentierten Einzelperspektiven beruht, die jeweils die Komplexität der sozialen Realität widerspiegeln. Dabei gilt, dass jede der Einzelperspektiven „standortgebunden“ ist, also von den jeweiligen sozialen, kulturellen und persönlichen Erfahrungen einer Figur geprägt.11
Während Multiperspektivität die gleichzeitige Darstellung verschiedener Sichtweisen innerhalb eines literarischen Werks beschreibt, stellt Perspektivübernahme die Fähigkeit dar, die Perspektive einzelner Figuren oder Erzähler*innen nachzuvollziehen.12 Literarische Texte, die multiperspektivisch angelegt sind, eröffnen Leser*innen somit nicht nur verschiedene Blickwinkel auf ein Geschehen, sondern fordern aktiv die Auseinandersetzung mit den individuellen Sichtweisen und Lebenswelten der Figuren. Diese Prozesse bilden die Grundlage für die Förderung von Perspektivübernahme, die im folgenden Abschnitt genauer betrachtet wird. Die vorliegende Arbeit orientiert sich an der Definition von Perspektivübernahme nach Seyler und nutzt diese als theoretische Grundlage:
„Perspektivübernahme bedeutet das Erkennen des inneren Zustands dieser Figur, also ihrer Empfindungen, Gedanken, Absichten und Erfahrungen - auch in der Beziehung zu anderen Figuren - und das darauf aufbauende Verstehen der Handlungsmotive dieser Figur und ihres Verhaltens. [...] Es wird mit Blick aus der Sicht der entsprechenden Figur verstanden, wieso es zur entsprechenden Handlung kommt.“13
Die von Seyler beschriebene Perspektivübernahme stellt somit nicht nur eine zentrale Fähigkeit im Umgang mit literarischen Figuren dar, sondern bildet auch eine wesentliche Grundlage für das Verstehen von literarischen Texten insgesamt. Indem Leser*innen sich in die Perspektiven der Figuren hineinversetzen und deren Gedanken und Gefühle nachvollziehen, erschließt sich der Text nicht nur auf inhaltlicher, sondern auch auf einer tieferen, interpretativen Ebene. Diese enge Verbindung zwischen Perspektivübernahme und literarischem Verstehen wird auch in der Literaturdidaktik ausführlich diskutiert. So betont Spinner bereits in einer Veröffentlichung, im Jahr 1980, die Bedeutung des Perspektivverstehens für das Verstehen literarischer Texte.14 Später konkretisiert er, dass das Verstehen literarischer Texte (= literarisches Verstehen) die Auseinandersetzung eigener und fremder Perspektiven im Text unbedingt erfordert.15 Kloppet vertritt die Ansicht, dass ein literarischer Text nur dann adäquat verstanden werden kann, wenn Perspektiven innerhalb des Textes übernommen und verstanden werden und eine Einordnung in das Textganze stattfindet.16 Hurrelmann betrachtet das Perspektivverstehen und die Übernahme von Perspektiven als einen „Blick über den Tellerrand hinaus“.17 Sie betont die Fähigkeit der Auseinandersetzung mit Fremdartigem und Unbekanntem als einen Beitrag zur Bildung eines „gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekts “.18
Folgt man der Ansicht von Andringa, so beeinflusst die Perspektivgestaltung eines Textes auch die Komplexität dieses Textes. Andringas Forschung bildet seit Ende der 80er Jahre den Ausgangspunkt empirischer Studien zur Perspektivgestaltung literarischer Texte.19 Darauf aufbauend belegte Stark in den Jahren 2012 und 2019 mithilfe von Laut-DenkProtokollen den maßgeblichen Einfluss des Perspektivverstehens auf das Textverstehen.20 Einen weiteren bedeutenden empirischen Befund lieferte Buhl durch die Untersuchung von Perspektivübernahme im Primarbereich.
Die Studienergebnisse belegen einen „signifikanten und praktisch bedeutsamen Zusammenhang“ zwischen Perspektivübernahme und Textverstehen.21 Buhls Definition von Perspektivübernahme umfasst diesbezüglich die Übernahme einer Figurenperspektive sowie das generelle Verstehen von Erzählperspektiven.22
Neben der Perspektivübernahme muss auch die Empathie als weiteres komplexes Phänomen betrachtet werden. Kloppert beschreibt die Empathie als eine Fähigkeit, sich die emotionale Lage seines Gegenübers hineinzuversetzen und diese nachzuvollziehen.23 Gailberger überträgt den Begriff der Empathie auf die Betrachtung literarischer Texte, indem er Empathie als emotionale-affektive Reaktion auf dem Zustand einer literarischen Figur definiert. Er meint damit konkret einen reflektierten Prozess, der sowohl die Wahrnehmung, Erkennung und das Verstehen des emotional-affektiven Zustands der Figur als auch die bewusste Differenzierung zwischen eigenen und fremden Emotionen benennt.24 Im allgemeinen Konsens setzt man Empathie häufig mit der Identifikation gleich, doch unterscheiden sie sich deutlich voneinander. Während sich Identifikation auf Figuren oder Situationen beziehen kann, setzt die Empathie ausschließlich den emotionalen Zustand einer Figur in den Fokus. Empathie kann damit als komplexer angesehen werden, da sie eine Verhandlung zwischen dem eigenen Selbst und der Figur verlangt. Ziel ist demzufolge, die Gefühle der Figur zu reflektieren und im Kontext begründet nachzuvollziehen.25 Empathie kann deshalb als ein zentraler Aspekt des literarischen Lesens verstanden werden und wird deshalb in der Literaturtheorie als wesentliches Merkmal von Literarizität betrachtet.26 Eine einheitliche Definition von Empathie ist jedoch schwierig. Keen beschreibt Empathie mit dem Satz: „I feel what you feel.“27 Übertragen auf das literarische Verstehen bedeutet dies, dass Leser*innen nachempfinden, was literarische Figuren fühlen. Dabei stehen Begriffe wie Einfühlung und Perspektivenübernahme häufig in engem Zusammenhang, werden teils sogar synonym verwendet. Während Perspektivenübernahme in der Kognitionsforschung häufig unter dem Begriff Theory of Mind untersucht wird und kognitive Prozesse beschreibt, bezieht sich Empathie stärker auf emotionale Prozesse. Neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass diese beiden Prozesse in unterschiedlichen Hirnarealen aktiviert werden.28
Allerdings wird die Trennung von Emotion und Kognition in der Literaturdidaktik, etwa von Olsen, kontrovers diskutiert, da sie als zu stark vereinfacht angesehen wird.29
2.1.2 Perspektivübernahme und Empathie: Kognitive
und emotionale Aspekte
Die Fähigkeit zur Perspektivübernahme bildet eine zentrale Grundlage für die kognitive und emotionale Auseinandersetzung mit literarischen Texten. Sie ermöglicht es Leser*innen, die Gedanken, Gefühle und Handlungsgründe literarischer Figuren nachzuvollziehen, und schafft damit die Basis für Empathie. Im Folgenden werden die theoretischen Grundlagen dieser Fähigkeiten sowie deren Bedeutung für das literarische Verstehen dargestellt.
Auch in der Entwicklungspsychologie findet die Übernahme von Perspektiven ihren Platz. In der Entwicklungspsychologie wird zwischen drei Formen der Perspektivübernahme unterschieden. Zum einen gibt es die kognitive Perspektivübernahme, die die Fähigkeit umfasst, Gedanken und das Wissen einer Figur zu erfassen. Die zweite Form bildet die emotionale Perspektivübernahme, also die Fähigkeit, sich in die Gefühle einer Figur einzufühlen. Die dritte Form, die motivationale Perspektivübernahme, wird in Bezug auf die vorliegende Arbeit nicht näher betrachtet, da sie in kein Verhältnis zum literarischen Verstehen gesetzt werden kann.30 Kloppert unterscheidet in zwei Ebenen des Perspektivverstehens. Zum einen definiert sie die inhaltliche Ebene, die das Verstehen der Figurenperspektive, darunter Figurenzusammenhänge, Motive und Intentionen, umfasst. Die zweite Ebene bildet die erzähltheoretische Ebene. Die Ebene befasst sich mit der Zuordnung von Perspektiven zu Figur und Erzähler*in. Kloppert betont die enge Verbundenheit beider Ebenen, da sie einander bedingen und jeweils die Voraussetzung für das Verstehen der anderen Ebene bilden. Sie betont aber auch die die Defizite dieser Unterteilung und das Fehlen erzähltheoretischer Modelle, die im Unterricht umsetzbar wären.31 Nach dem Verstehen von Perspektiven, folgt die Übernahme von Perspektiven. Diesbezüglich werden in der Entwicklungspsychologie vier Dimensionen der Perspektivübernahme, die verschiedene Aspekte der Weltsicht betreffen, definiert.
Dabei wird zwischen visuell-räumlicher, kognitiver (sozial-kognitiver), emotionaler und intentionaler Perspektivenübernahme unterschieden, die nachfolgend kurz erläutert werden sollen.32 Die visuell-räumliche Perspektivenübernahme beschreibt die Fähigkeit, sich die Sichtweise einer anderen Person auf einen Raum vorzustellen und nachzuvollziehen. Die kognitive Perspektivenübernahme hingegen konzentriert sich auf das Verständnis, wie situatives Wissen und Sichtweisen anderer dargestellt werden können. In Experimenten wird dies beispielsweise durch das Erzählen von Bildergeschichten aus verschiedenen Perspektiven untersucht. Dabei hilft kognitive Perspektivenübernahme, andere Menschen in ihren sozialen Kontexten zu verorten und ihre Gedanken und Absichten nachzuvollziehen.33 Die Fähigkeit, sich in die Gefühle anderer hineinzuversetzen und diese zu verstehen, beschreibt die emotionale Perspektivübernahme. Dies geschieht durch die Beobachtung von Mimik, Gestik, Körperhaltung und Stimmlage. Während der Prozess der emotionalen Perspektivenübernahme eng mit Empathie verknüpft ist, bleibt dennoch die Unterscheidung zwischen eigenen und fremden Gefühlen erhalten. Zuletzt, richtet die intentionale Perspektivenübernahme ihren Fokus auf das Verständnis der Beweggründe hinter Handlungen - also der Handlungsabsichten, Wünsche und Träume anderer.34 Spinner und Olsen stellen die kognitive und die emotionale Perspektivübernahme als die beiden wesentlichen Dimensionen in Bezug auf das literarische Verstehen dar. Beide Dimensionen sind eng miteinander verknüpft, da kognitive Prozesse oft die Grundlage für emotionales Einfühlen bilden.35
Ein differenzierteres Verständnis der Entwicklung von Perspektivübernahme bietet das Stufenmodell von Els Andringa, das auf den Arbeiten von Selman aufbaut. Andringa beschreibt fünf Entwicklungsstufen der Perspektivübernahme: Stufe 0, die egozentrische Perspektivenübernahme, kennzeichnet Kinder bis etwa acht Jahre, die ihre eigene Perspektive noch nicht von der Perspektive anderer Personen unterscheiden können. In Stufe 1, der einseitigen Perspektivenübernahme, sind Kinder bis zur sechsten Klasse in der Lage, sich auf eine andere Perspektive zu konzentrieren, ohne jedoch verschiedene Perspektiven zu integrieren.
In Stufe 2, der mehrfachen, nicht koordinierten Perspektivenübernahme, erkennen Kinder in der Regel ab der sechsten Klasse mehrere Perspektiven, ohne Relationen oder Zusammenhänge zwischen ihnen herzustellen. Die koordinierte Perspektivenübernahme (Stufe 3) erlaubt es Jugendlichen ab der achten Klasse, Perspektiven in Relation zu setzen und Interaktionen zwischen Perspektiven aus einer unabhängigen Position heraus wahrzunehmen. In Stufe 4, der Perspektivenintegration, entwickeln sie ein Bewusstsein für die Einbettung von Motiven und Handlungen in übergeordnete Kontexte. Gleichzeitig kann diese Distanz zur Figurenwelt ein vertieftes Verstehen erschweren.36 Rietz ergänzt dieses Modell durch die Perspektivenrelativierung, bei der Leser*innen ihre eigene Perspektive kritisch reflektieren und mit anderen Perspektiven in Beziehung setzen. Diese Reflexionsprozesse sind komplex und werden erst nach der Adoleszenz vollständig ausgebildet. Beide Modelle verdeutlichen, dass die Fähigkeit zur Perspektivübernahme einer stufenweisen Entwicklung unterliegt, die eng mit kognitiven, sozialen und emotionalen Prozessen verknüpft ist.37 Die Verbindung zwischen Perspektivübernahme und Mehrdeutigkeit literarischer Texte wurde von Freudenberg et al. im Rahmen des Design- Based-Research-Projekts PAuLi untersucht. Ziel des Projekts war es, konkrete Lehr-LernArrangements zu entwickeln, die die Kompetenz des Perspektivverstehens bei Schüler*innen gezielt fördern. Das Projekt hebt insbesondere hervor, dass Perspektivübernahme nicht nur als figuraler Prozess (z. B. das Verständnis der Gedanken und Gefühle von Figuren) verstanden werden sollte, sondern auch als narratorialer Prozess, der die Bindung des Dargestellten an die Erzählperspektive reflektiert.38
Ein zentrales Element des Projekts war die Untersuchung von Mehrdeutigkeit durch Aufgabenstellungen, die explizit auf die Unterscheidung zwischen perzeptiver und ideologischer Perspektive abzielen. So wurden etwa Texte eingesetzt, die konkurrierende figuraler und narratorialer Perspektiven aufweisen, um Schüler*innen anzuregen, den Geltungsanspruch des Dargestellten kritisch zu hinterfragen. Diese Herangehensweise zielt darauf ab, Perspektivübernahme mit einer Reflexion über Mehrdeutigkeit zu verbinden und so ein differenziertes Textverständnis zu fördern.39 Ein Beispiel aus der Unterrichtspraxis zeigt, wie durch szenisches Interpretieren oder die Gegenüberstellung unterschiedlicher Figurenperspektiven komplexere Verstehensprozesse angeregt werden können.
Aufgabe der Schüler*innen war es, aus der Sicht der unterschiedlichen Erzählinstanzen Stellungnahmen zu schreiben oder Diskussionen zu gestalten, in denen die verschiedenen Perspektiven explizit gemacht werden.40
Empathie bezeichnet die Fähigkeit, emotionale Zustände anderer nachzuvollziehen und sich in diese einzufühlen. Sie unterscheidet sich von der Identifikation, da sie nicht zwingend die Zustimmung zu den Handlungen oder Einstellungen einer Figur erfordert, sondern eine reflektierte Distanz bewahrt. Empathie ist dabei im literarischen Kontext ein bewusster Prozess, der die Wahrnehmung und Reflexion von Gefühlen literarischer Figuren umfasst.41 Die Verbindung von kognitiven und emotionalen Prozessen ist wesentlich für das Verständnis literarischer Texte. Während die kognitive Perspektivübernahme das Verständnis der narrativen Struktur und der Figurenlogik ermöglicht, schafft die emotionale Perspektivübernahme einen affektiven Zugang zu den Figuren und deren Erfahrungen. Neuere Studien zeigen, dass diese beiden Dimensionen nicht isoliert betrachtet werden sollten, sondern in einem wechselseitigen Verhältnis stehen.42 Narrative Strukturen, wie die Fokalisierung nach Genette und die Erzählperspektive nach Stanzel, spielen eine entscheidende Rolle für die Perspektivübernahme. Genettes Modell unterscheidet zwischen interner, externer und Nullfokalisierung, wobei insbesondere die interne Fokalisierung einen intensiven Einblick in die Gedankenwelt einer Figur ermöglicht. Leubner und Saupe erweitern diesen Ansatz durch die Unterscheidung zwischen Erzählperspektive und Sichtweise, was eine differenzierte Analyse literarischer Texte erlaubt. Im literarischen Kontext tragen die sprachliche Gestaltung und die emotionale Darstellung der Figuren dazu bei, Empathie zu fördern. Implizite Emotionen, wie sie etwa durch metaphorische Wendungen oder Andeutungen vermittelt werden, schaffen Interpretationsspielräume und regen Leser*innen zur Reflexion an.43
Die kognitive und emotionale Perspektivübernahme bildet zusammen mit der Empathie die Grundlage für ein tiefgehendes literarisches Verstehen. Diese Konzepte ermöglichen es Leser*innen, sich nicht nur in literarische Figuren hineinzuversetzen, sondern auch deren soziale und kulturelle Hintergründe zu reflektieren. Im Literaturunterricht kann die gezielte Auseinandersetzung mit narrativen Mitteln und Figurenperspektiven dazu beitragen, sowohl die Perspektivübernahme als auch die Empathie zu fördern und damit wichtige soziale Kompetenzen zu entwickeln.
2.2 Bedeutung von Perspektivwechseln in literarischen Texten
Um die Bedeutung von Perspektivwechseln in literarischen Texten nachvollziehen zu können, muss der Begriff der literarischen Perspektive zunächst klar definiert sein. Schmid definiert Perspektive als ein Komplex von inneren und äußeren Faktoren, die das Erfassen und Darstellen eines Geschehens bedingen.44 Damit wird deutlich, dass Perspektive nicht nur eine Frage des Standpunkts, sondern auch der Bedingungen ist, unter denen ein Geschehen wahrgenommen und wiedergegeben wird. Schmid betrachtet die Perspektive als ein fundamentales Element literarischer Texte. Sie wird nicht nachträglich auf eine Erzählung angewendet, sondern konstruiert die Erzählung selbst, da sie Einfluss auf die Auswahl und Gewichtung von Geschehnismomenten nimmt. Jede Darstellung von Wirklichkeit setzt dabei eine Perspektive voraus, durch die eine Auswahl, Benennung und Bewertung von Geschehensmomenten erfolgt.45 Es gibt unterschiedliche Modelle zur Beschreibung und Analyse von Perspektiven in literarischen Texten. Ein relevantes Unterscheidungsmerkmal stellt Genettes Differenzierung zwischen Stimme und Modus dar. Dabei bezieht sich die Stimme auf die Erzählinstanz und fragt nach der sprechenden Figur. Der Modus bezieht sich im Gegensatz dazu auf die Perspektive und fragt nach der wahrnehmenden Figur.46 Ein weiteres einflussreiches Modell der Erzählsituation, welches als Grundlage für viele literarische Analysen dient, entwickelte Stanzel. Sein Modell beschreibt die verschiedenen Arten narrativer Texte und differenziert dabei drei grundlegende Erzählsituationen.47
Die erste Erzählsituation, die auktoriale Erzählsituation, ist durch einen allwissenden Erzähler (bzw. eine allwissende Erzählerin) gekennzeichnet, der*die deutlich hervortritt und das Geschehen aus einer übergeordneten Perspektive betrachtet. Diese Perspektive zeichnet sich durch eine Außenperspektive aus, da der*die Erzähler*in das gesamte Geschehen überblickt und Einblick in die Gedanken und Gefühle aller Figuren nehmen kann. Einen Gegensatz dazu bildet die personale Erzählsituation, bei der ein*e Erzähler*in kaum in Erscheinung tritt. Die Handlung wird aus der Perspektive einer oder mehrerer Figuren abgebildet, wodurch eine Innenperspektive entsteht, die das Erleben und die Wahrnehmung der Figuren in den Vordergrund rückt. Die Ich-Erzählsituation grenzt sich dadurch davon ab, dass die Erzähler*innen selbst Teil der erzählten Welt sind und aus ihrer subjektiven Perspektive berichten. Im Mittelpunkt steht hier die Identität der Seinsbereiche von Erzähler*in und Figur. In seinem Modell von 1955 berücksichtigte Stanzel zusätzlich eine neutrale Erzählsituation, bei der die erzählende Person vollständig zurücktritt. In späteren Versionen seines Modells verwirft er dieses Konzept jedoch, da die Erzählinstanz selbst in szenischen Darstellungen grundsätzlich existent ist.48 Wichtig zu beachten, ist jedoch die Tatsache, dass Stanzels Modell der Erzählsituationen vielfach kritisiert wurde (bspw. durch Genette), da es verschiedene Dualitäten vermischt. Vor allem die Vermischung der Teilhabe der erzählenden Figur an der Diegesis mit der Perspektive wird bemängelt. Trotz dieser Kritik bildet Stanzels Modell auch heute noch die Grundlage vieler Werkanalysen. Es bietet einen ersten Überblick über verschiedene Formen des Erzählens und verdeutlicht, dass die Erzählperspektive einen entscheidenden Einfluss auf die Darstellung und Interpretation eines literarischen Textes ausübt.49 Kritisiert wurde Stanzels Modell unter anderem von Genette und seinem Modell der Fokalisierung. Die Fokalisierung nach Genette ist ein Konzept, welches zur Beschreibung der Relation zwischen dem Wissen der erzählenden Person und dem Figurenwissen genutzt wird. Genette unterscheidet dabei in drei Arten der Fokalisierung. Bei der ersten Form, der sogenannten Nullfokalisierung verfügt die erzählende Person über mehr Wissen als die Figur selbst. Diese Erzählweise wird auch als unfokalisierte Erzählung oder als Erzählung mit allwissendem Erzähler (oder allwissende Erzählerin) bezeichnet. Die erzählende Person hat hier einen umfassenden Überblick über das Geschehen und die Figuren und ist deshalb dazu fähig, Informationen zu geben, die den Figuren selbst nicht zugänglich sind. Als Vergleichsmaßstab definiert Genette die Allwissenheit des Autors bzw. der Autorin.
Es gilt jedoch zu beachten, dass auch ein allwissender Erzähler (oder allwissende Erzählerin) mit einer bestimmten Perspektive erzählt.50 Die zweite Art der Fokalisierung bildet die interne Fokalisierung, bei der die erzählende Person über genauso viel Wissen verfügt, wie die Figur. Das Geschehen wird hier aus der Perspektive einer oder mehrerer Figuren dargestellt. Die Erzählinstanz beschränkt sich auf die Dinge, die die jeweilige Figur weiß und wahrnimmt. Genette benutzt hierfür die verbreitete Bezeichnung des point of view.51 Die dritte Form bildet die externe Fokalisierung, bei der die erzählende Person über weniger Wissen verfügt, als die Figur. Die Figuren und das Geschehen werden hier von außen beobachtet, ohne Einblick in ihre Gedanken- oder Gefühlswelt zu geben. Es ist also eine objektive Erzählform.52 Auch Genettes Fokalisierungsmodell wird vielfach kritisiert, da der Begriff der Nullfokalisierung die Vorstellung eines Erzählens ohne Perspektive nahelegt und der Begriff der Fokalisierung doppeldeutig verwendet wird. Zur Weiterentwicklung des Modells haben Leubner und Saupe eine Unterscheidung zwischen der Erzählperspektive als Relation des Wissens und der Sichtweise als Art der Darstellung eingeführt, wodurch die Analyse literarischer Texte präzisiert wird und die Wirkung der Fokalisierung auf die Leser*innen-Lenkung deutlicher erfasst werden kann.53 Dennoch lässt sich das Modell der Fokalisierung als ein zentrales Konzept der Erzähltheorie nicht von der Hand weisen.
Ein weiteres Modell, welches zur Analyse literarischer Texte genutzt werden kann, ist das Modell der Multiperspektivität von Nünning und Nünning. Die Multiperspektivität ist ein zunehmend verbreitetes Merkmal moderner Romane, das durch die Darstellung verschiedener Standpunkte die Komplexität der Welt und menschlicher Erfahrungen reflektiert. Dabei können Perspektiven einander ergänzen, relativieren oder widersprechen, wodurch sich neue Interpretationsmöglichkeiten eröffnen. Die Struktur multiperspektivischer Texte bildet eine Schnittstelle zwischen Textbeschreibung und Deutung, indem sie Relationen zwischen Figuren, Erzählern und fiktiven Lesern aufzeigt. Zudem ermöglicht sie kultur- und geschichtsanalytische Untersuchungen, etwa zur Verteilung von Deutungs- und Diskurshoheiten. Durch den bewussten Wechsel der Perspektiven wird die Leser*innen-Lenkung beeinflusst, wodurch eine kritisch-reflektierte Auseinandersetzung mit dem Text gefördert wird.54
Warum kann ein Perspektivwechsel in literarischen Texten nun aber von Bedeutung sein? Die Gründe für die Bedeutsamkeit von Perspektivwechseln in literarischen Texten sind vielfältig. Durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen literarischen Perspektiven können Leser*innen Empathie entwickeln und ihre Fähigkeit zur Perspektivübernahme verbessern. Es befähigt die Leser*innen dazu, zu verstehen warum Figuren bestimmte Handlungen ausführen oder bestimmte Entscheidungen treffen.55 Das Nachvollziehen und Verstehen verschiedener literarischer Perspektiven ist außerdem zentral für ein adäquates Textverständnis. Nur durch das Erfassen der verschiedenen Perspektiven und deren Zusammenspiel können Leserinnen einen literarischen Text vollständig verstehen. Diese Annahme impliziert das Verstehen von Kohärenzlücken, die häufig durch die Perspektivgestaltung entstehen.56 Perspektivwechsel regen zum Nachdenken über Gründe und Folgen verschiedener Sichtweisen an. Die Leserinnen werden dazu aufgefordert, sich mit fremden und ihnen unbekannten Perspektiven auseinanderzusetzen und dabei ihre eigenen Standpunkte zu reflektieren.57 Diese Konfrontation mit verschiedenen Perspektiven ermöglicht es, den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus zu erweitern. Leserinnen können durch die Übernahme literarischer Perspektiven ihre eigenen Erfahrungen und Überzeugungen hinterfragen.58 Außerdem können sie ihr eigenes moralisches Urteilsvermögen schärfen und ihr Verständnis für die Komplexität moralischer Fragen verbessern.59 Bezogen auf multiperspektivische Texte gilt, dass die verschiedenen Perspektivwechsel innerhalb eines literarischen Textes den Leser*innen dabei helfen, ein konsistentes Weltbild aus den verschiedenen Eindrücken zu entwickeln und die Beziehungen zwischen den Perspektiven nachzuvollziehen.60
2.3 Reflexions- und Empathiepotentiale durch literarische Figuren und Erzählstrukturen
Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen der Perspektivübernahme und Empathiebildung wird in diesem Kapitel untersucht, inwiefern literarische Figuren und Erzählstrukturen Reflexions- und Empathieprozesse bei Leser*innen initiieren und fördern können. Es gilt dabei zu betonen, dass literarisches Verstehen als ein Aushandlungsprozess zwischen der eigenen und einer fremden Perspektive im Text verstanden werden kann. Dabei sind sowohl Identifikation, als auch Abgrenzung relevante Prozesse.61 Im fachlichen Diskurs wird noch immer darüber diskutiert, ob Perspektivübernahme und Empathie als separate Konzepte oder als miteinander verbundene Aspekte des literarischen Verstehens zu betrachten sind.62 So spricht sich Olsen beispielsweise in seiner Betrachtung des Phänomens Empathie beim Lesen literarischer Texte deutlich dafür aus, Emotion und Kognition als zusammenhängend zu betrachten und kritisiert die Trennung heftig.63 Spinner hingegen befürwortet die Trennung und beruft sich in seiner Ansicht auf die Neurowissenschaft, die davon ausgeht, dass die affektive Empathie und die kognitive Perspektivübernahme in unterschiedlichen Hirnarealen aktiviert werden.64
Bei der Reflexion verschiedener Perspektiven durch die Perspektivübernahme und das Verständnis literarischer Texte spielen die Figurenperspektiven eine elementare Rolle. Die Figurenperspektiven werden als die zentralen Handlungsträger*innen innerhalb fiktionaler Texte betrachtet, durch die die Handlung entwickelt wird und an denen sich Leser*innen orientieren können. Die Auseinandersetzung mit den Perspektiven von Figuren bildet damit den ersten Schritt, einen intensiven Bezug zum Text aufzubauen, durch den Reflexion- und Empathiepotentiale gestaltet werden können.65 Ein wichtiger Aspekt dabei ist das identifikatorische Lesen nach Spinner. Es beschreibt die temporäre Verschmelzung der eigenen Perspektive mit der einer literarischen Figur und wird deshalb auch als eine affektbesetzte Vorstellung beschrieben, die es den Leser*innen ermöglicht, sich emotional von einer Figur einnehmen zu lassen.66 Durch diese Identifikation können Leser*innen eine Nähe zu einer Figur aufbauen und Reflexions- und Empathiepotentiale sich frei entfalten.67 Die potentielle Empathie als emotionale Reaktion auf literarische Figuren beeinflusst das Textverständnis insofern, als dass sie die emotionale Involviertheit der Lesenden steigert.68 Gailberger definiert Empathie mit literarischen Figuren deshalb auch als einen Prozess, der sowohl kognitive als auch emotionale Aspekte kombiniert. Er beschreibt die Identifikation mit einer Figur im Gegensatz zur empfundenen Empathie, als einen unreflektierten, beiläufigen Prozess. Durch die empfundene Empathie können Leser*innen die Gefühle und Motive der Figuren besser nachvollziehen und reflektieren, was zu einem tieferen Textverständnis führt.69 Ebenfalls relevant für die Auseinandersetzung mit literarischen Figuren sind sogenannte Alteritätserfahrungen und das Fremdverstehen. Spinner betont, dass literarisches Verstehen bedeutet, in der Logik des Textes zu denken und auch die Fremdheit von Figuren wahrzunehmen. Es geht nicht nur darum, eigene Gefühle in den Figuren zu spiegeln, sondern auch, sich mit der Andersartigkeit der Figuren auseinanderzusetzen. Fremdverstehen kann es den Leser*innen somit ermöglichen, die Subjektivität und Individualität der Figuren zu erfassen und ihre Handlungen aus deren Perspektive nachzuvollziehen. Dieses Wechselspiel zwischen Perspektiv- und Fremdverstehen kann einen zentralen didaktischen Ansatz darstellen, um literarische Reflexionsprozesse zu initiieren.
Das Perspektivverstehen bezieht sich auf die Fähigkeit, die Perspektiven von Figuren und Erzählinstanzen zu erkennen und zu verstehen. Dies umfasst sowohl das Nachvollziehen von Gedanken, Wahrnehmungen und Gefühlen. als auch das Erfassen der strukturellen Ebene, wie sich diese Perspektiven im Text manifestieren.70 Das Fremdverstehen hingegen meint das Verständnis für andere, möglicherweise unbekannte oder fremde Lebenswelten und Sichtweisen. Es geht über das reine Verstehen der Figuren hinaus und inkludiert die Anerkennung und das Nachvollziehen von Perspektiven, die von der eigenen Lebensrealität abweichen.71 Durch die Auseinandersetzung mit literarischen Texten können Leser*innen dazu angeregt werden, ihre eigenen Perspektiven zu hinterfragen und sich mit anderen Lebensrealitäten auseinanderzusetzen.72
Dabei gilt zu beachten, dass die erzählende Person durch Sympathielenkung die Empathiebildung und die Perspektivübernahme der Leser*innen steuern kann.[73] Surkamp erklärt diesbezüglich, dass sympathische Figuren mehr Potential zur Reflexion und Empathiebildung bieten, während unsympathische Figuren das Empfinden von Empathie erschweren können. Die Erzählinstanz kann durch explizite oder implizite Äußerungen die Leser*innen dazu bringen, bestimmte Figuren zu bevorzugen oder abzulehnen, wodurch die Bereitschaft zur Übernahme der jeweiligen Perspektive beeinflusst wird.[74] Spinner ergänzt diese Erklärung um die Ansicht, dass die Lebenserfahrung der Leser*innen die Perspektivübernahme erleichtern kann. Je ähnlicher der Leser oder die Leserin einer Figur ist, desto leichter fällt es, Empathie zu empfinden und die Figurenperspektive anzunehmen.[75]
Das Wechselspiel zwischen Perspektivverstehen und Fremdverstehen stellt einen zentralen didaktischen Ansatz dar, um literarische Reflexionsprozesse zu initiieren. Perspektivverstehen bezieht sich auf die Fähigkeit, die Perspektiven von Figuren und Erzählinstanzen zu erkennen und zu verstehen. Dies umfasst sowohl das Nachvollziehen von Gedanken, Wahrnehmungen und Gefühlen. als auch das Erfassen der strukturellen Ebene, wie sich diese Perspektiven im Text manifestieren.[76] Fremdverstehen meint das Verständnis für andere, möglicherweise unbekannte oder fremde Lebenswelten und Sichtweisen. Es geht über das reine Verstehen der Figuren hinaus und inkludiert die Anerkennung und das Nachvollziehen von Perspektiven, die von der eigenen Lebensrealität abweichen.[77] Durch die Auseinandersetzung mit literarischen Texten werden Leser*innen angeregt, ihre eigenen Perspektiven zu hinterfragen und sich mit anderen Lebensrealitäten auseinanderzusetzen.[78] Die Konfrontation mit dem Fremden ermöglicht eine Erweiterung des eigenen Horizonts und kann zur Bildung eines „gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekts“ beitragen.[79]
Auch die Fokalisierungsarten nach Genette können Potentiale zur Reflexion und zum Empfinden von Empathie entfalten. Die verschiedenen Arten der Fokalisierung können im Literaturunterricht gezielt genutzt werden, um aufzuzeigen, wie die Perspektive die Darstellung und Interpretation eines literarischen Textes beeinflusst. Durch die Analyse der Fokalisierung können Schüler*innen lernen, wie die Erzählinstanz Informationen preisgibt oder aber zurückhält und wie dies die Empathie für bestimmte Figuren beeinflussen kann.[80]
Ebenfalls hilfreich im Literaturunterricht kann Stanzels Modell der Erzählsituationen sein, denn es dient der Bewusstmachung. Didaktische Ansätze sollten darauf abzielen den Schüler*innen die Relevanz der Erzählsituationen für ihr eigenes Leseverständnis bewusst zu machen. Die Wahl der entsprechenden Erzählsituation beeinflusst die Distanz der Leser*innen zur Handlung und damit auch das Potential zur Empathiebildung und Perspektivübernahme. Die Analyse der Erzählsituation hilft zu verstehen, wie das Geschehen von dem bzw. der Erzähler*in darstellt und bewertet wird. Zum Beispiel kann eine auktoriale Erzählsituation den Leser*innen einen Überblick verschaffen, während eine Ich-Erzählung eine subjektive Sichtweise vermittelt.[81]
Schmidts Unterscheidung zwischen narratorialer und figuraler Perspektive liefert ebenfalls Potentiale zur Reflexion . Seine Unterscheidung zwischen der narratorialen (Erzähler*innen-) und der figuralen (Figuren-) Perspektive trägt dazu bei, kritische Reflexionsprozesse im Literaturunterricht anzustoßen. Schüler*innen sollen demnach dazu befähigt werden, zu erkennen, dass Figuren nicht zwangsläufig eigene Perspektiven im Sinne einer Weltanschauung haben müssen, sondern dass ihre Reden vom Erzähler (oder der Erzählerin) verwendet werden können. Diese Unterscheidung kann dazu führen, dass Schüler*innen die Konstruktion von Figuren und ihrer Perspektiven kritischer betrachten.[82]
Durch die bewusste Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Perspektiven, wie sie von Nünning und Nünning beschrieben wird, kann der Perspektivwechsel gezielt gefördert werden.[83] Eine Analyse der Perspektivenstruktur nach Nünning/Nünning stärkt damit die Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit literarischen Figuren und deren Sichtweisen.[84] Sie hilft, die Beziehungen zwischen den verschiedenen Perspektiven zu verstehen und die Subjektivität der jeweiligen Sichtweisen zu erkennen. Die Interaktion zwischen Text und Leser*innen ist dabei zentral, da die Leser*innen die Perspektiven in Beziehung setzen und so die Struktur realisieren.[85]
Durch die Reflexion der eigenen Reaktionen auf den Text können Schüler*innen sich der Rezeptionslenkung bewusstwerden, also der Art und Weise, wie Textelemente die Leser*innen beeinflussen können.[86] Dieses Zusammenspiel aller Figurenperspektiven und außerperspektiven Signalen kann auch Leser*innen-Perspektive genannt werden. [87]
2.4 Ziele von Perspektivübernahme und Empathiebildung im Literaturunterricht der SEK II
Die Förderung von Perspektivübernahme und Empathiebildung werden im Literaturunterricht der SEK II dem Bildungsziel des literarischen Lernens untergeordnet. Die Zuordnung zum Lehrgegenstand des literarischen Lernens basiert auf den elf Aspekten literarischen Lernens nach Spinner. Dieser definiert in einem der elf Punkte die Fähigkeit, Perspektiven literarischer Figuren nachzuvollziehen, als eine zentrale Kompetenz.73 Die Übernahme von verschiedenen literarischen Perspektiven kann es den Lernenden ermöglichen, fremde Erfahrungsweisen zu verstehen und diverse Sichtweisen zu erkennen und diese in ein Verhältnis miteinander zu setzen.74 Dieser Prozess kann sowohl mitfühlende Empathie, als auch die kognitive Auseinandersetzung mit Fremdheit beinhalten.75 Aus diesem Grund, ist die Perspektivübernahme eng mit der Überwindung egozentrischer Sichtweisen verbunden und somit fundamental für die Entwicklung eines moralischen Urteils und das Empfinden von Empathie.76 Spinner verortet die Perspektivübernahme explizit im genuin literarischen Bereich, der über pragmatische Anforderungen hinausgeht und ästhetisches sowie kulturelles Lernen fördert.77 Die Auseinandersetzung mit Perspektiven literarischer Figuren kann den Schüler*innen dabei helfen, sich auf die Unabschließbarkeit des Sinnbildungsprozesses einzulassen und mit der potentiellen Offenheit und Mehrdeutigkeit literarischer Texte umzugehen.78 Ebenfalls ein wichtiger Bestandteil literarischer Verstehensprozesse ist die Empathie, das Mitfühlen mit anderen, um literarische Texte adäquat lesen und verstehen zu können.79 Die Erzeugung von Empathie ist ein wesentlicher Aspekt von Literarizität. Sie ist eine Form der emotionalen Beteiligung beim Lesen, die jedoch eine gewisse Immersiondistanz wahrt.80
Die Fusion aus Empathie, Perspektivübernahme und Argumentation ist ein besonderes Merkmal des Literaturunterrichts. Sie ermöglicht die differenziertere Auseinandersetzung mit moralischen Konflikten, durch subjektive Involviertheit.[96] Das Verhandeln und Abwägen zwischen eigenen und fremden Perspektiven wird damit zur Voraussetzung für ein umfassendes literarisches Verstehen.[97]
Um literarisches Lernen im Sinne von Spinner zu fördern, sollte der Literaturunterricht darauf abzielen, sowohl die Perspektivübernahme als auch die Empathiebildung zu unterstützen. Dies kann durch den Einsatz von Texten geschehen, die einerseits zur Identifikation einladen und andererseits zur Reflexion anregen. Die methodische Gestaltung sollte eine Balance zwischen emotionaler Involviertheit und kognitiver Reflexion ermöglichen und Schüler*innen dabei unterstützen, von einer bloßen Identifikation zu einer reflektierten Perspektivübernahme zu gelangen.[98] Die empfundene literarische Empathie kann das Verständnis für andere Kulturen und Lebensweisen fördern, indem sie eine Perspektivübernahme ermöglicht und damit den interkulturellen Kompetenzerwerb der Schüler*innen fördert. Es wird das Potential entfaltet, während des Lesens Vorurteile und Stereotypen abzubauen und eine offenere Haltung gegenüber dem Fremden zu entwickeln.[99] Damit wird ebenfalls ein Fundament für ein intersektionales Lesen geschaffen. Das Erkennen von Mehrfachzugehörigkeiten (Ethnizität, Religion, Gender, Klasse) liefert Potential für ein differenzierteres Verständnis von Figuren und ihren Handlungen und damit auch für mehr Sensibilität im Umgang mit realen gesellschaftlichen Problemen.[100]
Die von der Kultusministerkonferenz verabschiedeten Bildungsstandards für das Fach Deutsch unterstützen die Ansicht der Bedeutsamkeit von Perspektivübernahme und Empathiebildung, indem sie diese Fähigkeiten als zentrale Kompetenzen für den Umgang mit Texten und Medien sowie für die individuelle persönliche Entwicklung hervorheben.[101] Sie setzen auf die sprachlichen, kommunikativen und ästhetischen Kompetenzen der Schüler*innen. Perspektivübernahme und Empathiebildung können den Domänen „sich mit Texten und Medien auseinandersetzen“ und „Lesen“ zugeordnet werden, welche wiederum die Entwicklung prozessbezogener Kompetenzen fördern können.[102]
Im Kompetenzbereich „Lesen - mit Texten und Medien umgehen“ des niedersächsischen Kerncurriculums für die gymnasiale Oberstufe wird die Fähigkeit, Perspektiven literarischer Figuren nachzuvollziehen, explizit hervorgehoben.81 Eine gewisse KompetenzOrientierung wird deutlich. Der Begriff „kompetenzorientierter Deutschunterricht“ markiert damit einen Paradigmenwechsel in der fachdidaktischen Diskussion. Im kompetenzorientierten Unterricht geht es darum, sprachliche und literarische Kompetenzen zu definieren und deren Erwerb zu fördern.82 Spinner hat die Perspektivübernahme und das Perspektivverstehen als zentrale Bestandteile literarischer Kompetenz in die vorherrschende Kompetenzdebatte eingebracht.83 Die Schüler*innen sollen also konkret, die Fähigkeit zur reflektierten Perspektivübernahme entwickeln, indem sie literarische Texte analysieren, die zur Identifikation und Reflexion anregen. Sie sollen lernen, die Perspektiven literarischer Figuren zu erkennen, zu interpretieren und mit ihrer eigenen Sichtweise zu vergleichen. Dabei wird eine Balance zwischen emotionaler Involviertheit und kognitiver Reflexion angestrebt, um sie von einer bloßen Identifikation zu einer bewussten Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Perspektiven zu führen.84 Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Textsorten und Medien kann das Potential zur Perspektivübernahme und Empathiebildung zusätzlich fördern.85
Die Förderung von Perspektivübernahme und Empathiebildung in der SEK II (Niedersachsen) lässt sich durch das Kerncurriculum legitimieren, da diese Fähigkeiten als zentrale Bestandteile literarischer Kompetenz und als wichtige Ziele des Deutschunterrichts verankert sind. Das Kerncurriculum betont die Auseinandersetzung mit Texten und Medien, die das Verstehen unterschiedlicher Perspektiven einschließt, und fordert die Fähigkeit, sich in die Perspektiven literarischer Figuren hineinzuversetzen.86
Konkret heißt es:
„Die Auseinandersetzung mit literarischen Texten ermöglicht Einblicke in Grundmuster menschlicher Erfahrungen und eröffnet Zugänge zu verschiedenen Weltsichten - auch in interkultureller Perspektive. Damit leistet der Deutschunterricht einen fachspezifischen Beitrag zum Verstehen fremder und zur Ausbildung eigener Identität - auch im Hinblick auf die Vielfalt sexueller Identitäten - und trägt auf diese Weise wesentlich zur Persönlichkeitsentwicklung bei.“87
Die Schüler*innen sollen sich also mit verschiedenen Perspektiven auseinandersetzen, indem sie literarische Texte analysieren, die zur Identifikation und Reflexion anregen. Die Textauswahl soll an ihre individuellen Voraussetzungen angepasst werden, um eine aktive und differenzierte Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Sichtweisen zu fördern.88 Zusammenfassend können demnach folgende Zielsetzungen für Perspektivübernahme und Empathiebildung im Literaturunterricht der SEK II genannt werden:
- Förderung des Textverständnisses: Indem sich Schüler*innen in die Figuren hineinversetzen und deren Perspektiven einnehmen, können sie Handlungsmotive, Konflikte und Beziehungen besser nachvollziehen.89
- Entwicklung literarischer Kompetenzen: Dies beinhaltet auch die Fähigkeit, Erzählperspektiven zu erkennen, zu verstehen und deren Einfluss auf die Rezeption zu reflektieren.90
- Reflexion eigener Erfahrungen und Überzeugungen: Durch die Auseinandersetzung mit literarischen Figuren und deren Perspektiven werden Schüler*innen angeregt, ihre eigenen Erfahrungen, Überzeugungen und Weltanschauungen zu reflektieren.91
- Erweiterung des Weltwissens: Die Lektüre literarischer Texte ermöglicht Einblicke in verschiedene gesellschaftliche, kulturelle und historische Kontexte.92
- Förderung von Empathie und sozialer Kompetenz: Durch den Literaturunterricht können Schüler*innen diese Fähigkeit trainieren und ihre soziale Handlungsfähigkeit erweitern.93
Durch die Umsetzung dieser Zielsetzungen kann sich nicht nur das Potential zur literarischen Entwicklung, sondern auch zur persönlichen Entwicklung der Schüler*innen entfalten. Die Auseinandersetzung mit literarischen Figuren, ihren Konflikten und Entscheidungen fördert die Persönlichkeitsbildung der Schüler*innen.94
2.5 Kompetenzorientierte Förderung von Perspektivübernahme und Empathiebildung
Methoden zur Förderung von Perspektivübernahme und Empathiebildung berücksichtigen sowohl kognitive als auch emotionale Aspekte des Textverstehens und regen zu einer aktiven Auseinandersetzung mit literarischen Texten an. Dabei wird oft ein methodenintegrativer Ansatz verfolgt, der verschiedene Zugänge miteinander verbindet. Als zentraler Bereich können dabei die handlungs- und produktionsorientierten Verfahren genannt werden, die auf eine emotionale und motivationsfördernde Beschäftigung mit dem Text abzielen.95 Dazu gehört unteranderem das kreative Schreiben, bei dem Schüler*innen beispielsweise Tagebucheinträge, Briefe oder innere Monologe aus der Sicht einer literarischen Figur verfassen. Solche Aufgaben können es ermöglichen, in die Gedanken- und Gefühlswelt der Figuren einzutauchen und Empathie zu entwickeln.96 Auch szenische Verfahren, wie Rollenspiele, in denen Schüler*innen Figuren verkörpern und deren Perspektiven einnehmen, können dazu beitragen, ein tieferes Verständnis für die Innenperspektive der Figuren zu gewinnen.97 Eine weitere Methode ist das Füllen von Kohärenzlücken, bei dem Schüler*innen fehlende Informationen im Text aus der Sicht einer bestimmten Figur ergänzen, um so deren Perspektive besser verstehen zu können.98
Eine Ergänzung zu den handlungs- und produktionsorientierten Verfahren stellen die analytischen Verfahren dar, die ein tieferes Verständnis der Textstrukturen und der Perspektivgestaltung anstreben.99
Dazu gehört beispielsweise die Analyse der Erzählperspektive, bei der die Funktion und der Einfluss der Erzählinstanz auf die Darstellung der Figuren und Ereignisse untersucht werden.100 Ebenso wichtig ist die Analyse der Figurenperspektiven, bei der die Gedanken, Gefühle und Motive der einzelnen Figuren identifiziert werden.101 Auch die Analyse der sprachlichen und stilistischen Mittel, wie Metaphern oder innere Monologe, sowie die Analyse der Sympathielenkung, die untersucht, wie der Text Sympathie oder Antipathie für bestimmte Figuren erzeugt, sind relevant und entfalten somit Potential zur Perspektivübernahme und Empathiebildung.102
Des Weiteren können gesprächsdidaktische Verfahren eine wichtige Rolle spielen. Durch gezielte Diskussionen über unterschiedliche Perspektiven im Text können Schüler*innen zur Reflexion angeregt werden.103 Die sogenannte Dialogdidaktik fördert dabei ihr Potential zur kritischen Reflexion von Deutungshoheiten und zur Förderung von Gesprächskompetenz.104 Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Methodenintegration, die eine Kombination verschiedener Methoden vorsieht, um ein umfassendes Perspektivverstehen zu ermöglichen.105 So schlägt Kloppert beispielsweise einen methodischen Dreischritt vor, der mit handlungs- und produktionsorientierten Verfahren beginnt, zur Kognitivierung übergeht und mit einer abschließenden Analyse endet. Dieser Dreischritt soll den Übergang von einem emotionalen Perspektiverleben zu einem kognitiven Perspektivverstehen unterstützen.106
Eine weitere relevante Methode ist die Reflexion des eigenen Leseprozesses. Diese kann das Bewusstsein dafür schärfen, wie eigene Gefühle und Gedanken die Interpretation eines Textes beeinflussen können.107 Die Verwendung von konkreten Leitfragen, die sowohl textseitige Merkmale als auch subjektive Wirkungen berücksichtigen, können die Auseinandersetzung mit Perspektiven vertiefen.108
Eine Kombination mit einem intersektionalen Ansatz kann gewinnbringend sein, indem Figuren unter Berücksichtigung ihrer Mehrfachzugehörigkeiten analysiert werden, um ein differenziertes Verständnis ihrer Perspektiven zu entwickeln.109
Die beschriebenen Methoden zur Förderung von Perspektivübernahme und Empathie sind eng mit den Prinzipien der Kompetenzorientierung und den Bildungsstandards im Fach Deutsch verknüpft. Die Förderung von Perspektivübernahme und Empathie berührt mehrere Kompetenzbereiche der Bildungsstandards. Die Fähigkeit, Perspektiven zu übernehmen, ist eine zentrale Voraussetzung für das Textverständnis und damit dem Kompetenzbereich des Lesens zugeordnet.110 Schülerinnen sollen in der Lage sein, literarische und pragmatische Texte zu erschließen und ein differenziertes Textverständnis zu entwickeln.111 Die Methoden der Textanalyse, wie die Untersuchung von Erzählperspektiven und Figurenperspektiven, unterstützen diese Kompetenz. Die in den Bildungsstandards geforderte Fähigkeit, Mehrdeutigkeit als konstitutives Merkmal literarischer Texte zu erkennen, kann ebenfalls durch die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Perspektiven gefördert werden.112 Die geforderte Fähigkeit, Texte adressatengerecht und stilistisch angemessen zu verfassen, kann gefördert werden, indem die Schülerinnen lernen, aus der Perspektive einer Figur zu schreiben oder eigene Sichtweisen in Bezug auf die Thematik des Textes zu entwickeln.113 Die Auseinandersetzung mit Sprache als einem System und als einem historisch gewordenen Kommunikationsmedium, sowie die Analyse von Sprachvarietäten, kann durch die Analyse der sprachlichen und stilistischen Mittel in Texten in Hinblick auf die Perspektivgestaltung gefördert werden. Die Analyse der Bedingungen gelingender Kommunikation kann durch die Reflexion von Kommunikationssituationen im Text und deren Perspektivgebundenheit unterstützt werden.114
Ein kompetenzorientierter Unterricht legt dabei besonderen Wert auf die individuelle Förderung der Schülerinnen und auf die Entwicklung von Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit. Die hier genannten Methoden bieten vielfältige Möglichkeiten, um den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und -bedürfnissen gerecht zu werden.115 In den von der Kultusministerkonferenz verabschiedeten Bildungsstandards für das Fach Deutsch heißt es konkret: „Der Kompetenzerwerb soll im Sinne kumulativen Lernens vernetzt erfolgen. Die Reihenfolge der Bildungsstandards ist daher nicht als Abbildung einer möglichen Chronologie des Kompetenzaufbaus aufzufassen.“ 116
Die Integration verschiedener Methoden kann es den Schülerinnen ermöglichen, unterschiedliche Zugänge zum Text zu eröffnen und sowohl kognitive als auch emotionale Aspekte des Textverstehens zu berücksichtigen.117 Die Aufgaben in einem kompetenzorientierten Unterricht sollen so gestaltet sein, dass sie die Schülerinnen dazu anregen, selbstständig zu lernen, zu forschen und zu gestalten. Komplexe Lernaufgaben sollen darauf abzielen, die Steuerung der Aufgabenbearbeitung auf die Lernenden zu übertragen.118 Es gilt zu vermeiden, dass Empathie in eine unreflektierte Identifikation umschlägt. Um dies zu umgehen, ist es elementar, ein Bewusstsein für die Unterscheidung zwischen eigenen und fremden Emotionen zu schaffen. Seyler betont deshalb eindeutig, dass literarische Empathie als ein reflektierter Prozess betrachtet werden muss, der das Nachvollziehen von Gefühlen im Kontext beinhaltet, ohne die Grenze zur eigenen Identität zu verwischen.119 Um dieses Bewusstsein zu erlangen, kann die Förderung von Distanzierung hilfreich sein. Anstelle einer unreflektierten Identifikation soll eine beobachtende Haltung eingenommen werden, die es ermöglicht, die Figuren und ihre Handlungen kritisch zu bewerten.120
Schülerinnen sollten außerdem dazu angehalten werden, ihre eigenen Wertvorstellungen und ihren Erfahrungshintergrund zu reflektieren, um zu erkennen, wie diese ihre Wahrnehmung und Interpretation von Texten beeinflussen können.121 Dabei ist eine stärkere kognitive Auseinandersetzung mit dem Text essenziell, um eine unreflektierte Identifikation zu vermeiden. Die, bereits mehrfach erwähnte, Analyse der Erzählperspektive, der Figurenperspektiven und der Sympathielenkung im Text ermöglicht es, die Perspektiven nicht nur emotional zu erfassen, sondern auch in ihrem Kontext zu verstehen.122 Die Einführung des Konzepts der Ekpathie nach Olsen, als Gegenbewegung zur Empathie, kann dazu beitragen, normierende Prozesse zu hinterfragen und eine distanzierte Auseinandersetzung mit den Figuren zu fördern.123
Um verschiedene literarische Perspektiven innerhalb eines Textes zu hinterfragen, ist es generell entscheidend, die Vielschichtigkeit und potenzielle Widersprüchlichkeit von literarischen Perspektiven zu thematisieren.124 Die Schülerinnen sollten dazu angeleitet werden, die Perspektivenstruktur eines Textes zu analysieren, d. h. zu erkennen, welche Perspektiven im Text vorhanden sind, wie sie zueinander in Beziehung stehen und welche Funktion sie erfüllen.125 Hilfreich kann es sein, Interpretationen zu diskutieren. Durch den Austausch über unterschiedliche Interpretationen können Schülerinnen erkennen, dass es nicht nur eine gültige Perspektive gibt und ihre eigenen Interpretationen kritisch hinterfragen.126 Außerdem sollte bei Analysen und Interpretationen der jeweilige historische Kontext berücksichtigt werden.127 Eine Auseinandersetzung mit den in Texten dargestellten Machtverhältnissen kann Schülerinnen darüber hinaus dafür sensibilisieren, wie bestimmte Perspektiven privilegiert werden und andere marginalisiert werden. „Eine diversitätsorientierte Deutschdidaktik fragt also danach, wie eine häufig (unbeabsichtigt) pauschalisierende Unterscheidung in eine Normgruppe und eine Gruppe der von der Norm Abweichenden vermieden werden kann. “ 128
Ein intersektionaler Ansatz kann hierbei helfen, die Verschränkung verschiedener Kategorien wie Gender, Race129 und soziale Herkunft zu berücksichtigen.130 Um Schülerinnen beim Wechsel zwischen eigener und fremder Perspektive zu unterstützen, ist es wichtig, Übergänge zwischen den Perspektiven zu ermöglichen und diese explizit zu thematisieren.131 Aufgaben, die einen Perspektivwechsel erfordern, können dazu beitragen, die Fähigkeit zur Perspektivübernahme zu trainieren. Hierzu zählen Aufgaben, in denen Schülerinnen z. B. aus der Sicht einer anderen Figur schreiben, oder in denen sie die gleiche Situation aus verschiedenen Perspektiven darstellen.132 Seyler betont außerdem das Potential von Gesprächsstrategien, die dazu anregen, die Perspektive anderer zu berücksichtigen und nachzufragen ("Kannst du mehr darüber sagen?", "Wie würde Figur A die Figur B sehen?").133 Nach der Auseinandersetzung mit einer fremden Perspektive sollte es eine Reflexionsphase geben, in der Schülerinnen dazu aufgefordert werden, ihren eigenen Standpunkt wieder einzunehmen und sich zu der vorher eingenommenen fremden Perspektive zu positionieren.134
Wenn man über die potentielle Förderung von Perspektivübernahme und Empathiebildung spricht, darf die zentrale Rolle der Lehrkraft in diesem Zuge nicht vergessen werden zu erwähnen.135 Die Lehrkraft sollte Diskussionen so moderieren, dass sie unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt und die Schüler*innen dazu anregt, ihre eigenen Ansichten zu hinterfragen.136 Sie kann außerdem als Vorbild dienen, indem sie selbst eine reflektierte und differenzierte Haltung gegenüber unterschiedlichen Perspektiven einnimmt.137 Dabei darf und soll die Lehrkraft auch eigene Meinungen einbringen, diese aber nicht als die einzig richtige Meinung darstellen, sondern als eine von vielen Perspektiven, die zum Nachdenken anregen sollen.138 Für Lehrkräfte gilt es also zusammenfassend, die eigene pädagogische Haltung und die eigenen unbewussten Homogenisierungstendenzen zu reflektieren, um eine Stigmatisierung von Schüler*innen zu vermeiden.139
3. Romananalyse
Die nachfolgenden Unterkapitel widmen sich der detaillierten Analyse von Mareike Fallwickls Roman „Und alle so still“, um zu untersuchen, wie literarische Perspektivübernahme und das Potential zur Empathiebildung narrativ gestaltet wird und welche didaktischen Potentiale sich daraus für den Literaturunterricht ergeben. Dabei stehen insbesondere die Figurenperspektiven, die Erzählstruktur und die narrativen Mittel im Fokus der Betrachtung, da sie zentrale Elemente für die Förderung von Empathiebildung und kritischer Reflexion darstellen. Die Auswahl von „Und alle so still“ als beispielhaftes Werk folgt mehreren Kriterien: Zum einen bietet der Roman eine hochgradige Relevanz für die Forschungsfrage, da er konsequent mit multiperspektivischen Erzählweisen arbeitet und seine Leser*innen dazu auffordert, sich mit verschiedenen Stimmen und Wahrnehmungen auseinanderzusetzen. Zum anderen steht er repräsentativ für eine zeitgenössische Literatur, die gesellschaftliche Machtverhältnisse und soziale Dynamiken kritisch reflektiert. Fallwickl stellt Fragen nach Geschlechterrollen, medialer Gewalt und Unsichtbarkeit im öffentlichen Diskurs, Themen, die für die Lebenswelt heutiger Schüler*innen von hoher Bedeutung sind. Darüber hinaus zeichnet sich der Roman durch eine besondere Vielfalt an Perspektiven aus. Durch den Wechsel zwischen den Protagonist*innen Elin, Nuri und Ruth entstehen drei verschiedene Blickwinkel auf Themen wie digitale Selbstinszenierung, Ausbeutung durch Arbeit und soziale Isolation durch Migration.
Inhaltlich erzählt „Und alle so still“ von drei Figuren, deren Leben sich zunächst nur lose überschneiden, die jedoch durch ähnliche Erfahrungen von Unsichtbarkeit, Ausgrenzung und Anpassungsdruck miteinander verbunden sind. Elin, eine erfolgreiche Influencerin, die sich der feindseligen Dynamik sozialer Medien ausgesetzt sieht. Nuri, ein Mann mit Migrationsgeschichte, der im System immer wechselnder prekärer Arbeitsbedingungen und struktureller Diskriminierung um Anerkennung kämpft. Und als Dritte, Ruth, eine ältere Pflegekraft, die von ihrer Umgebung zunehmend übersehen wird. Während Elin durch ihren digitalen Bekanntheitsgrad in der öffentlichen Wahrnehmung permanent sichtbar ist, leidet sie unter aggressivem Online-Hass. Nuri wiederum erfährt soziale Unsichtbarkeit aufgrund seiner Migrationsgeschichte, während Ruths jahrzehntelange bezahlte und unbezahlte Arbeit durch das System selbst entwertet wird. Diese Figuren stehen exemplarisch für verschiedene Formen von gesellschaftlicher Marginalisierung, wodurch der Roman eine vielschichtige Auseinandersetzung mit Fragen von Macht, Identität und sozialer Anerkennung eröffnet.
Die folgenden Kapitel greifen diese Aspekte gezielt auf: Kapitel 3.1 untersucht die Figurenkonstellationen und deren Perspektivstruktur, wobei insbesondere die Wirkung von Perspektivwechseln auf die Leser*innen analysiert wird. Kapitel 3.2 widmet sich den narrativen Mitteln des Romans und betrachtet, inwiefern die Erzähltechnik gezielt eingesetzt wird, um Perspektivübernahme und kritische Reflexion anzuregen. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen anschließend als Grundlage für die didaktische Übertragung in Kapitel 4, welches konkrete didaktische Ideen skizziert.
3.1 Figurenanalyse und Perspektivstruktur
Ein zentrales Merkmal von „Und alle so still“ ist die vielschichtige Figurenkonstellation, die durch unterschiedliche Perspektiven und narrative Strategien komplexe Beziehungsgeflechte sichtbar macht. Die Art und Weise, wie die Figuren miteinander agieren, welche Sichtweisen sie auf sich selbst und auf andere entwickeln und welche Erfahrungen sie prägen, trägt maßgeblich zur Gestaltung der erzählerischen Perspektivstruktur bei. Im folgenden Abschnitt wird die Figurenkonstellation genauer untersucht, um herauszuarbeiten, welche Perspektiven in den Roman eingebettet sind und wie diese zur Förderung von Empathie und Perspektivübernahme beitragen.
3.1.1 Untersuchung der Figurenkonstellationen und deren Perspektiven
Fallwickls „Und alle so still“ ist lässt sich als multiperspektivischer Text, gemäß Nünning & Nünnings Konzept der Multiperspektivität, betrachten. Im deutschsprachigen Raum sind multiperspektivische Texte bislang noch nicht allzu sehr verbreitet. Als Vorreiter*innen benennen Nünning und Nünning beispielsweise Virginia Woolf oder Aldous Huxley.140 Definitionen zum multiperspektivischen Erzählen gehen in der Regel auf Neuhaus zurück, der Multiperspektivität in ihren Pionierstunden folgendermaßen definierte:
„ Unter dem Begriff multiperspektivisches Erzählen sollen diejenigen Romane und Erzählungen zusammengefasst werden, in denen sich ein Autor nebeneinander mehrerer Erzählperspektiven bedient, um ein Geschehen wiederzugeben, einen Menschen zu schildern, eine bestimmte Epoche darzustellen oder dergleichen. “141
Im Verlauf der Analyse soll sich auf Surkamps Erweiterung des Konzeptes gestützt werden. Sie definiert den Begriff der Perspektive nicht nur werkimmanent, sondern auch rezeptionsund produktionsästhetisch und betont, dass literarische Figuren als Träger*innen von Perspektiven fungieren, deren Sichtweisen entscheidend durch kulturelle, soziale und persönliche Faktoren geprägt sind. Diese Faktoren umfassen Aspekte wie Alter, Bildungsstand, Religion, Geschlecht, sexuelle Orientierung sowie kulturelle und ethnische Identität. Die Perspektiven einer literarischen Figur bilden ein komplexes Wirklichkeitsmodell, das sowohl innere Dispositionen (z. B. psychische Verfassung, Werte, Deutungsmuster) als auch äußere Bedingungen (z. B. biografischer Hintergrund, situativer Kontext) integriert. Dieses Wirklichkeitsmodell bestimmt die Handlungen, Motivationen und Bedürfnisse der Figuren und macht sie zu Repräsentant*innen des gesellschaftlichen Kontextes, in den ein Text eingebettet ist.142
Der Roman nutzt nicht nur die personalen Erzählperspektiven der drei zentralen Figuren Elin, Nuri und Ruth, sondern erweitert das Spektrum um unkonventionelle Perspektivträger: die Gebärmutter, die Pistole und die Berichterstattung. Diese Erzählweise kann nicht nur eine tiefere emotionale und kognitive Auseinandersetzung mit den dargestellten Themen schaffen, sondern kann die Leser*innen auch herausfordern, ihre eigene Wahrnehmung zu hinterfragen. Die klassischen Figurenperspektiven ermöglichen den Einblick in sehr unterschiedliche Lebenswelten.
Elins Perspektive ist die einer jungen Influencerin. Ihre Wahrnehmung ist stark durch die digitale Welt geprägt und den dort vorherrschenden Hass geprägt. Elin erlebt die Welt durch die Linse sozialer Medien, in denen Körper und Identität zur Ware werden: „ Wenn ich mich selbst im Internet sehe, auf den Fotos, bin ich ein Bild, verstehst du, eine Fläche. Und die ist etwas wert. Die kann verkauft werden, zu einem bestimmten Preis “143. Der Bewusstseinsakt, sich selbst als „Bild“ zu sehen, wird mit der Erkenntnis verknüpft, dass diese Bilder - und damit die Frauen dahinter - einem prekären Marktmechanismus unterworfen sind, der Scham und Konsum als Kontrollinstrumente einsetzt. Elins Charakter ist geprägt von Einsamkeit und Unsicherheit. Sie hinterfragt die Rolle, die ihr als Frau zugeschrieben wird. Elin ist unsicher, ob sie Teil des Protests werden soll. Sie bewundert die Frauen, die sich auf der Straße niederlegen, empfindet aber auch Angst vor diesem radikalen Schritt. Im Verlauf der Handlung schwankt sie zwischen Aktion und Passivität, zwischen dem Wunsch nach Veränderung und dem Festhalten an alten Strukturen.
Ein möglicher Grund für Elins Unsicherheit könnte ihr Verhältnis zu ihrer Mutter sein, die überzeugte Feministin alter Schule ist:
„Und im Unabhängigsein ist sie die Beste. Für die Zeugung ihrer Tochter hat sie keinen Mann gebraucht, auch später nie. Manchmal fährt sie über Nacht weg, aber sie erzählt Elin nicht, bei wem sie war, Männer sind für Alma nicht der Rede wert. Frauen auch nicht“144
Hier wird ein alternatives Modell weiblicher Identität gezeichnet, in dem Abhängigkeiten von männlichen Partnern - und sogar von anderen Frauen - als entbehrlich gelten. Alma (Nebenfigur) wird als Inhaberin ihrer eigenen Geschichte und Sexualität dargestellt. Dies steht im klaren Kontrast zu traditionellen, patriarchal geprägten Erzählungen, in denen die Legitimation weiblicher Selbstverwirklichung oft an männliche Anerkennung gekoppelt ist.
Die zweite Figurenperspektive ist die von Nuri. Nuri kämpft mit den Erwartungen an Männlichkeit und seinem prekären sozialen Status. Er will sich von traditionellen Geschlechterbildern distanzieren, doch in der Realität fällt ihm das schwer: „ Nuri hat sich geschworen, dass er nicht einer von denen sein wird, die auf Titten glotzen und mit dem Schwanz denken “145. Doch seine Konditionierung als Mann, seine Unsicherheit und seine Einsamkeit lassen ihn immer wieder in stereotype Verhaltensweisen zurückfallen. Seine Lebensrealität ist geprägt von Armut und sozialer Ausgrenzung. Seine Mutter, die einst nach Europa kam, beschreibt er selbst als Frau, die ihre Sprache verloren hat: „Für Nuri ist seine Mutter sprachenlos, eine Singsangfrau, die viel plappert, aber für das, was sie sagen will, keine Worte hat“146 . Diese Entwurzelung spiegelt sich in Nuris eigener Identitätskrise wider. Er fühlt sich weder hier noch dort zugehörig und bleibt stets ein Außenseiter. Denkt man in Wellen des Feminismus, ordnet sich Nuri innerhalb der vierten Welle des Feminismus ein, die in der Forschung noch relativ neu scheint. Die vierte Welle des Feminismus ist die der Internet-Bewegungen, wie beispielsweise der #meetoo-Kampagne. Die Welle versucht seit 2012, intersektional ausgelegt sowohl Frauen als auch Männer dazu zu bewegen, sich feministisch aktiv zu zeigen.147
Die dritte Hauptfigur, Ruth, ist eine Frau, die ihr Leben lang für andere gesorgt hat - für ihren verstorbenen Sohn, für ihre Patient*innen, für ihre Familie. Sie hat nie gelernt, für sich selbst zu kämpfen. Doch ihre Erschöpfung ist allgegenwärtig:
„ Irgendwann war einfach klar, auf Ruth wartet niemand, Ruth springt immer ein, Ruth arbeitet an Weihnachten und an Silvester, Ruth fährt nicht in den Urlaub“148 . Der im Roman thematisierte Protest trifft sie an einem Punkt, an dem sie ohnehin nicht mehr weitermachen kann. Zunächst ist sie skeptisch, ob die Aktion etwas bewirken kann, doch als sie sieht, wie die Frauen sich solidarisieren, beginnt sie, ihre eigene Rolle zu hinterfragen. Besonders hervorzuheben ist dabei der Moment, in dem sie begreift, dass ihre eigene Mutter unter den streikenden Frauen ist: „Bis ihr beim Blick aus dem Fenster oben im dritten Stock klar geworden ist, dass ihre Mutter unter den Frauen war“149 . Dieser Moment der Erkenntnis verbindet persönliche und politische Ebene und zeigt, dass patriarchale Strukturen über Generationen hinweg fortbestehen und verbindet erstmals die verschiedenen Wellen des Feminismus.
Diese drei Perspektiven bieten einen Einblick in gesellschaftliche Schieflagen, doch Fallwickl geht noch weiter und ergänzt nicht-menschliche Erzählinstanzen. Die Gebärmutter übernimmt beispielsweise eine metaphorische und zugleich körperliche Stimme, die das Frausein als biologische und gesellschaftliche Erfahrung beschreibt:
„Sie sind von mir besessen, und das liegt daran, dass ihre Schwänze zu kurz sind. Let me explain. Sie können mich damit fast erreichen, können an mich ranbumsen und freuen sich, dass sie die Vagina ausfüllen, bis an meinen Mund. Das tut weh, und werden sie darauf hingewiesen, hören sie vielleicht auf, murmeln eine Entschuldigung und haben diese Unbefriedigung. Weil es etwas gibt im Körper, der einen Uterus hat, etwas, das verborgen ist und ein Geheimnis und der Ursprung. Sie wollen es besitzen, es beherrschen, und weil ihre Schwänze zu kurz sind, kommen sie mit Papier und Stift, mit Gesetzen und Regeln. Oder mit Religion. Ich bin die Gebärmutter, mich verbinden sie mit Weiblichkeit. Über alles, was mit mir geschieht, entscheiden Männer.“150
Die Gebärmutter als eine eigene Perspektive nutzt schockierende, direkte Bildsprache, um patriarchale Machtstrukturen zu kritisieren. Eine solche ungewöhnliche Perspektive kann eine starke emotionale Verankerung schaffen, indem sie den Körper selbst als Zeugnis von Unterdrückung und Widerstand sprechen lässt. Die Pistole bildet die zweite nichtmenschliche Erzählinstanz. Diese Perspektive entmenschlicht die Gewalt, die im Verlauf des Romans eskaliert, und zeigt, wie Waffen eine fatale Eigendynamik entwickeln.
Ähnlich entfremdet ist die Berichterstattung, die mit journalistischer Distanz über den Protest berichtet und damit verdeutlicht, wie mediale Darstellungen gesellschaftliche Wahrnehmungen formen und manipulieren können:
„Immer habt ihr entschieden, was erzählt wird und was nicht, habt nur die halbe Wahrheit gezeigt und in die andere Richtung geschaut, Ströme aus Flüchtenden, Klimakrise, Zwangsprostitution, korrupte Politiker, Femizide, ihr habt versucht, die Scheiße zu vertuschen, an der ihr schuld wart. Ich entziehe euch hiermit jede Befugnis. Ich übernehme selbst, denn es ist meine Pflicht, demokratische Werte zu verteidigen, das ist mein Sinn und Zweck. Die Idee, dass Menschen gleichberechtigt zusammenleben, ist kein neutrales Projekt, sie braucht Unterstützung von allen Seiten. Ich bin die vierte Gewalt, die für jene einsteht, deren Rechte angegriffen werden. Ihr habt mich missbraucht. Ihr habt behauptet, mich neutral zu verwenden, und habt in Wahrheit eure misogynen, rassistischen, diskriminierenden Filter über jeden Artikel, jede Dokumentation, jedes Interview gelegt. In der gesamten Geschichtsschreibung habt ihr nichts jemals so erzählt, wie es gewesen ist. Sondern so, wie es eurem System dienlich war. Damit ist jetzt Schluss. Es hat in einer Stadt angefangen, und eigentlich hat es überall gleichzeitig angefangen. Aber so was könnt ihr ja schlecht, nicht wahr. Anfänge bemerken.“151
Fallwickls „Und alle so still“ erfüllt damit gleich mehrere der von Nünning & Nünning definierten Merkmale für Multiperspektivität und kann daher als ein multiperspektivischer Roman eingeordnet werden. Zunächst trifft auf den Roman die zweite Grundform der Multiperspektivität zu, nämlich die multiperspektivische Fokalisierung. Die erzählte Handlung wird aus den Blickwinkeln von mindestens drei Reflektorfiguren - Elin, Nuri und Ruth - dargestellt. Diese Figuren erleben die Ereignisse jeweils aus ihrer eigenen Wahrnehmung und mit ihren individuellen gesellschaftlichen Hintergründen. Die fokalisierte Erzählweise macht es den Leser*innen möglich, die Welt aus verschiedenen sozialen Positionen heraus zu betrachten, wodurch die Vielstimmigkeit des Romans gestärkt wird.152 Darüber hinaus weist „Und alle so still“ auch Merkmale der dritten Grundform, also der multiperspektivisch strukturierten Texte, auf. Dies zeigt sich insbesondere in den Kapiteln, die nicht von menschlichen Figuren, sondern von nicht-menschlichen Instanzen erzählt werden, etwa die Perspektiven der Gebärmutter, der Pistole und der Berichterstattung. Diese unkonventionellen Erzählstimmen erweitern die Multiperspektivität über personalisierte Fokalisierungsinstanzen hinaus und integrieren unterschiedliche Textsorten in die Erzählstruktur.
Die Gebärmutter verleiht einer biologischen und gesellschaftlichen Erfahrung eine Stimme, die Pistole personifiziert die Gewalt, und die Berichterstattung zeigt, wie mediale Repräsentationen gesellschaftliche Wahrnehmungen beeinflussen. Diese montageartige Kombination verschiedener Perspektiven und Textsorten entspricht genau dem dritten Kriterium, das Nünning & Nünning für Multiperspektivität definieren.153 Insgesamt lässt sich „Und alle so still“ also als Mischform aus multiperspektivischer Fokalisierung und multiperspektivisch strukturierter Erzählweise charakterisieren.
Das Zusammenspiel der Figuren in „Und alle so still“ verdeutlicht die sozialen Spannungen, Abhängigkeiten und Unsichtbarkeiten innerhalb patriarchaler Strukturen. Elin, Nuri und Ruth stehen nicht isoliert nebeneinander, sondern sind durch subtile Dynamiken miteinander verwoben, die ihre persönliche Entwicklung beeinflussen und gesellschaftliche Machtverhältnisse widerspiegeln. Während Ruth und Nuri im Krankenhaus aufeinandertreffen und eine stille Solidarität füreinander entwickeln154, begegnen sich Elin und Nuri über Tinder, entwickeln aber keine romantische Beziehung füreinander, sondern füllen die Leere des jeweils anderen.155 Ruth und Elin wiederum erkennen erst spät ihre familiäre Verbindung. Ruth ist Elins Tante und damit die Schwester von Alma. Der Roman nutzt diese Konstellation, um zu zeigen, dass persönliche Kämpfe immer auch kollektive Kämpfe sind. Die multiperspektivische Erzählweise hebt hervor, dass keine der Figuren allein existiert - jede von ihnen ist in ein Netzwerk aus Zwängen, Erwartungen und Widerständen eingebunden, das sich erst dann auflösen kann, wenn sie beginnen, sich ihrer Position bewusst zu werden. Das stille Einander-Erkennen, die Momente des Verstehens und der Annäherung, aber auch die anhaltenden Missverständnisse zwischen den Figuren machen deutlich, dass gesellschaftliche Veränderung ein Prozess ist - ein Prozess, der mit der Bereitschaft zur Perspektivübernahme beginnt.
3.1.2 Rolle der Perspektivwechsel und deren Wirkung auf Leser*innen
Die Rolle der Perspektivwechsel zu betrachten, ist deshalb essentiell, weil sie es ermöglichen können, dass dieselbe Handlung aus unterschiedlichen Blickwinkeln erlebt wird. Dies eröffnet den Leser*innen ein vielschichtiges Bild der erzählten Realität und kann die Fähigkeit zur Empathie und zur kritischen Reflexion fördern. Indem die Leser*innen in die inneren Welten von Elin, Nuri und Ruth eintauchen, werden sie angeregt, eigene Vorannahmen zu hinterfragen und sich auf die Vielschichtigkeit menschlicher Erfahrungen einzulassen.156 Hurrelmann betont zusammenfassend, dass das Aushandeln zwischen eigenen und fremden Perspektiven maßgeblich zur Bildung eines „gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekts“ beiträgt.157 Die wechselnden Perspektiven innerhalb des Romanes machen das Lesen zu einem aktiven Prozess, in dem die Leser*innen ständig zwischen den Sichtweisen der Figuren wechseln und diese miteinander in Beziehung setzen müssen. Dadurch entsteht ein dynamischer Erzählfluss, der das Erzählen komplexer sozialer und persönlicher Realitäten ermöglicht.158 Leser*innen können das Geschehen sowohl emotional als auch kognitiv erleben. Sie können die inneren Konflikte erkennen, sehen, wie persönliche und gesellschaftliche Faktoren miteinander verknüpft sind, und werden so dazu angeregt, die dargestellten Machtverhältnisse und Geschlechterrollen kritisch zu hinterfragen.159 Letzteres kann durch den Roman „Und alle so still“ vor allem sein Potential entfalten. Im Roman von Fallwickl wechseln die Perspektiven vorwiegend auf Kapitelbasis. So ist jeder Kapitelblock typischerweise einer bestimmten Perspektive zugeordnet - sei es der personalen Sicht von Elin, Nuri oder Ruth. Daneben gibt es zusätzliche Perspektiven, die das Spektrum erweitern, etwa die unkonventionellen Erzählinstanzen der Gebärmutter, der Pistole und der Berichterstattung, die bereits im vorherigen Kapitel vorgestellt wurden. Gemäß Nünning und Nünning, kann die Erzählstruktur des Romanes als montageartig oder collagenhaft bezeichnet werden.160 Die Perspektivwechsel wirken dabei nicht zufällig oder willkürlich, sondern folgen einem klar strukturierten Muster. Die klassischen Kapitelwechsel lassen erkennen, dass die multiperspektivische Erzählweise methodisch angelegt ist. Gleichzeitig sorgen die gelegentlichen inneren Monologe oder Übergänge innerhalb von Kapiteln für zusätzliche rhythmische Variationen, ohne dabei den methodischen Gesamtrahmen zu verlassen.
Eine Textpassage die als Beispiel für diese inneren Monologe dienen kann, ist der Part, an dem Elin vom stillen Protest mitbekommt: „Ist dies ein stiller Protest? Wurde er angekündigt, in den Netzwerken älterer Leute, Facebook und Twitter, und sie hat es nicht mitbekommen? Es muss doch Forderungen geben, wo stehen die geschrieben?“161 Elin führt einen inneren Monolog und fragt sich, wie die Frauen von dem Protest erfahren haben. Diese Struktur schafft einerseits Orientierung und kann sich als didaktisch wertvolles Element nutzen lassen, andererseits wird dadurch aber auch die Komplexität des Textes bewusst gesteigert.
Der Roman wird überwiegend in der dritten Person erzählt. Dabei dominiert eine personale Erzähl Situation, in der die Innenwelt der Figuren - Elin, Nuri und Ruth - durch freie indirekte Rede und innere Monologe unmittelbar vermittelt wird. Die persönlichen Gedanken und Empfindungen der Protagonist*innen werden also direkt wiedergegeben, was den Leser*innen einen tiefen Einblick in deren emotionale und kognitive Prozesse ermöglicht.162 Zusätzlich zu den personalen Perspektiven kommen Stimmen zum Einsatz, die beispielhaft für die Berichterstattung, die Gebärmutter und die Pistole stehen. Diese tragen zu einem breiteren Verständnis der sozialen und kulturellen Mechanismen bei, indem sie bestimmte Aspekte (wie den Körper oder die Gewalt) symbolisch in den Vordergrund rücken. Diese Passagen sind in der ersten Person formuliert, wie an folgender Passage deutlich wird: „Und ich bin das einzige menschliche Organ, das im Strafgesetzbuch steht“.163
Die Sprache und Erzählweise variiert deutlich je nach Perspektive und trägt damit zu einem veränderten Blick auf die jeweiligen Perspektiven bei.
„«Als ich mich zu Oma gelegt habe», sagt Elin, «dort auf den Asphalt, vor dem Krankenhaus», und sie erkennt an Almas Blick, dass sie davon nichts wusste, «hat es sich angefühlt, als sei ich aus einem komaartigen Zustand erwacht. Als hätten meine Augen sich zum ersten Mal geöffnet, und mein Herz auch.“164
Wie im vorangeführten Zitat erkenntlich wird, nutzt die Autorin für Elin eine reflektierte, oft poetisch anmutende Sprache verwendet, die ihre mediale Selbstinszenierung und innere Zerrissenheit widerspiegelt.
Bei der Beschreibung von Nuris Perspektiven, bedient sich Fallwickl einer direkteren, nüchternen Ausdrucksweise, die seine soziale Unsicherheit, aufgrund seines Migrationshintergrundes zum Ausdruck bringen soll:
„Als Nuri in der zweiten Klasse war, ist seine Mutter nicht mehr zum Elternsprechtag in die Schule gekommen. Sein Vater war damals in der Lebensmittelfertigung, Schichtarbeit, der hatte keine Zeit. Die Lehrerin hat Nuri zweimal darauf angesprochen und ihm einen Zettel mitgegeben. «Den muss deine Mutter unterschreiben», hat sie ihm eingeschärft. Nuri hat die Unterschrift seiner Mutter selbst hingemalt, erst mit Bleistift, und dann, als er zufrieden war, mit Kugelschreiber. Er hat sowieso alles unterschrieben, wie hätte die Lehrerin einen Unterschied merken sollen? Gefragt hat er seine Mutter nicht, er war ja dabei, ein Jahr vorher. Als sie am Elternsprechtag im überfüllten Gang auf den kleinen Sesseln vor der Klasse gewartet haben und eine andere Lehrerin auf sie zugestürmt ist. «Das Reinigungspersonal darf hier nicht sitzen», hat sie sehr laut und überartikuliert gesagt, als wäre Nuris Mutter schwerhörig.“165
Die Sprache, in den Kapiteln zu Ruths Perspektive auf das Geschehen, ist die Sprache geprägt von Wiederholungen und einem rhythmischen, fast resignierten Ton, der ihre Erschöpfung und die monotone Belastung durch Care-Arbeit unterstreicht. Ruths Sicht auf die Dinge ist durch körperliches Erleben geprägt. Die Beschreibungen dessen, was Ruth erlebt, wird durch ihr körperliches Empfinden, wie beispielsweise als eine „Gänsehaut kriecht von unten über Ruths Körper “ und sich schließlich festsetzt, deutlich.166 Die nichtmenschlichen Perspektiven heben sich durch ihre, bereits beschriebenen, stilistischen Eigenheiten, von den personalen Erzählstimmen ab und verleihen dem Text somit zusätzliche Ebenen.
Die wechselnden Perspektiven, sei es durch personalisierte Erzähler*innen oder die Stimmen nicht-menschlicher Instanzen, können eine engere Bindung der Leserinnen zu den Figuren fördern. Da jede Perspektive ihre eigene emotionale und kognitive Tiefe besitzt, werden die Leser*innen dazu angeregt, ihre eigenen Vorurteile zu hinterfragen und ihre Meinung über eine Figur kontinuierlich zu überdenken.167 Besonders stark zur Reflexion anregend sind dabei etwa die introspektiven Passagen von Elin, die ihre Rolle in der digitalen Selbstdarstellung kritisch beleuchtet,168 sowie Ruths resignierte, aber zugleich kämpferische Perspektive, die die Belastungen der Care-Arbeit aufzeigt.169
Obwohl der Roman größtenteils durch die enge Darstellung der inneren Welten der Figuren besticht, gibt es auch Momente, in denen sich eine gewisse Distanz einstellen kann - etwa in Passagen, in denen nicht-menschliche Erzählinstanzen wie die Berichterstattung oder die Pistole auftreten. Diese Distanzmomente können als reflexive Kommentare auf das Geschehen verstanden werden und tragen dazu bei, den narrativen Rhythmus aufzulockern und zusätzliche Spannung zu erzeugen. Die ständigen Wechsel zwischen verschiedenen Perspektiven sorgen für einen dynamischen Erzählfluss, der das Lesetempo erhöht und den Text lebendig erscheinen lässt. Die Leser*innen müssen regelmäßig zwischen den verschiedenen Sichtweisen wechseln und unterschiedliche emotionale und kognitive Ebenen integrieren, was durchaus anspruchsvoll sein kann. Andererseits führt diese Mehrdeutigkeit nicht primär zu einer Behinderung des Leseverstehens, sondern bereichert den Text, indem sie mehrere Interpretationsmöglichkeiten eröffnet. Die Ambivalenz, die durch die wechselnden Perspektiven entsteht, fordert die Leserinnen heraus, aktiv zu hinterfragen, zu analysieren und ihre eigenen Interpretationsansätze zu verfeinern - ein Prozess, der von Kloppert als Bedingung für die Auswahl eines adäquaten Textes, in Bezug auf die Förderung von Perspektivübernahme und Empathiebildung, angesehen wird. Konkret formuliert sie, dass Texte Anknüpfungspunkte an die Lebenswelt der Schüler*innen bieten sollten, gleichzeitig aber auch narratologische oder literaturgeschichtliche Herausforderungen enthalten, die zu einem vertieften Perspektivverstehen führen.170
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Analyse der Rolle der Perspektivwechsel und deren Wirkung auf Leser*innen eine erste Annäherung an das Potential des Romans, Perspektivübernahme und Empathiebildung zu fördern, bietet.
3.1.3 Selbstermächtigung und Selbstreflexion der Figuren als Mittel zur Förderung von Empathie
Selbstermächtigung, Empowerment oder auch Emanzipation in der Literatur bezieht sich auf den Prozess, in dem eine Figur ihre eigene Handlungsfähigkeit, Autonomie und Kontrolle über ihr Leben entdeckt und ausbaut. Dies kann sich in verschiedenen Formen zeigen, wie z. B. das Treffen eigener Entscheidungen, das Überwinden von Hindernissen oder das Infragestellen von bestehenden gesellschaftlichen Machtverhältnissen.
Dies kann ein aktiver Prozess sein, bei dem die Figur selbst die Initiative ergreift, oder ein passiver, bei dem sich die Figur ihrer Situation bewusstwird und dadurch neue Handlungsoptionen erkennt.[193] Die Darstellung von Selbstermächtigung in literarischen Texten kann dazu beitragen, Empathie bei den Lesenden zu fördern, indem sie Einblicke in die inneren Prozesse und Motivationen der Figuren ermöglicht. Die emotionale und kognitive Auseinandersetzung mit solchen Figuren kann zu einer intensiven Auseinandersetzung mit den eigenen Werten und Normen führen.[194] Figuren in literarischen Texten erleben oft Veränderungsprozesse, die durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden können, wie z. B. durch Konflikte, Begegnungen mit anderen Figuren oder durch das Bewusstwerden eigener Schwächen oder Stärken.[195] Reflexion spielt eine zentrale Rolle in diesen Veränderungsprozessen. Figuren, die zur Selbstreflexion fähig sind, können ihre eigenen Handlungen und Motivationen hinterfragen, neue Erkenntnisse gewinnen und ihre Haltung ändern. Selbstreflexion kann dazu führen, dass Figuren stereotype Darstellungen überwinden.[196] Die Darstellung von Selbstermächtigung einer Figur kann dazu anregen, gesellschaftliche Normalitätserwartungen zu dekonstruieren, was zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen kann.[197]
In Fallwickls „Und alle so still“ durchlaufen sowohl die drei Hauptfiguren, als auch viele der Nebencharaktere einen Prozess der Veränderung, der eng mit Selbstreflexion und gesellschaftlichen Machtverhältnissen verbunden ist. Die Protagonistinnen - Elin, Nuri und Ruth - erleben auf unterschiedliche Weise, wie ihre Wahrnehmung der Welt und ihrer eigenen Position innerhalb dieser Welt erschüttert wird. Während Elin mit den Zwängen der digitalen Selbstinszenierung hadert, ringt Nuri mit überkommenen Männlichkeitsbildern und seiner Migrationsgeschichte, und Ruth muss erkennen, dass sie jahrzehntelang in eine Rolle gedrängt wurde, die sie selbst nicht infrage gestellt hat. Für den Verlauf dieser Veränderungen können für alle drei Figuren gleichermaßen drei Phasen definiert werden. Die erste Phase beschreibt dabei die zunehmende Unzufriedenheit, konkret also einen Moment, in dem sie beginnen, an ihrer bisherigen Lebensweise zu zweifeln. In der zweiten Phase üben die Figuren dann Selbstreflexion.
Sie setzen sich mit sich selbst auseinander, oft ausgelöst durch äußere Umstände oder Begegnungen. Die dritte Phase ist die der aktiven Handlung bzw. des Widerstandes. Die Figuren treffen eine bewusste Entscheidung, sich einer neuen Erkenntnis zu stellen und daraus Konsequenzen zu ziehen. Während dieser Prozesse hinterfragen die Figuren nicht nur ihre individuellen Entscheidungen, sondern auch die gesellschaftlichen Strukturen, die ihr Leben geprägt haben. Ein Beispiel für die Selbstermächtigung eines Nebencharakters, ist Nuris Mutter:
„Seine Mutter sitzt auf dem Bett, einen Hut auf dem Schoß, neben ihren Beinen ein kleiner Koffer «Schönes ... Kleid», sagt Nuri erstaunt, woran Elin erkennt, dass seine Mama sich wohl nicht oft so anzieht. Auf dem Kleid sind kleine blaue Blumen. Sie hat die Haare in Wellen frisiert, trägt Lippenstift und weiße Sandalen. «Hallo», sagt sie und nickt freundlich, steht auf und greift nach dem Koffer, «gehen wir? »“171
Diese Szene, markiert einen entscheidenden Moment der Selbstermächtigung einer bis dahin weitgehend unsichtbaren und sprachlosen Figur. Ihr Aufbruch ist nicht nur ein physischer, sondern auch ein symbolischer Akt der Befreiung von einer Rolle, in die sie über Jahre hinweg gedrängt wurde. Bis zu diesem Punkt im Roman bleibt Nuris Mutter eine Randfigur, die vorrangig aus der Perspektive ihres Sohnes wahrgenommen wird. Ihre Darstellung ist oft geprägt von sprachlicher Barriere, kultureller Isolation und sozialer Unsichtbarkeit. Sie spricht wenig und wird von Nuri als „ Singsangfrau “172 beschrieben, deren Worte oft nicht in ihrer vollen Bedeutung ankommen. Dies verdeutlicht, dass sie in einem doppelten Sinne unterdrückt und begrenzt wird - durch ihre Rolle als Migrantin, deren Sprache nicht gehört wird, und als Frau, die den Erwartungen an eine dienende, sich aufopfernde Mutter entspricht.
Ruth erlebt die vermeintlich stärkste Form der Selbstermächtigung. Nach Jahren der Fremdbestimmung als Pflegekraft und Frau, die immer für andere gesorgt hat, erkennt sie, dass sie auf sich selbst achten muss:
„Es hat Männer gegeben in ihrem Leben, aber keine Partner. Es hat Sex gegeben, aber keine Liebe. So war das eben, sie hatte schließlich ein Kind. Ein behindertes, da durfte sie nichts erwarten. Da musste sie sich zufriedengeben mit zusammengestückelten Stunden in durchgelegenen Betten. Und sie hat sich immer gewünscht, dass sie nach Hause kommt und da einer ist, der schaut ihr ins Gesicht. Hat was für sie gekocht. Und fragt, wie ihr Tag gewesen ist. Sie hat nicht Nein sagen dürfen, sie hat generell kein Nein in sich gehabt. Für die wenigen Männer nicht, für die Arbeit im Krankenhaus nicht, für den Vater von Fritz nicht und für ihren eigenen auch nicht. Jetzt ist Ruth selbst ein Nein geworden.“173
Ruths Wendepunkt, in dem sie „ selbst ein Nein geworden “ ist, symbolisiert die Befreiung von der Last, sich immer anpassen und opfern zu müssen. Sie beginnt erstmalig aktiv eine Rolle einzunehmen, die nicht nur der Fürsorge dient, sondern ihrem eigenen Bedürfnis nach Veränderung entspricht. Diese Darstellung von Ruths Lebensgeschichte bietet einen Zugang, um innerhalb des Deutschunterrichts über emotionale und strukturelle Abhängigkeiten sowie die Möglichkeit des Widerstands durch ein selbstbestimmtes „Nein“ zu diskutieren.
Elin hingegen beginnt ihren Emanzipationsprozess zunächst innerlich. Sie reflektiert ihre Rolle als Influencerin und erkennt, dass sie in einem System gefangen ist, das Frauenobjektivierung und Selbstvermarktung fördert. Als einen sehr eindringlichen Auslöser für diese inneren Gedankengänge kann der Vorfall mit einem Tinder-Date gedeutet werden: „Da ist etwas Heißes, Klebriges an ihr, in ihr, sie greift mit den Fingern hin, sieht die weißen Schlieren, hat eine Panikexplosion im Bauch und starrt auf das Kondom auf dem Holzboden.“ 174 Elins Sexualpartner entfernte, ohne Elins Wissen und gegen ihren Willen, während des Aktes sein Kondom und ejakulierte in Elin. Dieser Vorfall markiert einen Wendepunkt in Elins Entwicklung, da er sie aus ihrer passiven Rolle herausreißt und sie dazu zwingt, ihre eigene Verletzlichkeit, aber auch ihre Handlungsmacht zu reflektieren. Während sie zunächst von Schock und Ohnmacht überwältigt wird, wächst in ihr das Bewusstsein, dass sie sich gegen die systematische Entmündigung und Objektivierung weiblicher Körper zur Wehr setzen muss. Ihr darauffolgendes Zögern, sich den Protesten anzuschließen, zeigt, wie schwer es ist, aus diesen Strukturen auszubrechen. Doch in einem entscheidenden Moment legt sie sich auf die Straße und wird so Teil des feministischen Widerstands.175
Auch bei Nuri kann eine Form der Selbstermächtigung ersichtlich werden. Er hinterfragt die Erwartungen an ihn als Mann und beginnt, sich von traditionellen Männlichkeitsbildern zu lösen. Seine Selbstermächtigung besteht darin, dass er sich nicht mehr nur über seine Unsicherheiten definiert, sondern lernt, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Dabei ist jedoch nicht nur das Geschlecht ein prägender Faktor seiner Identitätsfindung, sondern auch seine migrantische Perspektive, die ihn zusätzlichen gesellschaftlichen Zwängen und Abwertungen aussetzt. Als junger Mann mit Migrationshintergrund erfährt er damit eine andere Art der Marginalisierung als sie Elin oder Ruth erfahren. Sein Kampf um Selbstermächtigung ist daher nicht nur ein persönlicher, sondern auch ein struktureller, in dem rassistische und klassistische Machtverhältnisse eine Rolle spielen.
Seine Reflexion gipfelt in einer Schlüsselszene, in der er die gesellschaftlichen Erwartungen, unter denen Männer stehen, offen anspricht:
„Einen Aufruf an die Männer, sich dem Kampf der Frauen anzuschließen, hat es nicht gegeben», sagt Nuri. «Die Männer haben keine Ahnung, was sie gewinnen könnten, wenn sie mitmachen würden. Sie sind überzeugt, dass sie nur verlieren können. Aber sie täuschen sich. Sie würden doch auch ein besseres Leben führen!»“[203]
Dieser Moment markiert einen entscheidenden Schritt in Nuris Entwicklung. Er erkennt, dass Männlichkeit nicht zwangsläufig auf Abgrenzung, Dominanz oder Kontrolle beruhen muss, sondern dass Männer durch feministische Kämpfe ebenfalls gewinnen können. Sein Drängen, seine Unruhe und seine Bewegungen während des Gesprächs unterstreichen, dass er sich noch mitten in diesem Erkenntnisprozess befindet. Damit kann Nuri als Feminist der vierten Welle bezeichnet werden.[204] Im Sinne einer intersektionalen Literaturdidaktik eröffnet Nuris Perspektive einen Raum für die Auseinandersetzung mit geschlechtlicher und sozialer Positionierung im Kontext von Migration. Sein Weg zur Selbstermächtigung zeigt, dass Befreiung nicht nur ein individuelles, sondern auch ein kollektives Anliegen ist - ein Gedanke, der Leser*innen dazu anregen kann, über die Wechselwirkungen zwischen Geschlecht, Herkunft und gesellschaftlichen Machtstrukturen nachzudenken.[205]
Diese beschriebenen Prozesse der Selbstermächtigung und Reflexion haben ein starkes Wirkungspotential auf die Leser*innen, da sie die individuellen Kämpfe der Figuren nachvollziehbar und emotional greifbar machen. Die Kontraste zwischen den verschiedenen Perspektiven verstärken die Wirkung, da sie zeigen, dass gesellschaftliche Zwänge und persönliche Unsicherheiten universell, aber unterschiedlich erlebbar sind.
Obwohl einige Figuren, besonders Elin und Nuri, ambivalente oder widersprüchliche Verhaltensweisen zeigen, entfaltet der Roman durch seine personalisierte Erzählweise eher das Potential zur Identifikation als zur Distanz. Durch die multiperspektivische Erzählweise fordert der Roman die Schüler*innen heraus, sich mit verschiedenen Lebensrealitäten auseinanderzusetzen. Die Reflexionsprozesse der Figuren sind dabei ein ideales Mittel, um über soziale Ungleichheit, Geschlechterrollen und gesellschaftliche Erwartungen nachzudenken. Die Schüler*innen können so nicht nur literarische Analysefähigkeiten vertiefen, sondern auch Empathie für unterschiedliche gesellschaftliche Positionen entwickeln.176
3.2 Narrative Mittel und ihre didaktische Bedeutung
Neben der Figurenkonstellation und den erzählerischen Perspektiven spielen auch spezifische narrative Mittel eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung von Perspektivübernahme in „Und alle so still“. Durch die bewusste Auswahl von Erzähltechniken, stilistischen Verfahren und strukturellen Elementen werden die Leser*innen nicht nur in die Gedankenwelt der Figuren eingebunden, sondern auch zur kritischen Reflexion angeregt. Im folgenden Abschnitt wird untersucht, welche Erzählstrukturen Fallwickl verwendet, um Perspektivwechsel gezielt zu fördern und welche narrativen Strategien dabei eine besondere didaktische Relevanz haben.
3.2.1 Erzählstrukturen zur Förderung von Perspektivübernahme und kritischer Reflexion
Fallwickl nutzt in ihrem Roman „Und alle so still“ überwiegend die personale Erzählperspektive in der dritten Person Singular. Diese Perspektive gewährt den Leser*innen einen direkten Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt der Figuren, ohne jedoch den allwissenden Blick eines auktorialen Erzählers einzunehmen, den Stanzel definiert.177 Die Handlung wird vor allem aus den Perspektiven der drei Hauptfiguren Elin, Nuri und Ruth erzählt. Darüber hinaus bedient sich Fallwickl einer besonderen narrative Technik und verwendet nicht-menschliche Erzählinstanzen.
So kommen beispielsweise die Gebärmutter, die Pistole und die Berichterstattung als eigenständige Stimmen zu Wort. Diese unkonventionellen Perspektiven können den Blick auf gesellschaftliche Strukturen erweitern. Die Perspektivwechsel finden dabei kapitelweise statt und folgen einer rotierenden Struktur, bei der die Hauptfiguren jeweils im Wechsel fokalisiert werden. Zwischen diesen Figurenkapiteln werden die nicht-menschlichen Erzählperspektiven eingefügt. Diese Struktur sorgt dafür, dass die Leser*innen einerseits eine kontinuierliche Entwicklung der Figuren nachvollziehen können, andererseits aber auch inhaltliche Brüche und Perspektivwechsel erleben, die das Potential zur Reflexion entfalten. Die Perspektivwechsel sind dabei nicht zufällig angeordnet, sondern setzen oft an Schlüsselmomenten der Handlung an. So erfolgt nach wichtigen emotionalen Erlebnissen einer Figur häufig ein Wechsel, der das Geschehen aus einer anderen Perspektive neu kontextualisiert. Die Gebärmutter-Perspektive erscheint beispielsweise besonders in Szenen, die mit Körperlichkeit, Geschlecht und gesellschaftlicher Erwartung verbunden sind. Ein konkretes Beispiel stellt Elins Schock über das erlebte „Stealthing“-Erlebnis dar, dem eine Szene aus der Sicht der Berichterstattung folgt, die das Thema sexualisierte Gewalt sachlich und distanziert darstellt. Dieser Wechsel verdeutlicht die Diskrepanz zwischen individuellem Trauma und gesellschaftlicher Wahrnehmung.178
Die von Fallwickl gewählte Erzählstruktur wirkt sich in mehrfacher Hinsicht auf die Wahrnehmung der Leser*innen aus. Durch die personale Erzählweise mit interner Fokalisierung, nach Genette tauchen die Leser*innen in die subjektive Wahrnehmung der Figuren ein und erleben deren Gefühle, Unsicherheiten und Reflexionen unmittelbar mit.179 Dies kann das Potential zur Empathiebildung entfalten und für unterschiedliche gesellschaftliche Erfahrungen sensibilisieren- sei es Elins Kampf mit digitaler Objektifizierung, Nuris Auseinandersetzung mit Männlichkeitsbildern und seiner Migrationsgeschichte oder Ruths Erschöpfung als unsichtbare Care-Arbeiterin. Die nichtmenschlichen Erzählinstanzen dienen im Roman als Metaebenen, die es den Leser*innen ermöglichen können, das Geschehen aus einer distanzierten, symbolischen Perspektive zu betrachten. Die Gebärmutter spricht beispielsweise über die jahrhundertelange Unterdrückung weiblicher Körper und verleiht so einer gesellschaftlichen Realität eine körperliche Stimme.180 Die regelmäßigen Wechsel zwischen den Figuren und den symbolischen Stimmen können eine Art Spannungsmoment erzeugen, da die Leser*innen nie sicher sein können, aus welcher Perspektive die nächste Szene geschildert wird.
Die Parallelität von individuellen und gesellschaftlichen Perspektiven regt dazu an, immer wieder neue Verknüpfungen zwischen den Handlungsebenen herzustellen. Die unterschiedlichen Bewertungen desselben Geschehens durch verschiedene Perspektiven können die Leser*innen zu einem kritischen Umgang mit Wahrnehmung und Wahrheit anregen. Die häufigen Wechsel zwischen interner und externer Perspektive, zwischen individueller und gesellschaftlicher Ebene, entfalten das Potential, dass die Leser*innen ihre eigenen Wahrnehmungen kritisch hinterfragen. Sie können erkennen, wie stark Perspektiven und Erzählweisen die Rezeption potentiell beeinflussen und wie gesellschaftliche Machtverhältnisse gesellschaftliches Denken prägen können.
Im Roman werden gezielt verschiedene narrative Techniken genutzt, um Perspektivübernahme und Empathie bei dem Leser*innen potentiell zu fördern. Der Wechsel zwischen unterschiedlichen Erzählstimmen, innere Monologe sowie der bewusste Einsatz von Nähe und Distanz zu den Figuren können das Erleben und Nachvollziehen ihrer individuellen und gesellschaftlichen Konflikte greifbar machen.[211] Die interne Fokalisierung innerhalb des Romanes ermöglicht es den Leser*innen, direkt in die Gedankenwelt der Figuren einzutauchen und ihre subjektiven Wahrnehmungen, Gefühle und Reflexionsprozesse unmittelbar mitzuerleben. Auch an dieser Stelle bieten Elins Gedanken nach dem sexuellen Übergriff ein passendes Beispiel. Sie werden in einer hochgradig subjektiven, fragmentierten Sprache dargestellt, was ihre emotionale Desorientierung und das Gefühl der Entmündigung nachvollziehbar macht: „Da ist etwas Heißes, Klebriges an ihr, in ihr, sie greift mit den Fingern hin, sieht die weißen Schlieren, hat eine Panikexplosion im Bauch und starrt auf das Kondom auf dem Holzboden.“ [212] Durch diese fragmentierte Syntax wird Elins emotionaler Ausnahmezustand erlebbar gemacht. Die Nähe zu Elins Empfinden fordert die Leser*innen dazu auf, sich mit dem traumatischen Erlebnis auseinanderzusetzen und die Erfahrung aus ihrer Perspektive nachzuvollziehen. Die Multiperspektivität des Romanes, die in vorherigen Kapiteln bereits erläutert wurde, hilft ein komplexes Bild des Geschehens zu entwickeln. Diese Technik verdeutlicht, dass gesellschaftliche Konflikte, wie beispielsweise Machtverhältnisse oder geschlechterspezifische Erwartungen, aus unterschiedlichen Blickwinkeln wahrgenommen und bewertet werden können. Die Stimmen der Gebärmutter, Pistole und Berichterstattung bieten eine metareflexive Ebene, auf der gesellschaftliche Mechanismen und individuelle Erfahrungen miteinander verknüpft werden.
Diese unkonventionellen Erzählinstanzen erzeugen eine gewisse Distanz und helfen den Leser*innen, abstrahierend über gesellschaftliche Strukturen nachzudenken. Grund dafür ist die fehlende Empathie oder das eingeschränkte Verständnis der menschlichen Welt, einer nicht-menschlichen Erzählinstanz.181 Deutlich wird dies, vor allem, als die Gebärmutter über die jahrhundertelange Fremdbestimmung weiblicher Körper reflektiert und so vor Augen führt, dass Elins Erfahrung kein Einzelfall ist, sondern ein Symptom struktureller Machtverhältnisse:
„Bei der Menschenrechtskonferenz 1993 in Wien wurden erstmals Frauenrechte offiziell als Menschenrechte anerkannt. Eine Sexualität frei von Zwang, Diskriminierung und Gewalt wurde als ein solches Menschenrecht definiert. Ebenso wurden die Achtung körperlicher Unversehrtheit und die Notwendigkeit des Einverständnisses zu sexuellen Handlungen verankert. Schon erstaunlich, dass sie das überhaupt aufschreiben mussten. Andererseits haben sie es halt aufgeschrieben, mehr nicht. Denn der UN-Weltbevölkerungsbericht von 2023 zeigt: Alle diese Rechte werden 44 Prozent der Frauen weltweit nach wie vor verweigert. Und ich bin das einzige menschliche Organ, das im Strafgesetzbuch steht.“182
Fallwickl arbeitet mit einer variierenden Sprache, die sich den jeweiligen Figurenperspektiven anpasst. So ist Elins Sprache oft sprunghaft und von digitaler Bildsprache geprägt, während Ruths Gedanken von monotonen, sich wiederholenden Satzstrukturen dominiert werden, was ihre Erschöpfung widerspiegelt. Diese sprachliche Variation trägt dazu bei, dass die Leser*innen die emotionalen Zustände der Figuren unmittelbar nachvollziehen können. In besonders emotionalen Momenten nutzt die Autorin fragmentierte Satzstrukturen und assoziative Gedankenketten, um die unmittelbare emotionale Reaktion zu verdeutlichen. Nach dem Übergriff fühlt sich Elin panisch. Sie „greift mit den Fingern hin, sieht die weißen Schlieren, hat eine Panikexplosion im Bauch und starrt auf das Kondom auf dem Holzboden.“183 Die sprachliche Darstellung des inneren Kontrollverlusts wird so erfahrbar gemacht. Durch die gegenübergestellten Perspektiven kann deutlich werden, wie unterschiedlich gesellschaftliche Normen und individuelle Erfahrungen, auch je nach Geschlecht oder Herkunft, wirken können. Diese Gegenüberstellungen entfalten ein Potential zum dynamischen, kritischen Nachdenken.184
Fallwickl arbeitet mit bewussten Brüchen im Erzählfluss, um die Leser*innen aus der gewohnten Perspektive herauszureißen und zum Nachdenken anzuregen. Diese Brüche erfolgen häufig beim Wechsel zwischen den Perspektiven oder in traumatischen Momenten. Fragmentierte Sätze und abrupte Wechsel im Satzbau spiegeln das emotionale Erleben der Figuren wider und machen es nachvollziehbar. Die Autorin setzt punktuell Ironie ein, um gesellschaftliche Absurditäten zu entlarven - insbesondere im Umgang mit feministischen Anliegen und Geschlechterrollen. Dies geschieht vor allem bei den nicht-menschlichen Erzählinstanzen. Aus Sicht der Gebärmutter, heißt es: „Schon erstaunlich, dass sie das überhaupt aufschreiben mussten. Andererseits haben sie es halt aufgeschrieben, mehr nicht.“[217] Hier wird ironisch auf die Diskrepanz zwischen formal anerkannten Frauenrechten und der Realität hingewiesen. Die Gebärmutter kommentiert zynisch, wie wenig sich trotz gesetzlicher Verankerung geändert hat. Aus Perspektive der Berichterstattung findet sich folgendes Beispiel: „Ihr habt mich missbraucht. Ihr habt behauptet, mich neutral zu verwenden, und habt in Wahrheit eure misogynen, rassistischen, diskriminierenden Filter über jeden Artikel gelegt. “[218] Die Medienkritik wird hier mit beißender Ironie formuliert, indem die „vierte Gewalt“ enthüllt, wie sehr gesellschaftliche Vorurteile die Berichterstattung verzerren.
Fallwickl setzt verschiedene narrative Mittel wie Multiperspektivität, innere Monologe, nicht-menschliche Erzählinstanzen und fragmentierte Sprache gezielt ein, um die Leser*innen zum Nachdenken über Geschlechterrollen, Machtverhältnisse und gesellschaftliche Dynamiken anzuregen. Der ständige Wechsel zwischen emotionaler Nähe und kritischer Distanz fördert eine aktive Auseinandersetzung mit den sozialen Strukturen im Roman und entfaltet gleichzeitig sein Potential zur Perspektivübernahme. Fallwickls Roman bietet durch seine multiperspektivische Erzählweise und die unterschiedlichen Erzählinstanzen zahlreiche Anknüpfungspunkte für den Literaturunterricht. Die Erzähltechniken können nicht nur das literarische Textverständnis, sondern auch Perspektivübernahme, Empathie und kritisches Denken fördern. Insbesondere im Zusammenhang mit gesellschaftlich relevanten Themen wie Geschlechterrollen, Machtverhältnisse und Identitätsbildung kann der Roman wertvolle Impulse liefern. Der Roman behandelt Themen wie sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch und gesellschaftliche Diskriminierung, die belastend wirken können, weshalb bei einer Verwendung um Deutschunterricht unbedingt abgewogen werden muss, welche Passagen zur Analyse der Erzählstruktur herangezogen werden können.
Eine sensible Gesprächsführung oder die Möglichkeit zur anonymen Reflexion und Einbettung in einen geschützten Lernraum, sind hierbei essentiell. Eine weitere Herausforderung für den Deutschunterricht könnte das Abstraktionsniveau der nichtmenschlichen Perspektiven darstellen. Hierbei hilft eine Einführung in literarische Symbole und Personifikationen anhand einfacherer Beispiele. Der Roman bietet durch seine komplexe Erzählstruktur, seine gesellschaftlich relevanten Themen und die multiperspektivische Darstellung zahlreiche Anknüpfungspunkte für den Literaturunterricht. Mit geeigneten methodischen Zugängen, die in nachfolgenden Kapiteln erläutert werden sollen, können Lehrkräfte die Erzählstruktur nutzen, um Schüler*innen zu einem kritischen, empathischen und differenzierten Literaturverständnis anzuleiten.
3.2.2. Symbolik und Themen: Identität, Machtverhältnisse und soziale Rollen
Fallwickl nutzt in ihrem Roman eine vielschichtige Symbolik, um gesellschaftliche Themen wie Geschlechterrollen, Machtverhältnisse, Identitätsbildung und soziale Ungleichheiten darzustellen und damit das Potential zu entfalten, die Leser*innen zur Perspektivübernahme anzuregen. Die Symbole im Text wirken dabei nicht isoliert, sondern stehen in einem engen Zusammenhang mit den individuellen Reflexionsprozessen der Figuren und der gesellschaftlichen Gesamtaussage des Romans. Symbolik und thematische Leitmotive spielen eine zentrale Rolle im Prozess der Perspektivübernahme, da sie es ermöglichen, abstrakte gesellschaftliche Zusammenhänge emotional greifbar und kognitiv nachvollziehbar zu machen. Symbole im literarischen Kontext bieten den Leser*innen die Gelegenheit, bestimmte Erfahrungen und soziale Realitäten nicht nur intellektuell, sondern auch emotional nachzuvollziehen.185 In „Und alle so still“ dienen die verwendeten Symbole dazu, die Leser*innen zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen und individuellen Handlungsspielräumen anzuregen. Die Multiperspektivität des Romans wird durch die symbolische Ebene verstärkt, indem unterschiedliche Erfahrungen und gesellschaftliche Positionen nicht nur sprachlich beschrieben, sondern visuell und emotional erfahrbar werden. Besonders deutlich wird dies beispielsweise durch die Gebärmutter als die Stimme des kollektiven weiblichen Körpers.
Die Gebärmutter ist im Roman nicht nur ein anatomisches Organ, sondern wird zu einer metaphorischen Stimme für die Erfahrungen von Frauen in patriarchalen Strukturen. Sie spricht von den Schmerzen, der gesellschaftlichen Kontrolle über weibliche Körper und den historischen Dimensionen der Unterdrückung: „Ich bin die Gebärmutter, mich verbinden sie mit Weiblichkeit. Über alles, was mit mir geschieht, entscheiden Männer.“ 186 Die personifizierte Gebärmutter verkörpert hier die jahrhundertelange Kontrolle männlich dominierter Gesellschaften über weibliche Körper. Den Leser*innen wird es damit ermöglicht, den gesellschaftlichen Umgang mit Frauenkörpern nicht nur aus der Perspektive einer Figur wie Elin oder Ruth, sondern aus einer kollektiven, intergenerationellen Sicht zu betrachten.
Der Roman behandelt zentrale gesellschaftliche Themen, die durch die Symbolik verdeutlicht und emotional erfahrbar gemacht werden. Ein primäres Thema ist die (digitale) Objektifizierung von Frauen. Elins Rolle als Influencerin zeigt, wie sehr weibliche Körper vor allem im digitalen Raum zur Ware und Projektionsfläche gesellschaftlicher Erwartungen werden. Die im Roman thematisierten Machtverhältnisse und die damit einhergehende sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen, wie besonders an der Stelle im Roman deutlich, als der erste Mann seine Frau aus der gemeinsamen Unterkunft holen möchte:
„Ich fahre jetzt nach Hause und gebe dir eine allerletzte Chance», ruft er, «wenn du in einer Stunde daheim bist, ist alles gut. Hörst du? Dann vergessen wir das Ganze. Eine Stunde!» Er tippt mit dem rechten Zeigefinger auf die in der Sonne aufblitzende Armbanduhr. «Wenn nicht, komme ich und hole dich. Ich hole dich, hast du verstanden?» Dann senkt er den Kopf. Sieht die Frauen an, die ihm gegenüberstehen, die ihm nicht geben, was er für sein Recht hält. «Ihr Fotzen», zischt er, «wir kommen zurück. Wir beenden eure kleine Show, ihr werdet schon sehen.“187
Dieser Ausspruch, geprägt von Drohungen und hasserfüllten Beleidigungen, ist ein direkter Angriff auf die Frauen, der versucht, sie zur Rückkehr in traditionelle Rollenmuster zu zwingen. Die Gewaltandrohung spiegelt das patriarchale Empfinden wider, dass Frauen ihre „Pflichten“ nicht einfach niederlegen dürfen, da sie als unabdingbar für das Funktionieren des Systems gelten. Die aggressive Sprache zeigt zugleich die Verzweiflung und den Zorn eines Mannes, der durch den Protest seiner Frau oder anderer Frauen in seiner gewohnten Machtposition herausgefordert wird.
Ein drittes Kernthema des Romanes ist die Care-Arbeit und die damit einhegende gesellschaftliche Unsichtbarkeit. Dieses Thema wird vor allem durch Ruth beschrieben. Ihre Geschichte wirft ein Licht auf die Ausbeutung von Frauen in Pflegeberufen, die trotz ihrer systemrelevanten Tätigkeit oft übersehen und unterbezahlt werden: „Irgendwann war einfach klar, auf Ruth wartet niemand, Ruth springt immer ein, Ruth arbeitet an Weihnachten und an Silvester, Ruth fährt nicht in den Urlaub.“ 188 Diese Passage verdeutlicht die Selbstverständlichkeit, mit der Ruths Fürsorgearbeit als gegeben betrachtet wird. Ihre Unentbehrlichkeit wird nicht anerkannt oder angemessen entlohnt, sondern erscheint als natürlicher Bestandteil ihrer Existenz.
Nuris Perspektive verdeutlicht sowohl den Umgang mit toxischen Männlichkeitsbildern, als auch den Themenkomplex Migration. Nuri wird mit widersprüchlichen gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert. Als Mann soll er dominant und durchsetzungsfähig sein, als Migrant wird er zugleich sozial stigmatisiert und abgewertet. Dies wird vor allem an einer Stelle im Roman deutlich:
„Seit zwanzig Jahren ist sie hier und kann die Sprache nicht richtig. Ihre eigene ist ihr weggestorben, ist vertrocknet und verblasen, niemand spricht mit ihr Singhalesisch. Für Nuri ist seine Mutter sprachenlos, eine Singsangfrau, die viel plappert, aber für das, was sie sagen will, keine Worte hat.“ 189
Die Mutter wird hier zum Symbol für die Erfahrungen von Isolation und gesellschaftlicher Unsichtbarkeit, die sich auf Nuri übertragen und seine Auseinandersetzung mit kulturellen Erwartungen beeinflussen.
Fallwickl arbeitet im Roman mit wiederkehrenden Motiven, die symbolisch auf gesellschaftliche Dynamiken und individuelle Entwicklungsprozesse verweisen sollen. Zum einen nutzt sie das Symbol des Körpers als Austragungsort gesellschaftlicher Kontrolle. Die Gebärmutter als nicht-menschliche Erzählinstanz steht dafür metaphorisch, wenn es heißt: „Ich bin die Gebärmutter, mich verbinden sie mit Weiblichkeit. Über alles, was mit mir geschieht, entscheiden Männer.“ 190 Es wird deutlich, wie der Körper von Frauen gesellschaftlich reglementiert und politisch instrumentalisiert wird.
Die Gebärmutter spricht hier als personifizierte Stimme weiblicher Körperlichkeit und macht deutlich, dass Entscheidungen über reproduktive Rechte historisch und gesellschaftlich Männern vorbehalten waren.[225] Die gebrochene Autonomie des weiblichen Körpers wird so zum zentralen Symbol für patriarchale Machtstrukturen. Ein weiteres Motiv ist der öffentliche Raum als Bühne für Machtkämpfe. Der Streik der Frauen findet im öffentlichen Raum statt und verdeutlicht die Verlagerung feministischer Kämpfe von der Privatsphäre in die gesellschaftliche Sphäre. Die Frauen liegen auf der Straße vor dem Krankenhaus, „[d]ie Zufahrt zu den Eingängen haben die Frauen freigelassen, eine akkurat gezogene Schneise, sie liegen nicht im Weg“.[226] Hierbei ist es entscheidend, dass die Frauen kollektiv Handeln, denn erst das gemeinsame Handeln kann einen öffentlichen Raum als Ort des Politischen und damit auch des Protestes hervorbringen.[227] Da der Roman zeitlich nach der Covid-19-Pandemie spielt, bedarf es auch diesbezüglich einer Einordnung, denn die Pandemie hat die Frage nach physischer Präsenz innerhalb eines Protestes neu aufgeworfen, weil sie die Anfälligkeit des Körpers deutlich gemacht hat.[228]
Im Roman werden auch gesellschaftliche Privilegien reflektiert. Der Roman zeichnet dabei ein klares Bild von gesellschaftlicher Ungleichheit und das auf verschiedenen Ebenen. Als erfolgreiche Influencerin besitzt Elin beispielsweise innerhalb des digitalen Raumes erhebliches Kapital und medialen Zugang. Ihr äußerlich privilegiertes Image steht jedoch im Kontrast zu ihrer inneren Einsamkeit und der ständigen Objektifizierung.[229] Nuri als Mann mit Migrationshintergrund, der sich von traditionellen Männlichkeitsbildern lösen möchte, ist dadurch gleich in zweifacher Hinsicht marginalisiert. Er wird sowohl von traditionellen, oft toxischen Männlichkeitsnormen belastet als auch durch seine Herkunft stigmatisiert. Sein Alltag, der von prekären Jobs und sozialer Ausgrenzung geprägt ist, steht exemplarisch für jene Gruppen, die in der Gesellschaft wenig Ansehen genießen. Nuris Perspektive ergänzt den Roman um eine intersektionale Perspektive, die eine Analyse der innerweltlichen Diskriminierung und gesellschaftlicher Normen innerhalb literarischer Texte ermöglicht.[230] Während Elin aufgrund ihres Geschlechtes und Nuri aufgrund seiner Herkunft benachteiligt wird, wird Ruth strukturell benachteiligt, indem ihre zentrale Rolle innerhalb des Gesundheitssystems gesellschaftlich unsichtbar bleib.
Diese Kontraste zeigen, dass gesellschaftlicher Status nicht nur von individuellen Fähigkeiten, sondern auch von Geschlecht, Herkunft und sozialen Strukturen abhängt. Die von Fallwickl beschriebenen Machtstrukturen und -verhältnisse, werden sowohl durch die menschlichen, als auch die nicht-menschlichen Perspektiven deutlich. Die individuellen Erlebnisse von Elin, Nuri und Ruth machen deutlich, wie patriarchale Strukturen sowohl Frauen als auch Männer beeinflussen. Durch den Wechsel zwischen der subjektiven Wahrnehmung der Figuren und solchen symbolisch aufgeladenen Stimmen wird die Mehrdimensionalität von Macht deutlich. Im Sinne von Brausmann könnte man sogar von einer patriarchalen Identitätspolitik sprechen, die innerhalb des Romanes kritisiert wird. Patriarchale Identitätspolitik beschreibt sie dabei folgendermaßen:
„Und obwohl Gesetze prinzipiell ein gleichberechtigteres Miteinander regeln (können) und keine Geschlechternarrative (mehr) fördern, wird sich in der Realität dennoch auf Letztere berufen - zur (un)bewussten Erhaltung patriarchaler Machtstrukturen, weshalb die Narrative eine Politik im Sinne patriarchaler Identitätskonstitution, also patriarchale Identitätspolitik, fördern. Patriarchale Identitätspolitik begreife ich somit als eine Politik der Position und Positionalität, die gleichermaßen im privaten wie öffentlichen Raum [...] mithilfe ihrer Narrative unbewusst und bewusst Geschlechteridentitäten gestaltet, kontrolliert [...] und reproduziert. “22 3
Einhergehend mit den thematisierten Machtstrukturen ist die Darstellung von Gewalt und Trauma. Die detaillierte, sensorisch geladene Beschreibung von Elins Stealthing-Erlebnisses veranschaulicht den körperlichen und psychischen Kontrollverlust infolge sexualisierter Gewalt.191 192 Aber auch institutionelle Gewalt wird innerhalb des Romanes skizziert, wenn ein Polizist über ein Megafon die Frauen als Bedrohung darstellt.193 Dies Passage weist auf einen vermeintlichen systematischen Machtmissbrauch durch staatliche Institutionen hin. Diese Szenen können die Leser*innen dazu auffordern, sich mit den Mechanismen von Gewalt, Ungerechtigkeit und sozialer Ausgrenzung auseinanderzusetzen, und entfalten damit ihr Potential zur Stärkung eines Bewusstseins für die damit verbundenen Traumata. Die detaillierte und oft fragmentarische Darstellung von Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung erzeugt damit eine unmittelbare emotionale Resonanz. Die sensorischen Beschreibungen, wie beispielsweise „die weißen Schlieren“ 194 zwischen Elins Beinen fordern die Leser*innen dazu auf, sich das Trauma bildlich vorzustellen, was Empathie und Mitgefühl wecken kann. 195 196 197 198 199 200 201 202 203
Die eingeschobene symbolische Darstellung der Gebärmutter und der Pistole erinnern dabei zusätzlich an reale gesellschaftliche Machtmissbräuche und lässt Leser*innen Parallelen zu aktuellen Debatten über Geschlechtergerechtigkeit und institutionelle Gewalt ziehen. Diese Darstellungsweise kann eine tiefgehende emotionale Auseinandersetzung mit den Themen fördern und zu einer reflexiven, kritischen Betrachtung gesellschaftlicher Ungleichheiten einladen. 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
4. Didaktische Hinweise für den Literaturunterricht in der Sekundarstufe II
Im Rahmen dieses Kapitels werden konkrete didaktische Hinweise für die Thematisierung von Perspektivübernahme und Empathiebildung mithilfe von Fallwickls „Und alle so still“ vorgestellt. Zunächst widmet sich der Abschnitt 4.1 der Beschreibung von Perspektivübernahme und Reflexion als didaktische Ziele, sowie dem Potential einer Analyse von Figurenperspektiven und der kritischen Reflexion gesellschaftlicher Rollenbilder. 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Im darauffolgenden Unterkapitel 4.2.1 soll dann erläutert werden, wie eine kompetenzorientierte Evaluation der erlernten Fähigkeiten erfolgen kann. Ebenfalls wird ein Ausblick auf einen potentiellen Transferansatz skizziert.233 234
4.1. Perspektivübernahme und Reflexion als didaktische Ziele
Perspektivübernahme ist zentral, weil der Roman durch seine multiperspektivische Erzählstruktur den Schüler*innen ermöglicht, unterschiedliche Lebenswelten und gesellschaftliche Realitäten kennenzulernen. Indem sie sich in die subjektiven Sichtweisen von Figuren wie Elin, Nuri und Ruth einfühlen, erweitern sie nicht nur ihr Textverständnis, sondern entwickeln auch Empathie und kritisches Bewusstsein gegenüber sozialen Ungleichheiten. Diese Fähigkeit, alternative Perspektiven einzunehmen, ist essenziell, um die vielschichtigen Machtverhältnisse und normative Diskurse - etwa in Bezug auf Geschlechterrollen und Migration - zu hinterfragen und als Grundlage für ein reflektiertes Selbstverständnis zu nutzen.235 Spinner benennt konkret: „Die Perspektivenübernahme ist eine Fähigkeit, für die der Deutschunterricht in besonderem Maße zuständig ist.“236 Die Reflexion im Roman ermöglicht es, individuelle Erlebnisse mit größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen zu verknüpfen. Durch die kritische Auseinandersetzung mit den inneren Monologen und den multiperspektivischen Darstellungen werden nicht nur die persönlichen Konflikte der Figuren, sondern auch die dahinterliegenden sozialen Machtstrukturen sichtbar. Dies kann die Leser*innen dazu anregen, ihre eigenen Vorannahmen zu hinterfragen und Parallelen zu aktuellen Debatten über Geschlechtergerechtigkeit, Care- Arbeit und Migration zu ziehen.
Die Reflexion dient somit als Katalysator, der literarisches Verstehen mit gesellschaftlicher Kritik verbindet und einen Raum schafft, in dem individuelle und kollektive Identitätsfragen diskutiert werden können.237 Die Fokussierung auf Perspektivübernahme und Reflexion als Unterrichtsziele stützt sich auf aktuelle didaktische Ansätze und Kompetenzmodelle, die literarisches Verstehen als einen interdisziplinären Prozess begreifen. Modelle wie die 11 Aspekte literarischen Lernens von Spinner betonen die Bedeutung der Perspektivübernahme für Empathie, kritisches Denken und die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Diskursen.238 Die Legitimation der Perspektivübernahme und der Empathiebildung als didaktische Ziele, durch das Kerncurriculum und die Bildungsstandards wurde bereits in Kapitel 2.4 erläutert. Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle aber festhalten, dass explizit die Förderung von Perspektivübernahme gefordert wird, da sie als Grundlage für ein ganzheitliches, reflexives Textverständnis und die Entwicklung eines gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekts gilt. Somit werden literarische und gesellschaftliche Kompetenzen gleichermaßen gestärkt, was die Auswahl dieser Ziele für den Unterricht an modernen didaktischen Konzepten orientiert.239
Die Fokussierung auf Perspektivübernahme und Reflexion im Unterricht stützt sich auf mehrere theoretischen Ansätze, die sowohl literatur- als auch empathietheoretische Modelle umfassen.240 Spinner und Kloppert betonen beispielsweise, dass literarisches Verstehen eng mit der Fähigkeit zur Perspektivübernahme verbunden ist. Spinner sieht in der Perspektivübernahme einen zentralen Mechanismus, um narrative Texte nicht nur kognitiv zu erfassen, sondern auch emotional und moralisch zu reflektieren.241 Gleichzeitig hebt die empathietheoretische Sichtweise hervor, dass die Übernahme fremder Perspektiven als Voraussetzung für empathisches Verständnis und kritische Selbstreflexion gilt. Diese Ansätze legen nahe, dass das Einnehmen anderer Blickwinkel sowohl zur Dekonstruktion gesellschaftlicher Normen als auch zur Entwicklung eines differenzierten Selbstverständnisses beiträgt.242 Die Förderung von Perspektivübernahme und Reflexion zielt darauf ab, Schüler*innen dazu anzuregen, ihre eigenen Vorannahmen sowie die gesellschaftlichen Diskurse kritisch zu hinterfragen.
Durch den Wechsel zwischen verschiedenen Figurenperspektiven lernen sie, die Komplexität sozialer Machtverhältnisse, Geschlechterrollen und kultureller Zuschreibungen zu erkennen. Dieser Prozess stärkt das kritische Denken, da er die Fähigkeit schult, widersprüchliche Informationen zu synthetisieren und normative Erwartungen zu dekonstruieren.243 Gleichzeitig wird durch die intensive Auseinandersetzung mit den emotionalen und gedanklichen Zuständen der Figuren - etwa durch interne Monologe und multiperspektivische Erzählweisen - ein empathisches Verständnis für die Erfahrungen anderer ermöglicht. Die Reflexion der eigenen Wahrnehmung und die kritische Bewertung von Medien- und Alltagsdiskursen tragen so zur Entwicklung einer reflektierten, selbstkritischen Haltung bei, die als Grundlage für ein verantwortliches gesellschaftliches Handeln gelten kann.244 Durch die intensive Auseinandersetzung mit Perspektivübernahme und Reflexion sollen Schüler*innen ein breites Spektrum an Kompetenzen entwickeln. Die Fähigkeit, komplexe Narrative zu analysieren, unterschiedliche Sichtweisen zu erkennen und kohärent zu integrieren, soll gestärkt werden. Dies umfasst das kritische Hinterfragen von Machtstrukturen und die Synthese von Informationen aus verschiedenen Perspektiven.245 Indem Schüler*innen die inneren Konflikte und emotionalen Reaktionen der Figuren nachvollziehen, lernen sie, sich in andere hineinzuversetzen und empathisch auf deren Erfahrungen zu reagieren. Diese Fähigkeit fördert die Sensibilität gegenüber gesellschaftlichen Ungleichheiten und marginalisierten Gruppen.246
Die Auseinandersetzung mit den eigenen Wahrnehmungen und Vorannahmen wird angeregt, wodurch Schüler*innen lernen, ihre eigene Identität in Bezug auf gesellschaftliche Normen und Werte zu reflektieren. Dies unterstützt die Entwicklung eines differenzierten Selbstverständnisses und die Fähigkeit, persönliche sowie kollektive Handlungsspielräume kritisch zu bewerten.247 Durch methodische Zugänge wie Diskussionen, Rollenspiele oder kreative Schreibaufgaben wird nicht nur das literarische Verständnis vertieft, sondern auch die Fähigkeit zur argumentativen Auseinandersetzung und zur Kommunikation komplexer Ideen gefördert.248
Diese Kompetenzentwicklung orientiert sich an aktuellen Bildungsstandards und didaktischen Konzepten, die literarisches Verstehen als einen interdisziplinären, reflexiven und empathieorientierten Prozess verstehen. Somit kann der Unterricht mit „Und alle so still“ die Schüler*innen darauf vorbereiten, sich in einer komplexen, pluralistischen Gesellschaft kritisch und selbstbewusst zu positionieren.[249] Die Integration von Perspektivübernahme und Reflexion als zentrale didaktische Ziele in den Unterricht mit „Und alle so still“ ermöglicht es Schüler*innen, nicht nur literarische Texte zu verstehen, sondern auch ihre eigene Haltung gegenüber gesellschaftlichen Machtstrukturen und Geschlechterrollen kritisch zu hinterfragen. Zudem ist es zielführend, wenn Reflexion als Schlüsselkompetenz etabliert wird. Die didaktische Zielsetzung basiert darauf, dass die multiperspektivische Erzählstruktur des Romans den Schüler*innen erlaubt, verschiedene Sichtweisen einzunehmen und die Widersprüche zwischen individuellen Erfahrungen und gesellschaftlichen Normen sichtbar zu machen. Dies kann erreicht werden, indem Perspektivübernahme als Lernziel formuliert wird: Die Schüler*innen sollen in der Lage sein, sich in die unterschiedlichen subjektiven Welten von Elin, Nuri und Ruth hineinzuversetzen. Dabei wird der Roman als Medium genutzt, um zu verdeutlichen, wie individuelle Identitätsprozesse im Spannungsfeld von Macht und sozialer Ungleichheit entstehen.
Neben der Analyse der Textinhalte werden die persönlichen und gesellschaftlichen Implikationen, die sich aus den dargestellten Perspektiven ergeben, thematisiert. Dies schließt die kritische Auseinandersetzung mit medial vermittelten Narrativen und normativen Erwartungen an Geschlecht und Herkunft ein. Zur Förderung von Perspektivübernahme und Reflexion können verschiedene Methoden und Arbeitsformen eingesetzt werden, die den interaktiven und handlungsorientierten Unterricht in der SEK II in Niedersachsen unterstützen. In moderierten Diskussionen werden zentrale Themen wie Care-Arbeit, toxische Männlichkeitsbilder und die mediale Inszenierung von Identität thematisiert. Durch den Austausch in Kleingruppen können Schüler*innen verschiedene Sichtweisen analysieren und reflektieren. Diese Methode ordnet sich der sogenannten Dialogdidaktik unter.[250] Ein konkretes Beispiel wäre eine Diskussionsrunde zu Ruths Erfahrungen in der Pflege.[251] Diese Diskussion kann das Verständnis dafür fördern, wie unsichtbare Arbeit zur strukturellen Benachteiligung beiträgt.
Kreative Schreibaufgaben, in denen Schüler*innen etwa aus der Perspektive von Elin, Nuri oder sogar einer nicht-menschlichen Erzählinstanz einen Text verfassen, ermöglichen es ihnen, sich intensiv mit den individuellen Gedanken- und Gefühlswelten auseinanderzusetzen.249 Ein konkretes Beispiel wäre hier ein Tagebucheintrag, der die Elins Stealthing-Erlebnis reflektiert.250 Dies kann nicht nur die Perspektivübernahme und die Empathiebildung fördern, sondern auch die Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt und den damit verbundenen Identitätskonflikten.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Fokussierung auf Perspektivübernahme und Reflexion als zentrale didaktische Ziele im Unterricht mit „Und alle so still“ eine fundierte theoretische Basis besitzt, wie sie in den fachdidaktischen Ausführungen dargelegt wird. Der Roman eröffnet den Schüler*innen einen intensiven Einblick in die subjektiven Wahrnehmungen von Elin, Nuri und Ruth, wodurch sowohl individuelle Konflikte als auch gesellschaftliche Machtstrukturen und normative Diskurse sichtbar werden.
4.2 Analyse von Figurenperspektiven und kritische Reflexion gesellschaftlicher Rollenbilder
Wie bereits in vorherigen Kapiteln erläutert, kann die Darstellung vielfältiger Figurenperspektiven dazu dienen, vielfältige Wahrnehmungen zu fördern. Die verschiedenen Figurenperspektiven können nicht nur individuelle Erfahrungen, sondern auch gesellschaftliche Machtstrukturen, Geschlechterrollen und normative Erwartungen widerspiegeln. Die Auseinandersetzung mit diesen Perspektiven kann den Schüler*innen Einblicke in die komplexe Konstruktion gesellschaftlicher Rollenbilder eröffnen.251 Indem Lernende die Sichtweisen der Figuren nachvollziehen, entfaltet sich das Potential zur Empathiebildung. Die Schüler*innen werden angeregt, stereotype Vorstellungen zu hinterfragen. Das kann eine reflektierte Haltung gegenüber vorherrschenden Normen fördern und ermöglicht es, alternative Sichtweisen zu entwickeln.252 Die Übernahme von Figurenperspektiven kann es den Lernenden ermöglichen, sich mit den inneren Konflikten der Figuren auseinanderzusetzen.
Dadurch werden sie befähigt, eigene Erfahrungen zu reflektieren und normative Erwartungen kritisch zu hinterfragen.253 Die Analyse von Figurenperspektiven und die kritische Reflexion gesellschaftlicher Rollenbilder anhand von Fallwickls „Und alle so still“ eignet sich nicht zuletzt deshalb, weil es aufgrund der Aktualität der Themen die Schüler*innen aus ihrer Lebenswelt abholen kann. Gesellschaftliche Debatten über Identität, Geschlechterrollen, Inklusion und Diversität finden ständig statt. Literarische Figuren und deren Konflikte bieten einen direkten Zugang, um diese Themen in den Unterricht zu integrieren und mit den Lebenswelten der Lernenden zu verknüpfen. Durch die interkulturelle Analyse von Figurenperspektiven kann es möglich werden, theoretische Konzepte praxisnah zu vermitteln. Die Schüler*innen können so einen direkten Bezug zu aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen herstellen und ihre eigene Lebensrealität reflektieren. Indem sie literarische Figuren betrachten, die oft komplexe (interkulturelle) Identitäts- und Rollenkonflikte durchleben, werden die Schüler*innen angeregt, ihre eigenen Vorstellungen von Identität und gesellschaftlichen Normen zu hinterfragen. Standke und Spinner fassen das Potential der Fremd- und Selbstreflexion im Rahmen des Literaturunterrichts treffend zusammen:
„Solche von der Romanlektüre ausgehenden Transferprozesse setzen anhand ausgewählter Textstellen beim Vergleichen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Lebensräume und Alltagserfahrungen Jugendlicher in Familie, Schule und Freizeit an.“254
Die Perspektiven der Hauptprotagonist*innen aus „Und alle so still“ eignen sich besonders gut für die Analyse von Figurenperspektiven und zur Reflexion gesellschaftlicher Rollenbilder. Elins Darstellung als Influencerin bietet einen vielschichtigen Zugang zu Fragen der Selbstinszenierung, Identitätskonstruktion und der medienvermittelten Selbstwahrnehmung. Gleichzeitig wird auf die Herausforderungen im Sinne von Hate Speech im Netz hingewiesen, die Elin als Influencerin erlebt.255 Solche Szenen öffnen Türen, um zu hinterfragen, wie die ständige Präsenz in sozialen Medien nicht nur das Selbstbild beeinflusst, sondern auch durch aggressiven und oft diskriminierenden Online-Kommentar beeinflusst wird, beispielsweise durch Shitstorms oder gezielte Anfeindungen, wie sie auch im Rahmen des stillen Protestes erfolgen. Frauen werden online beispielsweise als die „ grausigen Dreckshuren “256 beschimpft.
Elins Perspektive eignet sich somit insbesondere, um Schüler*innen den Übergang zwischen analoger und digitaler Identität näherzubringen und die Auswirkungen von digitalen Diskursen auf Selbstwahrnehmung und gesellschaftliche Rollenbilder zu reflektieren. Nuris Perspektive repräsentiert nicht nur den Konflikt zwischen idealisierten Männlichkeitsvorstellungen und den harten Realitäten prekärer Lebensverhältnisse, sondern integriert auch einen interkulturellen Ansatz, der seine Migrationsgeschichte in den Mittelpunkt rückt. Sein erklärter Vorsatz, sich nicht auf stereotype, oberflächliche Rollenbilder einzulassen, kann einen Diskurs über die sozialen und kulturellen Dimensionen von Männlichkeit eröffnen.257 Durch die Einbeziehung seiner Migrationsgeschichte wird deutlich, wie transnationale Identitätsprozesse und interkulturelle Begegnungen die Konstruktion von Geschlechterrollen maßgeblich beeinflussen können. Nuris Doppelbelastung kann es ermöglichen, Schüler*innen aufzuzeigen, dass Geschlechterrollen in verschiedenen kulturellen Kontexten variieren und verhandelt werden.
Die Figur der Ruth, die sowohl berufliche als auch familiäre Belastungen verkörpert, eröffnet einen Zugang zur Analyse von Care-Arbeit und institutionellen Strukturen. Ihre stille, aber empathische Art fungiert als Symbol für den oft unsichtbaren Wert von Sorgearbeit. Ruths Perspektive kann die Lernenden dafür sensibilisieren, wie normative Rollenzuschreibungen in beruflichen und privaten Kontexten reproduziert werden. Diese Sichtweise trägt zur kritischen Reflexion gesellschaftlicher Machtverhältnisse bei. Nachfolgend soll eine Auswahl geeigneter Methoden zur Analyse der Figurenperspektive und zur Reflexion gesellschaftlicher Rollenbilder erläutert werden.
Eine potentiell geeignete Methode wäre das Close Reading. Close Reading als eine literaturdidaktische Methode fördert das literarische Verstehen, indem es die intensive Auseinandersetzung mit dem Text betreibt und das Werk „von innen“ heraus verstehen will.258 Es handelt sich also um eine Methode, bei der sich die Bedeutung eines Textes werkimmanent erschließt. Dies geschieht durch eine intensive und wiederholte Beschäftigung ausschließlich mit dem Text. Kommentare und Sekundärtexte sind dabei zunächst überflüssig. Zergliedernde und strukturale Analyse sowie bedeutungszuweisende Interpretation ergänzen sich wechselseitig. Die Schüler*innen sollen unter der Verwendung des Close Reading Verfahrens lernen, zentrale Textpassagen differenziert zu analysieren und die narrative Technik sowie die Darstellung von Rollenbildern herauszuarbeiten.259
Szenen wie die erste Beschreibung von Elin auf den Seiten 15 bis 19 eignen sich besonders gut für die Verwendung des Close-Reading-Verfahrens, weil den Schülerinnen hier das Potential eingeräumt wird, sich in Elin hineinzuversetzen.[263] Das Verfahren sollte durch ausgewählte Reflexionsfragen angeleitet werden. Auch Rollenspiele könnten sich zur Behandlung des Romanes anbieten. Die literarische Gestaltung des Romans ist auf Empathie und Perspektivübernahme angelegt, weshalb ein Eintauchen in die verschiedenen Perspektiven unabdingbar scheint.
Rollenspiele eignen sich deshalb, weil „ Lebenswelten erprobend gestaltet und verpönte, utopische, schablonisierte, kreative Lebensentwürfe in Szene gesetzt “[264] werden. Empathiebildung wird dabei als eines der zentralsten (Kompetenz-) Ziele von Rollenspielen benannt, denn für die vortragenden und die zuschauenden Schüler*innen ist es gleichermaßen elementar, sich in andere hineinversetzen zu können. Nur so können sie aufgezeigte Verhaltensweisen nachvollziehen und beurteilen.[265] Konkrete Stellen aus Fallwickls Roman, die sich für Rollenspiele eignen, sind vor allem Szenen rund um Nuri. So könnte Nuris Erinnerung an den Elternsprechtag, als Szene für ein Rollenspiel dienen.[266] Diese Szene kann als Ausgangspunkt dienen, um Rollenspiele zu initiieren, in denen Schüler*innen in Nuris Perspektive schlüpfen und die emotionale Belastung, die aus seiner Migrationsgeschichte resultiert, nachvollziehen. Aber auch die Perspektive der Mutter, die im Roman dahingehend gar nicht beleuchtet wird, kann hierbei erlebt und beschrieben werden.
Kreative Schreibaufgaben, wie beispielsweise Tagebucheinträge, eignen sich in vielerlei Hinsicht als Methode zur Analyse von Figurenperspektiven und zur Reflexion gesellschaftlicher Rollenbilder. Die Verfahren zielen auf Momente der Perspektivübernahme und können das emotional-intuitive Verstehen fördern. Kohärenzlücken werden bewusst hervorgehoben und bearbeitet, um das Verstehen der Perspektiven zu unterstützen. Die Schüler*innen können sich in Figuren oder Erzählinstanzen versetzen, durchdringen Perspektiven und füllen Kohärenzlücken kointentional.[267] Wie schon in vorherigen Kapiteln als zur Analyse geeignete Textpassage beschriebene Szene ist die rund um Elins Stealthing- Erlebnis.[268] Die Schüler*innen könnten hier vor dem Weiterlesen einen Tagebucheintrag aus Elins Sicht formulieren.
Diese Stelle eröffnet einen Zugang zur Reflexion über körperliche Empfindungen und deren symbolische Bedeutung im Kontext von Geschlechter- und Rollenkonflikten.
Nicht zuletzt sollten gerade unter Betrachtung der Thematisierung Sozialer Medien innerhalb des Romanes multimediale Methoden eine Beachtung finden. Ein integratives medienästhetisches Lernen ist in einem zeitgemäßen Literaturunterricht zwangsläufig notwendig, da die Schüler*innen alltäglich mit unterschiedlichen Erzählformen konfrontiert werden, auch außerhalb der Schule. Sobald sie Serien, Filme, Podcasts konsumieren oder Computerspiele spielen, begegnen ihnen diversen Erzählformen.260 Mediale Zugänge können in der Verknüpfung von literarischem und medienästhetischem Lernen die Vorstellungsfähigkeit der Schüler*innen erweitern und formen.261 Konkret könnten simulierte Social Media Beiträge oder Kommentarspalten analysiert werden, in denen Menschen ähnlichen digitalen Hass erfahren wie Elin. Die Passage, in der der Hass im Netz - insbesondere gegen Frauen - thematisiert wird, eignet sich zur Verknüpfung des Gelesenen mit aktuellen gesellschaftlichen Debatten:
„Frauen, die ins Internet schreiben, die sich im Internet zeigen, Frauen, die in der Welt sind, die einfach existieren, müssen mit Beschimpfungen rechnen. Sie weiß, dass die Quote bei Politikerinnen, die von Hass im Netz betroffen sind, bei hundert Prozent liegt. Irgendwann sind sie zermürbt und treten zurück. Dann fehlen ihre Stimmen im Parlament. Die Frauen fehlen überall, wo Entscheidungen getroffen werden.“262
Die Schüler*innen könnten beispielsweise dazu angeregt werden, nach eigner Recherche eine Kampagne gegen Hate-Speech im Netz zu entwerfen. In Kleingruppen könnten die Lernenden Konzepte für digitale Kampagnen erarbeiten, die sich gegen Hate-Speech richten. Hierbei wird die literarische Darstellung in „Und alle so still“ als Ausgangspunkt genutzt, um zu reflektieren, wie digitale Räume reformiert werden könnten. Denkbar wäre dabei der Einsatz von Tools zur Erstellung von Videos, Podcasts oder Social-Media-Posts, in denen sie alternative Narrative präsentieren und somit den in der Passage dargestellten Negativeffekt (das Zurücktreten von Frauen) kontrastieren.
Die Analyse von Figurenperspektiven bietet damit ein breites didaktisches Potential für den Literaturunterricht. Durch die vielfältigen Darstellungen von Identität, Rollenbildern und gesellschaftlichen Normen in „Und alle so still“ erhalten Schüler*innen die Möglichkeit, individuelle und kollektive Erfahrungen kritisch zu reflektieren.
4.3 Evaluation und Transfer von Perspektivübernahme und Empathiebildung
Formuliert man Perspektivübernahme und Empathiebildung als Lernziele, ist eine Evaluation des Lernfortschrittes unabdingbar. Dies schließt sowohl die benotete als auch die unbenotete Bewertung des Lernfortschrittes ein.263 Eine mögliche Methode zur Evaluierung des Lernfortschrittes stellt dabei die Anfertigung von Lese-Tagebüchern dar. Die Schüler*innen dokumentieren in diesem Tagebuch oder Journal, parallel zur reflexiven Lektüre des Romans, ihre Gedanken, Wahrnehmungen, emotionalen Reaktionen und ersten interpretatorischen Erkenntnisse.264 Das Anfertigen eines Lese-Tagebuchs kann metakognitive Prozesse der Selbstwahrnehmung fördern. Für die Lehrkräfte bietet es die Möglichkeit, individuelle Entwicklungsschritte der Lernenden nachzuvollziehen. Außerdem kann es als ein qualitatives Material verwendet werden, um anhand vordefinierter Kriterien eine Bewertung durchzuführen.265 Ein anderer, sehr ähnlicher Ansatz besteht in der Portfolioanalyse. Das Portfolio der Schüler*innen setzt sich aus verschiedenen Aufgabenergebnissen, wie beispielsweise Essays, kreativen Schreibaufgaben, digitalen oder künstlerischen Projekten, zusammen. Das Portfolio wird im Verlauf der Unterrichtseinheit zum Roman kontinuierlich geführt. Der langfristige Sammelprozess erlaubt damit einerseits eine Bestandsaufnahme des Wissenszuwachses, aber auch eine Erfassung der Weiterentwicklung interpretatorischer und reflexiver Kompetenzen im Bereich der Perspektivübernahme, der Schüler*innen.266 Dawidowski beschreibt die Beurteilung eines Portfolios als eine prozessorientierte Leistungsbeurteilung. Der Fokus liegt hier auf der Bewertung von Arbeitstechniken und der Dokumentation individueller Arbeitsprozesse der Lernenden. Die Anfertigung eines Kriterienkataloges zur Bewertung, durch die Lehrkraft schafft eine transparente Basis und ermöglicht den Schüler*innen während des Arbeitsprozesses Phasen der Selbstreflexion.267
Ergänzend zu diesen zwei Ansätzen können strukturierte Feedbackgespräche und PeerReviews ein geeignetes Instrument zur Evaluation sein. In Einzel- oder Gruppengesprächen kann der individuelle Fortschritt der Lernenden besprochen werden. Der Fokus liegt hierbei auf dem Verstehen multiperspektivischer Texte und dem Entwickeln von Empathie. Theoretische Ausführungen im Rahmen der dialogischen Pädagogik belegen die Eignung dieses Ansatzes, indem sie die Bedeutung von Kommunikation und dem wechselseitigen Feedback für die Lernentwicklung eindeutig betonen. Dieser Ansatz unterstützt einen Lernprozess, der den Schüler*innen dabei helfen kann, ihre eigenen Stärken und Verbesserungspotentiale zu erkennen.268 Peer-Reviews zeichnen sich außerdem durch eine reduzierte Lehrer*innenbeteiligung aus. Schüler*innen äußern sich in der Regel freier ohne Bewertungsdruck durch die Lehrkraft. Lehrer*innen sollten zeitweise auf Eingriffe verzichten, damit Schüler*innen selbstständige Diskurse erlernen können. Stattdessen sollten die Eingriffe der Lehrkräfte gezielt erfolgen. Das Eingreifen der Lehrkraft ist beispielsweise bei rudimentärem Verstehen oder mangender Artikulationsfähigkeit notwendig. Ohne Steuerung durch die Lehrkraft könnten Peer-Reviews ihre Struktur verlieren und Ziele somit in den Hintergrund rücken, wenn Schüler*innen abschweifen.269 Ein zentraler Bestandteil der didaktischen Umsetzung ist die systematische Förderung von Perspektivübernahme durch gezielte Unterrichtssequenzen. Im Rahmen einer exemplarischen Unterrichtseinheit wird aufgezeigt, wie narratologische Analysen mit kreativen Methoden zur Empathiebildung verbunden werden können (siehe Anhang 1: Verlaufsplan für eine Unterrichtseinheit).
Die durch Fallwickls Roman erworbenen Fähigkeiten im Umgang mit multiperspektivischen Texten entfalten ihr Potential für einen Transfer in andere literarische Kontexte oder gesellschaftliche Diskurse. Analyseverfahren, die zur Erschließung des Romanes genutzt wurden, können systematisch auf andere literarische Werke angewendet werden. Vergleichende Textanalysen können dazu beitragen, narrative Strukturen und Rollenbilder in unterschiedlichen literarischen Gattungen zu identifizieren und in einen breiteren gesellschaftlichen Kontext einzuordnen.270
Bei der Evaluation und beim Transfer von Perspektivübernahme und Empathiebildung können mehrere Herausforderungen auf die Lehrkraft zukommen. Die Komplexität multiperspektivischer Texte stellt dabei eine der primären Herausforderungen dar.
Gemäß der Lernzielformulierung, sollten Schüler*innen dazu in der Lage sein, unterschiedliche Erzählperspektiven, innere Monologe und narrative Wechsel zu identifizieren und zu differenzieren. Diese komplexen Forderungen können zu kognitiver Überforderung führen, die sich aber durch eine adäquate didaktische Vorbereitung verhindern beziehungsweise minimieren lässt.
Die Behandlung solcher Texte erfordert seitens der Schülerinnen ein hohes Maß an Vorwissen und analytischen Fähigkeiten.271 Kloppert fasst die Ausführungen von Andringa und Rietz zusammen und stellt fest, dass Schüler*innen frühstens ab Klasse acht zur Perspektivintegration fähig sind. Diese Feststellung legitimiert eine Thematisierung von Perspektivübernahme und Empathiebildung in der SEK II.272 Aber auch der Literaturunterricht in der SEK II zeichnet sich durch eine hohe Heterogenität der Schüler*innen aus, sowohl in Bezug auf ihre sprachlichen und analytischen Fähigkeiten als auch auf ihre individuelle Lesebiografie und Motivation. Um diesem Umstand gerecht zu werden, erfordert die Arbeit mit dem Roman „Und alle so still“ gezielte Differenzierungsmaßnahmen. Eine Möglichkeit der inneren Differenzierung besteht in der gestuften Aufgabenstellung. Ein weiterer Ansatz ist die methodische Differenzierung durch unterschiedliche Zugänge zum Text. Auch die kooperative Differenzierung kann genutzt werden, indem Schüler*innen mit unterschiedlichen Stärken gezielt in Gruppen zusammenarbeiten. Tandembildung (z. B. durch das „Lesetandem“-Verfahren) kann dabei helfen, individuelle Leseschwierigkeiten zu überwinden und das Textverständnis gemeinsam zu erarbeiten. Durch diese differenzierten Zugänge wird sichergestellt, dass alle Schüler*innen die Chance haben, sich auf ihrem individuellen Niveau mit dem Roman auseinanderzusetzen und sowohl kognitive als auch empathische PerspektivübernahmeKompetenzen zu entwickeln.
In Bezug auf Fallwickls Roman „Und alle so still“ lässt sich außerdem die Auseinandersetzung mit sensiblen Themen, wie Hate-Speech, Geschlechterdiskriminierung oder interkulturellen Konflikten, als eine elementare Herausforderung benennen. Solche sensiblen Themen können eine emotionale Belastung darstellen und bei den Schüler*innen vielfältige intensive Reaktionen hervorrufen. Diese potentielle Emotionalität kann den Lernprozess sowohl positiv als auch potentiell störend beeinflussen. Entscheidend ist es hier einen sensiblen Lernraum zu schaffen.
Bereits vor Beginn des Arbeitsprozesses am Buch sollten Lehrkräfte einen Rahmen schaffen, in dem die Schüler*innen ihre Emotionen und Vorbehalte offen äußern können.273 Um Lehrkräfte bei der praktischen Umsetzung zu unterstützen, wurde ein Leitfaden entwickelt, der methodische Ansätze zur Thematisierung von Perspektivübernahme und Empathiebildung im Literaturunterricht bietet. Neben Kriterien zur Auswahl geeigneter Romane enthält er Hinweise zu Aufgabenformaten sowie Anregungen zur kreativen und analytischen Auseinandersetzung mit multiperspektivischem Erzählen (siehe Anhang 2: Leitfaden für Lehrkräfte).
Zusammenfassend gilt es noch festzuhalten, dass ausschließlich die kognitive Perspektivübernahme bewertbar ist. Die emotionale Perspektivübernahme ist ein stark subjektiver und individueller Prozess und aus diesem Grund nicht beurteilbar.274
5. Ausblick
Die vorliegende Arbeit zeigt auf, dass die Förderung von Perspektivübernahme und Empathiebildung im Literaturunterricht der SEK II weit über die bloße Analyse einzelner Texte hinausgeht. Die Funktion literarischer Texte bietet weitaus mehr als nur einen ästhetischen Zugang zur Sprache. Sie bieten darüber hinaus die Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit fremden Sichtweisen und Identitätskonstruktionen. Insbesondere multiperspektivisch angelegte Texte, wie Fallwickls „Und alle so still“ entfalten ein enormes Potential, um diese Prozesse gezielt zu unterstützen. In Bezug auf die Forschungsfragen, die der Arbeit zu Grunde lagen, lässt sich Folgendes festhalten:
I. Wie kann Fallwickls Darstellung der Protagonist*innen als literarisches Mittel im didaktischen Kontext genutzt werden, um Perspektivübernahme zu fördern?
Fallwickls Darstellung der Protagonistinnen in „Und alle so still“ bietet vielfältige Möglichkeiten, im didaktischen Kontext die Perspektivübernahme der Schüler*innen zu fördern. Der Roman präsentiert die Handlung aus den personalen Perspektiven der drei Hauptfiguren Elin, Nuri und Ruth. Diese multiperspektivische Anlage ermöglicht es den Schüler*innen, ein und dasselbe Geschehen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu erleben. Dies kann im Unterricht genutzt werden, indem beispielsweise zentrale Szenen aus der Sichtweise verschiedener Protagonistinnen analysiert und verglichen werden. Zudem erweitert Fallwickl das Spektrum durch unkonventionelle Erzählinstanzen wie die Gebärmutter, die Pistole und die Berichterstattung. Diese ungewöhnlichen Perspektiven können im Unterricht dazu anregen, gesellschaftliche Strukturen und Themen wie Macht, Gewalt und Körperlichkeit aus einer entfremdeten oder symbolischen Warte zu betrachten. Die Lebenswelten von Elin, Nuri und Ruth sind sehr unterschiedlich. Ihre Perspektiven sind durch kulturelle, soziale und persönliche Faktoren wie Alter, Geschlecht, Herkunft und gesellschaftliche Position geprägt. Im Unterricht kann diese Diversität genutzt werden, um die Subjektivität von Wahrnehmung zu verdeutlichen und die Auseinandersetzung mit verschiedenen sozialen Positionen und Erfahrungen anzuregen. Die variierende Sprache, die Fallwickl für die jeweiligen Figuren verwendet, kann im Unterricht analysiert werden, um zu verstehen, wie Sprache die Perspektive einer Figur prägt und widerspiegelt. Die Protagonist*innen durchlaufen Veränderungsprozesse, die eng mit Selbstreflexion und gesellschaftlichen Machtverhältnissen verbunden sind. Die Auseinandersetzung mit diesen inneren Prozessen der Figuren kann bei den Schüler*innen Empathie fördern, indem sie Einblicke in die Motivationen und Gefühlswelten der Figuren erhalten.
II. Welche literaturdidaktischen Strategien bieten Potential zur Reflexion von Geschlechter- und Rollenbildern und zur empathischen Auseinandersetzung?
Die in der vorliegenden Arbeit skizzierten literaturdidaktischen Strategien berücksichtigen sowohl kognitive als auch emotionale Aspekte des Textverstehens und regen zu einer aktiven Auseinandersetzung mit den Texten an. Besonders relevant sind dabei Handlungs- und produktionsorientierte Verfahren. Diese Verfahren zielen auf eine emotionale und motivationsfördernde Beschäftigung mit dem Text ab. Analytische Verfahren bilden das passende Gegenstück. Sie streben ein tieferes Verständnis der Textstrukturen und der Perspektivgestaltung an. Weitere Strategien bilden reflexive Verfahren, wie beispielsweise gesprächsdidaktische Verfahren, die zum Diskutieren und Reflektieren anregen sollen. Es ist an dieser Stelle nochmals wichtig zu betonen, dass bei der Förderung von Empathie eine unreflektierte Identifikation vermieden werden sollte. Stattdessen sollte ein Bewusstsein für die Unterscheidung zwischen eigenen und fremden Emotionen geschaffen werden. Das Konzept der Ekpathie kann hierbei helfen, eine distanzierte Auseinandersetzung mit den Figuren zu fördern. Die Analyse der Erzählperspektive, der Figurenperspektiven und der Sympathielenkung im Text ermöglicht es, die Perspektiven nicht nur emotional zu erfassen, sondern auch in ihrem Kontext zu verstehen.
III. Wie lassen sich narrative Mittel wie Perspektivwechsel und Figurenkonstellationen gezielt einsetzen, um kritisches Denken und soziale Sensibilität bei Schüler*innen anzuregen?
Narrative Mittel wie Perspektivwechsel und Figurenkonstellationen lassen sich gezielt einsetzen, um kritisches Denken und soziale Sensibilität bei Schüler*innen anzuregen, indem sie die Vielschichtigkeit von Realität und die Subjektivität von Wahrnehmung erfahrbar machen. Durch den Einsatz multiperspektivischen Erzählens, bei dem dasselbe Geschehen aus verschiedenen Blickwinkeln dargestellt wird, erkennen Schüler*innen, dass es nicht nur eine gültige Perspektive gibt und die Wahrheit oft im Auge des Betrachters liegt. Dies fördert kritisches Denken, indem es dazu anregt, unterschiedliche Interpretationen zu hinterfragen und eigene Vorannahmen zu reflektieren. Der Wechsel in die personalen Perspektiven verschiedener Figuren ermöglicht es den Schüler*innen, Gedanken, Gefühle und Handlungsgründe dieser Figuren nachzuvollziehen. Dies schafft die Basis für Empathie und hilft, fremde Erfahrungsweisen zu verstehen. Narrative Mittel wie nicht-menschliche Erzählinstanzen können eine Distanz zur Figurenwelt erzeugen. Diese Distanz kann kritisches Denken anregen, indem sie es ermöglicht, die Handlungen und Motive der Figuren kritisch zu bewerten und übergeordnete Kontexte zu reflektieren.
Durch den gezielten Wechsel der Perspektive können Machtverhältnisse und gesellschaftliche Normen sichtbar gemacht und kritisch hinterfragt werden. Indem Schüler*innen beispielsweise die Diskrepanz zwischen der individuellen Erfahrung sexualisierter Gewalt (Elins Perspektive) und der distanzierten medialen Berichterstattung (nicht-menschliche Perspektive) analysieren, können sie die Konstruktion von Realität und die Rolle von Medien kritisch reflektieren. Die Art und Weise, wie Figuren konzipiert sind und wie ihre Perspektiven präsentiert werden, kann Identifikationsprozesse oder Distanzierung bei den Leser*innen hervorrufen. Die Reflexion darüber, warum bestimmte Figuren Sympathie oder Ablehnung hervorrufen, fördert das kritische Bewusstsein für die Lenkungsmechanismen von Texten und die eigenen Wertvorstellungen. Die Konstellation von Figuren, die in unterschiedlichen sozialen Kontexten agieren und miteinander in Konflikt geraten (z.B. in Bezug auf Macht, Gewalt, Diskriminierung), kann soziale Sensibilität schärfen und zu einer kritischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Problemen anregen.
Um die gewonnenen Erkenntnisse langfristig in den Literaturunterricht zu integrieren, bedarf es eines erweiterten Verständnisses von literarischem Lernen, das über die rein textimmanente Analyse hinausgeht. Perspektivübernahme sollte nicht nur als eine interpretative Kompetenz verstanden werden, sondern als eine literaturdidaktische Strategie, die es ermöglicht, sich aktiv mit anderen Denk- und Erfahrungshorizonten auseinanderzusetzen.275 Für Lehrkräfte bedeutet dies konkret, eine Unterrichtsgestaltung, die dynamische und interaktive Methoden einbindet - von kreativen Schreibaufgaben über performative Auseinandersetzungen bis hin zu digitalen Reflexionsformaten. Ein stärkerer Fokus auf multiperspektivisch angelegten Texten hat zudem das Potential einer zeitgemäßen, kritischen und intersektionalen Literaturdidaktik. Das hat zur Folge, dass Schüler*innen die Möglichkeit erhalten, Texte aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Dabei erwerben sie nicht nur literarische Kompetenzen, sondern auch ein tiefgehendes Verständnis für gesellschaftliche Ambivalenzen, Machtasymmetrien und individuelle Lebensrealitäten. Gerade in einer medial geprägten Welt, in der Narrative oft vereinfacht oder verkürzt werden, kann der bewusste Umgang mit komplexen Erzählperspektiven eine Grundlage für ein reflektiertes Urteilsvermögen schaffen.276
Die Basis für einen Literaturunterricht, der kritisches Denken fördert, bildet das Schaffen eines geschützten Raumes, indem die Lernenden ihre eigenen Wahrnehmungsmuster hinterfragen und alternative Denkweisen erproben können. Fallwickls „Und alle so still“ eröffnet dabei die Gelegenheit, um über aktuelle Themen, wie Geschlechterrollen, Machtstrukturen und mediale Präsenz zu sprechen. Perspektivübernahme und Empathiebildung können damit nicht nur als didaktisches Ziel, sondern als Bildungsaufgabe betrachtet werden, die weit über den eigentlichen Literaturunterricht hinaus reicht. Durch gezielte didaktische Impulse kann die Auseinandersetzung mit multiperspektivischen Erzählungen langfristig in den Unterricht integriert und nutzbar gemacht werden. Um das Potential zur Perspektivübernahme und zur Empathiebildung zu steigern, scheint es sinnvoll, die Schüler*innen aktiv an der Auswahl literarischer Werke zu beteiligen. Das Ziel sollte es sein, neben klassischen Schullektüren auch zeitgenössische Werke einzubeziehen, die aus feministischen, postkolonialen oder queeren Perspektiven erzählen. Die Schüler*innen könnten eigenständig Werke vorschlagen und über deren Einbindung in den Unterricht diskutieren. Dies würde nicht nur das Interesse an Literatur steigern, sondern auch die Partizipation der Lernenden fördern. Eine Erweiterung der didaktischen Methoden ermöglicht nicht nur eine tiefere Auseinandersetzung mit multiperspektivischen Erzählformen, sondern schafft auch neue Wege, um Literatur als Medium gesellschaftlicher Reflexion erfahrbar zu machen.
Die in dieser Arbeit entwickelten Ansätze zur Förderung von Perspektivübernahme und Empathiebildung lassen sich prinzipiell auf viele weitere (multiperspektivische) Romane übertragen. Vor allem literarische Texte, die Perspektivwechseln, fragmentierte Narrativen oder innere Monologe beinhalten, besitzen ein hohes didaktisches Potential für die Förderung von kritischem Textverstehen. Die methodische Verknüpfung von textanalytischen, kreativen und interaktiven Ansätzen, wie sie für „Und alle so still“ skizziert wurde, kann demzufolge auch auf andere Werke angewandt werden, um komplexe Erzählstrukturen für Schüler*innen zugänglich zu machen. Ein Beispiel aus dem Schullektürekanon wäre Juli Zehs „Corpus Delicti“. Zehs dystopischer Roman könnte in Hinblick auf Perspektivlenkung und Manipulation durch Sprache untersucht werden. Ein anderes, aber intersektionales, Beispiel ist Fatma Aydemirs „Dschinns“. Die vielfältigen Perspektiven einer migrantischen Familiengeschichte bieten sich an, über Macht und Migration zu reflektieren und dabei eine fremde Perspektive einzunehmen. Allgemein bietet die Auseinandersetzung mit feministischen, politischen und gesellschaftskritischen Erzählweisen im Unterricht einerseits große Chancen, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Eine zentrale Chance ist die Einbettung in aktuelle gesellschaftliche Diskurse.
Es wird eine aktive Auseinandersetzung mit Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Rassismus, sozialer Ungleichheit oder digitaler Gewalt gefördert, die unmittelbar mit der Lebenswelt der Lernenden verknüpft sind. Zu beachten gilt jedoch, dass die Behandlung etwaiger Texte eine sensible Unterrichtsgestaltung voraussetzt. Bestimmte Themen, etwa sexualisierte Gewalt oder strukturelle Diskriminierung, können emotional herausfordernd sein und sollten daher mit Reflexions- und Schutzräumen begleitet werden. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass Schüler*innen mit stark verfestigten Meinungen auf kontroverse gesellschaftliche Themen reagieren, weshalb es entscheidend ist, offene Diskussionsformate zu nutzen, die verschiedenen Sichtweisen zulassen, aber dennoch auf eine fakten- und literaturbasierte Argumentation bestehen.
Die vorliegende Arbeit und die skizzierten Ansätze beruhen auf literaturtheoretischen und fachdidaktischen Überlegungen, allen voran denen von Spinner. Er zeigt auf, dass empirische Untersuchungen diese Konzepte untermauern könnten, indem sie gezielt untersuchen, in welchem Maße Schüler*innen durch literarische Perspektivwechsel ihr eigenes Reflexionsvermögen und ihre Empathie Fähigkeit entwickeln. Dahingehend scheint es vielversprechend, eine qualitative Forschung durchzuführen, in der Unterrichtseinheiten zu multiperspektivischen Texten, beispielsweise anhand von Fallwickls „Und alle so still“, über einen längeren Zeitraum hinweg begleitet werden. Dabei könnten Lesejournale, Gruppendiskussionen oder Interviews genutzt werden, um zu erfassen, wie sich die Wahrnehmung der literarischen Figuren und gesellschaftlicher Zusammenhänge bei den Schüler*innen wandelt. Ergänzend dazu könnten quantitative Methoden (beispielsweise standardisierte Fragebögen zur Selbstwahrnehmung der Perspektivübernahmefähigkeit) dazu beitragen, Veränderungen im Denken und Fühlen der Lernenden messbar zu machen. Aber auch interdisziplinäre Forschungsansätze bieten sich an, um die Verbindung zwischen Literaturdidaktik, Sozialwissenschaften und Psychologie weiter zu untersuchen. Perspektivübernahme ist nicht nur ein literaturwissenschaftliches Konzept, sondern auch ein zentraler Bestandteil sozialer Kognition. Eine Zusammenarbeit zwischen Literaturdidaktik und der Kognitionspsychologie könnte empirisch klären, ob und unter welchen Prämissen literarisches Lernen tatsächlich langfristige Veränderungen in der Perspektivübernahme und dem Empfinden von Empathie bewirkt. Ein weiteres potentielles Forschungsfeld ergibt sich in der Verknüpfung von Literaturdidaktik und Medienpädagogik. Die fortschreitende Digitalisierung literarischer Rezeption eröffnet neue Möglichkeiten, Perspektivübernahme nicht nur über klassische Textanalyse, sondern auch durch interaktive Medienformate zu fördern. Offen bleibt dabei die Frage, in welchem Maße mediengestützte Perspektivübernahme tatsächlich nachhaltige Reflexionsprozesse anstößt.
Während digitale Formate das Potential haben, den Zugang zu multiperspektivischen Narrativen zu erweitern, gilt es zugleich zu klären, ob sie tatsächlich dieselbe tiefreichende Wirkung entfalten wie klassische literarische Texte. Hier wäre es interessant, vergleichende Studien durchzuführen, die untersuchen, ob Schüler*innen durch digitale Erzählformate ein anderes Verständnis von Perspektiven entwickeln als durch die Lektüre traditioneller Romane. Zusammenfassend zeigt sich, dass die Forschung zur didaktischen Förderung von Perspektivübernahme und Empathiebildung noch einige offene Fragen bereithält. Eine empirische Überprüfung der hier skizzierten Konzepte könnte neue Erkenntnisse über die Wirksamkeit literaturdidaktischer Methoden liefern. Das wäre deshalb entscheidend, weil empirische Untersuchungen in der Literaturdidaktik im Allgemeinen noch immer als Mangelware anzusehen sind.
Die Untersuchung von Perspektivübernahme und Empathiebildung im Literaturunterricht ist nicht nur eine recht junge literaturdidaktische Fragestellung, sondern eine Schlüsselkompetenz für gesellschaftliche Teilhabe - und damit ein Bereich, der auch in zukünftigen Forschungs- und Unterrichtskontexten weitergedacht werden muss.
6. Literaturverzeichnis
Primärliteratur
Fallwickel, M. (2024) Und alle so still. Hamburg: Rowohlt Verlag
Sekundärliteratur
Abrego, V. (2023) 'Intersektionalität und erzählte Welten: Einführung', in: Abrego, V. et al. (Hrsg.) Intersektionalität und erzählte Welten: Literaturwissenschaftliche und literaturdidaktische Perspektiven. Darmstadt: wbg Academia.
Andringa, E. (2000) '„The Dialogic Imagination“. Literarische Komplexität und Lesekompetenz', in: Schütte, H. et al. (Hrsg.) Deutschunterricht zwischen Kompetenzerwerb und Persönlichkeitsbildung. Germanistentag des Fachverbandes Deutsch im Deutschen Germanistenverband e. V. Baltmannsweiler, S. 85-97.
Andringa, E. (1987) 'Warum tut wer was? Entwicklungen in der Wahrnehmung literarischer Figuren', in: Diskussion Deutsch, 18, S. 488-497.
Arendt, H. (1970) Macht und Gewalt. München: Piper.
Armstrong, P.B. (2013) How Literature Plays with the Brain: The Neuroscience of Reading and Art. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Baurmann, J., Kammler, C. und Müller, A. (2022) Handbuch Deutschunterricht: Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens. Hannover: Friedrich Verlag.
Bekes, P. (2022) 'D6 Erzählungen', in: Baurmann, J., Kammler, C. und Müller, A. (Hrsg.) Handbuch Deutschunterricht: Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens. Hannover: Friedrich Verlag.
Bekes, P. (2022) 'D8 Roman', in: Baurmann, J., Kammler, C. und Müller, A. (Hrsg.) Handbuch Deutschunterricht: Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens. Hannover: Friedrich Verlag.
Belgrad, J. (2012) 'Szenisches Spiel', in: Becker-Mrotzek, M. (Hrsg.) Mündliche Kommunikation und Gesprächsdidaktik. 2. Auflage. Baltmannsweiler: SchneiderVerlag Hohengehren GmbH.
Brausmann, K. (2024) 'Narrative patriarchaler Identitätspolitik', in: Zeitschrift für interkulturelle Germanistik, Jg. 15, Bielefeld: transcript.
Browner, C.H. (2016) 'Reproduction: From Rights to Justice?', in: Disch, L. und Hawkesworth, M. (Hrsg.) The Oxford Handbook of Feminist Theory. Oxford: Oxford University Press.
Buhl, H. M. (2014) 'Perspektiven übernehmen. Textverstehen verbessern', in: Pompe, A. (Hrsg.) Literarisches Lernen im Anfangsunterricht: Theoretische Reflexionen, empirische Befunde, unterrichtspraktische Entwürfe. 2. korr. Auflage. Baltmannsweiler: SchneiderVerlag Hohengehren GmbH.
Dannecker, W. und Schindler, K. (2022) Diversitätsorientierte Deutschdidaktik: Theoretischkonzeptionelle Fundierung und Perspektiven für empirisches Arbeiten (Band 4). Bochum.
Dawidowski, C. (2015) Literaturdidaktik Deutsch: Eine Einführung. Paderborn: utb Verlag.
Freudenberg, R. et al. (2024) 'Zum Umgang mit perspektivischer Mehrdeutigkeit. Einblicke in das Forschungsprojekt PAuLi', in: Zeitschrift für Sprachlich Literarisches Lernen und Deutschdidaktik, Bochum.
Gailberger, S. (2014) 'Zur Förderung der Perspektivenübernahme durch Wendebilderbücher: Berichte über ein literarisches Schreibprojekt für dritte und vierte Klassen', in: Kjl & m/Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW.
Forschung, Schule, Bibliothek, 4, München: kopaed Verl.-GmbH, S. 57-71.
Gailberger, S. und Wietzke, F. (2022) 'Kompetenzorientierter Deutschunterricht: Sachverhalte klären - Kompetenzen diagnostizieren - Schülerinnen', in: Gailberger, S. und Wietzke, F. (Hrsg.) Handbuch Kompetenzorientierter Deutschunterricht. 2. Auflage. Weinheim: Beltz Verlag.
Genette, G. (1998) Die Erzählung, 3. Auflage. Stuttgart: utb Verlag.
Hofmann, M. (2023) 'Unzuverlässiges Erzählen als Herausforderung der Literaturdidaktik: Konzeptionelle Überlegungen mit Bezug auf Heinrich von Kleists „Verlobung in St. Domingo“', in: Bernhardt, S. und Henke, I. (Hrsg.) Erzähltheorie(n) und Literaturunterricht: Verhandlungen eines schwierigen Verhältnisses. Berlin: Springer Verlag.
Hurrelmann, B. (2002) 'Leseleistung - Lesekompetenz: Folgerungen aus PISA, mit einem Plädoyer für ein didaktisches Konzept des Lesens als kultureller Praxis', in: Praxis Deutsch, 29, S. 6-18.
Hurrelmann, B. (2003): „Literarische Figuren. Wirklichkeit und Konstruktivität“. In: Praxis Deutsch 177. Hannover: Friedrich Verlag, S. 4-12.
Jakobi, S. (2023) 'Wider die Rezeptionsästhetik? Transmediale und transgenerische Unzuverlässigkeit in den Kinder- und Jugendmedien aus wirkungsästhetischer Perspektive', in: Bernhardt, S. und Henke, I. (Hrsg.) Erzähltheorie(n) und Literaturunterricht: Verhandlungen eines schwierigen Verhältnisses. Berlin: Springer Verlag.
Keen, S. (2007) Empathy and the Novel. Oxford: Oxford University Press.
Kißling, M. & Neumeier, M. (2023): „da war’s dann so für mich klar, dass er auch ein Mädchen ist eigentlich“ - Sprachliche Suchbewegungen im Sprechen über genderorientierte Kinder- und Jugendliteratur, in: J. Grow und A.T. Roth (Hrsg.) Gender in den Fachdidaktiken ästhetischer Fächer. Forschung und Konzepte zu Unterricht und Lehrendenbildung. Leverkusen: Verlag Barbara Budrich.
Kloppert, K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren GmbH.
Leiß, J. (2023) '(Ent)Dramatisierung als Analyse-, Planungs- und Reflexionsinstrument für gendersensiblen Literaturunterricht', in: Grow, J. und Roth, A.T. (Hrsg.) Gender in den Fachdidaktiken ästhetischer Fächer: Forschung und Konzepte zu Unterricht und Lehrendenbildung. Leverkusen: Verlag Barbara Budrich.
Leubner, M. & Saupe, A. (2006): Erzählungen in Literatur und Medien und ihre Didaktik. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren GmbH.
Mohajan, H.K. (2022): Four Waves of Feminism: A Blessing for Global Humanity. Studies in Social Science & Humanities, VOL1, Bangladesch: Paradigm Academic Press.
Neuhaus, Volker (1971): Typen multiperspektivischen Erzählens. Köln: Böhlau Verlag.
Niedersächsisches Kultusministerium, (2017): Kerncurriculum für das Gymnasium - gymnasiale Oberstufe die Gesamtschule - gymnasiale Oberstufe das Berufliche Gymnasium das Abendgymnasium das Kolleg.
Nünning, A. & Nünning, V. (2000): Multiperspektivisches Erzählen. Zur Theorie und Geschichte der Perspektivenstruktur im englischen Roman des 18. bis 20. Jahrhunderts. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier.
Olsen, R. (2011): Das Phänomen Empathie beim Lesen literarischer Texte. Eine didaktisch kompetenzorientierte Annäherung, in: Zeitschrift ästhetische Bildung 3, Nr. 1. Leipzig.
Olsen, R. (2023): Empathie und Ekpathie beim literarischen Lesen und ihre Bedeutung für einen intersektionalitätssensiblen Literaturunterricht, in: Abrego, Verónica, et al. Intersektionalität Und Erzählte Welten: Literaturwissenschaftliche Und
Literaturdidaktische Perspektiven. Darmstadt: wbg Academia.
Podelo, J. (2023): Intersektionale Figurenanalyse. Anknüpfungspunkte und Anregungen für eine intersektional ausgerichtete Figurenanalyse mit Praxisbeispiel, in: Abrego, Verónica, et al. Intersektionalität Und Erzählte Welten: Literaturwissenschaftliche Und Literaturdidaktische Perspektiven. Darmstadt: wbg Academia.
Prieske, L. (2023): Intersektionalität und Perspektivenstruktur: Entwurf eines Modells für die Untersuchung von Intersektionalität in multiperspektivischen Erzähltexten, in: Abrego, Verónica, et al. Intersektionalität Und Erzählte Welten: Literaturwissenschaftliche Und Literaturdidaktische Perspektiven. Darmstadt: wbg Academia.
Rakoczy, H. & Haun, D. (2012): Vor- und nichtsprachliche Kognition. In: W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.): Entwicklungspsychologie. Weinheim und Basel: Beltz Verlag, S. 337-362.
Schaub, C. (2025): Arbeitende Klasse und Diversität. Über persönliche Erzählungen in der Gegenwartsliteratur, in: Zeitschrift für interkulturelle Germanistik, Jg. 15, Bielefeld: transcript.
Schmid, W. (2014): Elemente der Narratologie. Berlin/Boston: De Gruyter.
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. (2014). Bildungsstandards im Fach Deutsch für die Allgemeine Hochschulreife (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.10.2012). Bonn/Berlin.
Seyler, D. (2018): Individuelle Textbegegnung und kooperative Aufgabenbearbeitung. Verstehensprozesse beim Nachvollziehen der Perspektiven literarischer Figuren. Hamburg: J. B. Metzler.
Spinner, K. H. (1980): Entwicklungsspezifische Unterschiede im Textverstehen, in: Identität und Deutschunterricht. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 33-60.
Spinner, K. H. (1986): „Was ist eine Kurzgeschichte?“. In: Praxis Deutsch 75. Hannover: Friedrich Verlag, S. 63-68.
Spinner, K. (1989): Literaturunterricht und moralische Entwicklung, in: Praxis Deutsch 16, Hannover: Friedrich Verlag.
Spinner, K.H. (2001): Produktive Methoden zum Fremdverstehen im Literaturunterricht der Grundschule. In: C. Kammler/P. Büker (Hrsg.): Begegnungsorientierter Umgang mit Kinder- und Jugendliteratur im interkulturellen Deutschunterricht der Grundschule. Bielefeld.
Spinner, K. H. (2006): „Literarisches Lernen“. In: Praxis Deutsch 200. Hannover: Friedrich Verlag, S. 6-16.
Spinner, K. (2016): Empathie beim literarischen Lesen und ihre Bedeutung für einen bildungsorientierten Literaturunterricht, in: Brüggemann, J., Dehrmann, M.-G., Standke, J. (Hrsg.): Literarizität. Herausforderungen für Literaturdidaktik und Literaturwissenschaft. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
Spinner, K.H. (2017) 'Über die Grenzen der Kompetenzorientierung im Literaturunterricht', in: Wrobel, D. et al. (Hrsg.) Gestaltungsraum Deutschunterricht: Literatur - Kultur - Sprache. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
Standke, J. & Spinner, K.H. (2016): Erzählende Kinder- und Jugendliteratur im Deutschunterricht: Textvorschläge - Didaktik - Methodik. Paderborn: utb Verlag.
Stark, T. (2012): „Zum Perspektivenverstehen beim Verstehen literarischer Texte: Ausgewählte Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung“. In: Irene P. & Wieser, D. (Hrsg.): Fachliches Wissen und literarisches Verstehen. Studien zu einer brisanten Relation. Frankfurt a.M.: Peter Lang Verlag, S. 153-169.
Stark, T. (2019): „Verstehenshinderliche Prozesse beim Zusammenwirken von Weltwissen, normativen Wertungen und Textverstehen“. In: Didaktik Deutsch 47. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren GmbH, S. 65-85.
Steins, G. (2006): Perspektivenübernahme oder: wer ist die andere Person? In: H.-W. Bierhoff & D. Frey (Hg.): Handbuch der Sozialpsychologie und Kommunikationspsychologie. Göttingen: Hogrefe Verlag.
Surkamp, C. (2003): Die Perspektivenstruktur narrativer Texte. Zu ihrer Theorie und Geschichte in englischen Romanen zwischen Viktorianismus und Moderne. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier
Volkmer, M. und Werner, K. (2020) Die Corona-Gesellschaft: Analysen zur Lage und Perspektiven für die Zukunft. Bielefeld: transcript Verlag.
von Brand, T. (2022) 'A6 Szenisches Spiele, Interaktionsspiel, Rollenspiel, Planspiel', in: Baurmann, J., Kammler, C. und Müller, A. (Hrsg.) Handbuch Deutschunterricht: Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens. Hannover: Friedrich Verlag.
7. Anhang
1. Skizze einer Verlaufsplanung für eine Unterrichtseinheit zum Thema Perspektivübemahme und Empathiebildung mit Mareike Fallwickls „Und alle so still“
Zielgruppe: Sekundarstufe II (Gymnasium/Gesamtschule)
Dauer: 7-8 Doppelstunden (je nach Schwerpunktsetzung)
Didaktischer Fokus: Förderung von Perspektivübemahme, Analyse multiperspektivischen Erzählens, Reflexion gesellschaftlicher Rollenbilder
Ziele:
- Die Schülerinnen setzen sich mit multiperspektivischem Erzählen auseinander.
- Die Schülerinnen reflektieren gesellschaftliche Machtverhältnisse und Identitätskonstruktionen.
- Die Schülerinnen üben Perspektivübemahme durch literarische Analyse und kreative Aufgaben.
Kompetenzen (angelehnt an die Bildungsstandards für die SEK II):
- Literarische Texte analysieren und interpretieren
- Multiperspektivität in Erzähltexten erkennen und deuten
- Eigene Leseerfahrungen reflektieren und argumentativ vertreten
Kreatives und analytisches Schreiben zur Perspektivübemahme nutzen
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 Im Verlauf dieser Arbeit wird mit * gegendert. Das Sternchen symbolisiert einen Freiraum für die Entfaltung von Geschlechteridentitäten jenseits eines binären Mann-Frau-Geschlechtermodells. Damit werden neben Frauen und Männern auch diejenigen sprachlich abgebildet, die sich nicht im binären Geschlechtermodell wiederfinden können oder wollen. Bei der Auswahl der Gender-Methode wurde die Leitlinie Sprache & Diversität der TU Braunschweig (2021) zu Rate gezogen.
2 Vgl. Spinner, K.H. (2006): S.10
3 Vgl. Schaub, C. (2025): S. 38
4 Vgl. Spinner, K. (1989): Literaturunterricht und moralische Entwicklung, in: Praxis Deutsch 16, S. 13-19, hier: S. 16f.
5 Vgl. Spinner, K. (1989): Literaturunterricht und moralische Entwicklung, in: Praxis Deutsch 16, S. 13-19, hier: S. 16f.
6 Vgl. Dawidowski, C. (2015) Literaturdidaktik Deutsch: Eine Einführung, S. 123f.
7 Vgl. Spinner, K. H. (2006): Literarisches Lernen. In: Praxis Deutsch 200. S. 6-16, hier: S. 9
8 Vgl. Nünning, A. & Nünning, V. (2000): Multiperspektivisches Erzählen. Zur Theorie und Geschichte der Perspektivenstruktur im englischen Roman des 18. bis 20. Jahrhunderts, S. 7.
9 Vgl. Ebd., S. 10.
10 Vgl. Nünning, A. & Nünning, V. (2000): Multiperspektivisches Erzählen. Zur Theorie und Geschichte der Perspektivenstruktur im englischen Roman des 18. bis 20. Jahrhunderts, S. 3.
11 Prieske, L. (2023): Intersektionalität und Perspektivenstruktur: Entwurf eines Modells für die Untersuchung von Intersektionalität in multiperspektivischen Erzähltexten, in: Abrego, Verónica, et al. Intersektionalität Und Erzählte Welten: Literaturwissenschaftliche Und Literaturdidaktische Perspektiven, S. 91f.
12 Seyler, D. (2018): Individuelle Textbegegnung und kooperative Aufgabenbearbeitung. Verstehensprozesse beim Nachvollziehen der Perspektiven literarischer Figuren, S. 20.
13 Vgl. Ebd., S. 20.
14 Vgl. Spinner, K. H. (1980): Entwicklungsspezifische Unterschiede im Textverstehen, in: Identität und Deutschunterricht, S. 33-60, hier: S. 43.
15 Vgl. Spinner, K. H. (2006): „Literarisches Lernen“. In: Praxis Deutsch 200. S. 6-16, hier: S. 9.
16 Vgl. Kloppert, K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 9.
17 Hurrelmann, B. (2002): Leseleistung - Lesekompetenz. Folgerungen aus PISA, mit einem Plädoyer für ein didaktisches Konzept des Lesens als kultureller Praxis, in: Praxis Deutsch 29, S. 6-18, hier: 16.
18 Ebd., S. 16.
19 Vgl. Andringa, E. (2000): „The Dialogic Imagination“. Literarische Komplexität und Lesekompetenz“. In: Schütte, H. et.al (Hrsg.): Deutschunterricht zwischen Kompetenzerwerb und Persönlichkeitsbildung. Germanistentag des Fachverbandes Deutsch im Deutschen Germanistenverband e. V., S. 85-97.
20 Vgl. Stark, T. (2012): „Zum Perspektivenverstehen beim Verstehen literarischer Texte: Ausgewählte Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung“. In: Irene P. & Wieser, D. (Hrsg.): Fachliches Wissen und literarisches Verstehen. Studien zu einer brisanten Relation, S. 153-169, hier: S. 160 und Stark, T. (2019): „Verstehenshinderliche Prozesse beim Zusammenwirken von Weltwissen, normativen Wertungen und Textverstehen“. In: Didaktik Deutsch 47. S. 65-85, hier: S. 78f.
21 Buhl, H. M. (2014): „Perspektiven übernehmen. Textverstehen verbessern“. In: Anja Pompe (Hrsg.): Literarisches Lernen im Anfangsunterricht. Theoretische Reflexionen. Empirische Befunde. Unterrichtspraktische Entwürfe. 2. korr. Aufl., S. 122-135, hier: S. 130.
22 Vgl. Ebd., S. 123.
23 Vgl. Kloppert K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 92f.
24 Vgl. Gailberger, S. (2014): „Zur Förderung der Perspektivenübernahme durch Wendebilderbücher. Berichte über ein literarisches Schreibprojekt für dritte und vierte Klassen“. In: JuLit 4. S. 57-71.
25 Vgl. Kloppert K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 92f.
26 Vgl. Spinner, K. H. (2006): „Literarisches Lernen“. In: Praxis Deutsch 200. S. 6-16, hier: S. 9
27 Keen, S. (2007): Empathy and the Novel, S. 5.
28 Vgl. Armstrong, P B. (2013): How Literature Plays with the Brain. The Neuroscience of Reading and Art, S. 146f.
29 Vgl. Olsen, R. (2011): Das Phänomen Empathie beim Lesen literarischer Texte. Eine didaktisch-kompetenzorientierte Annäherung, in: Zeitschrift ästhetische Bildung 3, Nr. 1, S. 188f.
30 Vgl. Kloppert, K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 56f.
31 Vgl. Kloppert, K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 21.
32 Vgl. Steins, G. (2006): Perspektivenübernahme oder: wer ist die andere Person? In: H.-W. Bierhoff & D. Frey, (Hrsg.). Handbuch der Sozialpsychologie und Kommunikationspsychologie, S. 471-478, hier: 471ff.
33 Vgl. Ebd., 471.
34 Vgl. Rakoczy, H. & Haun, D. (2012): Vor- und nichtsprachliche Kognition. In W. Schneider & U. Lindenberger, (Hrsg.) Entwicklungspsychologie, S. 337-362, hier: 349f.
35 Vgl. Spinner, K. H. (2017): „Über die Grenzen der Kompetenzorientierung im Literaturunterricht“. In: Dieter Wrobel u.a. (Hrsg.): Gestaltungsraum Deutschunterricht. Literatur - Kultur - Sprache, S. 17-22. Und Olsen, Ralph (2011): „Das Phänomen Empathie beim Lesen literarischer Texte. Eine didaktisch-kompetenzorientierte Annäherung“. In: Zeitschrift ästhetisches Bildung 1, S. 1-16.
36 Vgl. Andringa, E. (1987): „Warum tut wer was? Entwicklungen in der Wahrnehmung literarischer Figuren“. In: Diskussion Deutsch 18. S. 488-497.
37 Vgl. Kloppert, K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 106.
38 Vgl. Freudenberg, R. et al. (2024): Zum Umgang mit perspektivischer Mehrdeutigkeit. Einblicke in das Forschungsprojekt PAuLi. Dealing with Perspective Ambiguity. Insights into the Design-Based Research Project PAuLi, in: Zeitschrift für Sprachlich Literarisches Lernen und Deutschdidaktik 4, S. 2.
39 Vgl. Ebd., S. 5.
40 Vgl. Ebd., S. 8.
41 Vgl. Kloppert, K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 92ff.
42 Vgl. Olsen, R. (2011): Das Phänomen Empathie beim Lesen literarischer Texte. Eine didaktisch kompetenzorientierte Annäherung, in: Zeitschrift ästhetische Bildung 3, Nr. 1, S. 25-34.
43 Vgl. Kloppert, K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 23.
44 Vgl. Schmid, W. (2014) Elemente der Narratologie, S. 121f.
45 Vgl. Ebd.
46 Vgl. Genette, G. (1998). Die Erzählung, zitiert nach Stark (2012), S. 159.
47 Vgl. Stanzel F. (1955). Die typischen Erzählsituationen im Roman, zitiert nach Schmid (2014), S. 108
48 Vgl. Ebd., S. 108
49 Vgl. Schmid, W. (2014) Elemente der Narratologie, S. 88.
50 Vgl. Genette, G. (1998). Die Erzählung, zitiert nach Schmid (2014), S. 110.
51 Vgl. Ebd.
52 Vgl. Ebd.
53 Vgl. Leubner, M. und Saupe, A. (2006) Erzählungen in Literatur und Medien und ihre Didaktik, S. 134.
54 Vgl. Nünning, V. & Nünning, A. (2000). Multiperspektivisches Erzählen: Zur Einführung. In: V. Nünning & A. Nünning (Hrsg.), Multiperspektivisches Erzählen: Zur Theorie und Geschichte der Perspektivenstruktur im englischen Roman des 18. bis 20. Jahrhunderts, S. 7-66.
55 Vgl. Spinner, K.H.(1989): Literaturunterricht und moralische Entwicklung, in: Praxis Deutsch 16, S. 13-19, hier: S. 18.
56 Vgl. Spinner, K. H. (1986): „Was ist eine Kurzgeschichte?“. In: Praxis Deutsch 75. S. 63-68.
57 Vgl. Spinner, K, H. (2006): „Literarisches Lernen“. In: Praxis Deutsch 200. S. 6-16, hier: S. 10.
58 Vgl. Kloppert, K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 96f.
59 Vgl. Spinner, K.H.(1989): Literaturunterricht und moralische Entwicklung, in: Praxis Deutsch 16, S. 13-19, hier: S. 14.
60 Vgl. Kloppert, K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 103f.
61 Vgl. Spinner, K.H. (2006): „Literarisches Lernen“. In: Praxis Deutsch 200. S. 6-16, hier: S. 9
62 Vgl. Spinner, K.H. (2016): Empathie beim literarischen Lesen und ihre Bedeutung für einen bildungsorientierten Literaturunterricht, in: Brüggemann, J., Dehrmann, M.-G., Standke, J. (Hrsg.): Literarizität. Herausforderungen für Literaturdidaktik und Literaturwissenschaft, S. 187ff.
63 Vgl. Olsen, R. (2011): Das Phänomen Empathie beim Lesen literarischer Texte. Eine didaktisch kompetenzorientierte Annäherung, in: Zeitschrift ästhetische Bildung 3, Nr. 1, S. 4f.
64 Vgl. Spinner, K. (2016): Empathie beim literarischen Lesen und ihre Bedeutung für einen bildungsorientierten Literaturunterricht, in: Brüggemann, J., Dehrmann, M.-G., Standke, J. (Hrsg.): Literarizität. Herausforderungen für Literaturdidaktik und Literaturwissenschaft, S. 188f.
65 Vgl. Seyler, D. (2018): Individuelle Textbegegnung und kooperative Aufgabenbearbeitung. Verstehensprozesse beim Nachvollziehen der Perspektiven literarischer Figuren, S. 1.
66 Vgl. Spinner, K.H. (2006): „Literarisches Lernen“. In: Praxis Deutsch 200. S. 6-16, hier: S. 9
67 Vgl. Seyler, D. (2018): Individuelle Textbegegnung und kooperative Aufgabenbearbeitung. Verstehensprozesse beim Nachvollziehen der Perspektiven literarischer Figuren, Hamburg, S. 134.
68 Vgl. Hurrelmann, B. (2003): Literarische Figuren. Wirklichkeit und Konstruktivität. In: Praxis Deutsch 177, S. 1-2, hier: S. 8
69 Gailberger, S. (2014): 'Zur Förderung der Perspektivenübernahme durch Wendebilderbücher: Berichte über ein literarisches Schreibprojekt für dritte und vierte Klassen', in: Kjl & m / Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW. Forschung, Schule, Bibliothek, 4, S. 57-71, hier: S. 61f.
70 Vgl. Kloppert, K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 4.
71 Vgl. Ebd., S. 90f.
72 Vgl. Ebd., S. 96f.
73 Vgl. Spinner, K.H. (2006): Literarisches Lernen. In: Praxis Deutsch. H. 200. S. 6-16.
74 Vgl. Spinner, K.H. (2001): Produktive Methoden zum Fremdverstehen im Literaturunterricht der Grundschule. In: Kammler, C. & Büker, P. (Hrsg.): Begegnungsorientierter Umgang mit Kinder- und Jugendliteratur im interkulturellen Deutschunterricht der Grundschule, S. 171
75 Vgl. Spinner, K.H. (2006): Literarisches Lernen. In: Praxis Deutsch. H. 200. S. 6-16, hier: S. 10
76 Vgl. Spinner, K.H. (1989): Literaturunterricht und moralische Entwicklung, in: Praxis Deutsch16, S. 12-19, hier: S. 16.
77 Vgl. Spinner, K. (2006): Literarisches Lernen. In: Praxis Deutsch. H. 200. S. 6-16, hier: S. 10
78 Vgl. Seyler, D. (2018): Individuelle Textbegegnung und kooperative Aufgabenbearbeitung. Verstehensprozesse beim Nachvollziehen der Perspektiven literarischer Figuren, S. 42.
79 Vgl. Spinner, K.H. (2006): Literarisches Lernen. In: Praxis Deutsch. H. 200. S. 6-16, hier: S. 9.
80 Vgl. Spinner, K.H. (2016): Empathie beim literarischen Lesen und ihre Bedeutung für einen bildungsorientierten Literaturunterricht, in: Brüggemann, J., Dehrmann, M.-G., Standke, J. (Hrsg.): Literarizität. Herausforderungen für Literaturdidaktik und Literaturwissenschaft, S. 187.
81 Vgl. Niedersächsisches Kultusministerium (2017): Kerncurriculum für das Gymnasium - gymnasiale Oberstufe die Gesamtschule - gymnasiale Oberstufe das Berufliche Gymnasium das Abendgymnasium das Kolleg, S. 10
82 Vgl. Gailberger, S. & Wietzke, F. (2022): Kompetenzorientierter Deutschunterricht. Sachverhalte klären - Kompetenzen diagnostizieren - Schüler*innen, in: Gailberger, Steffen & Wietzke, Frauke (HG.): Handbuch Kompetenzorientierter Deutschunterricht, 2. Aufl., S. 9f.
83 Vgl. Spinner, K.H. (2006): Literarisches Lernen. In: Praxis Deutsch. H. 200. S. 6-16, hier: S. 10.
84 Vgl. Spinner, K.H. (1989): Literaturunterricht und moralische Entwicklung, in: Praxis Deutsch 16, S. 13-19, hier: S. 16f.
85 Vgl. Dannecker, W. und Schindler, K. (2022) Diversitätsorientierte Deutschdidaktik: Theoretisch-konzeptionelle Fundierung und Perspektiven für empirisches Arbeiten (Band 4), S. 72.
86 Vgl. Kloppert, K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 17.
87 Niedersächsisches Kultusministerium (2017): Kerncurriculum für das Gymnasium - gymnasiale Oberstufe die Gesamtschule - gymnasiale Oberstufe das Berufliche Gymnasium das Abendgymnasium das Kolleg, S. 5.
88 Vgl. Päfflin (2010), zitiert nach: Kloppert, K. (2021), S. 139f.
89 Vgl. Kloppert K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 111f.
90 Vgl. Ebd., S. 17.
91 Vgl. Kloppert K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 96f.
92 Vgl. Ebd., S. 17f.
93 Vgl. Ebd., S. 17.
94 Vgl. Niedersächsisches Kultusministerium (2017): Kerncurriculum für das Gymnasium - gymnasiale Oberstufe die Gesamtschule - gymnasiale Oberstufe das Berufliche Gymnasium das Abendgymnasium das Kolleg, S. 5.
95 Vgl. Kloppert K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 224.
96 Spinner, K. (2016): Empathie beim literarischen Lesen und ihre Bedeutung für einen bildungsorientierten Literaturunterricht, in: Brüggemann, J., Dehrmann, M.-G., Standke, J. (Hrsg.): Literarizität. Herausforderungen für Literaturdidaktik und Literaturwissenschaft, S. 190-198.
97 Vgl. Spinner, K.H. (1989): Literaturunterricht und moralische Entwicklung, in: Praxis Deutsch 16, S. 13-19, hier: S. 18f.
98 Vgl. Kloppert K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 114.
99 Vgl. Ebd., S. 224.
100 Vgl. Prieske, L. (2023): Intersektionalität und Perspektivenstruktur: Entwurf eines Modells für die Untersuchung von Intersektionalität in multiperspektivischen Erzähltexten, in: Abrego, Verónica, et al. Intersektionalität Und Erzählte Welten: Literaturwissenschaftliche Und Literaturdidaktische Perspektiven, S. 95ff.
101 Vgl. Kloppert K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 111f.
102 Vgl. Ebd., S. 80.
103 Vgl. Spinner, K.H. (1989): Literaturunterricht und moralische Entwicklung, in: Praxis Deutsch 16, S. 13-19, hier: S. 18f.
104 Podelo, J. (2023): Intersektionale Figurenanalyse. Anknüpfungspunkte und Anregungen für eine intersektional ausgerichtete Figurenanalyse mit Praxisbeispiel, in: Abrego, Verónica, et al. Intersektionalität Und Erzählte Welten: Literaturwissenschaftliche Und Literaturdidaktische Perspektiven, S. 327ff.
105 Kloppert K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 224.
106 Vgl. Ebd., S. 119.
107 Vgl. Kloppert K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 111f.
108 Vgl. Ebd., S. 111f.
109 Vgl. Podelo, J. (2023): Intersektionale Figurenanalyse. Anknüpfungspunkte und Anregungen für eine intersektional ausgerichtete Figurenanalyse mit Praxisbeispiel, in: Abrego, Verónica, et al. Intersektionalität Und Erzählte Welten: Literaturwissenschaftliche Und Literaturdidaktische Perspektiven, S. 327ff.
110 Vgl. Kloppert K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 17.
111 Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. (2014). Bildungsstandards im Fach Deutsch für die Allgemeine Hochschulreife (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.10.2012), S. 14.
112 Vgl. Ebd., S. 18f.
113 Vgl. Ebd., S. 55.
114 Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. (2014). Bildungsstandards im Fach Deutsch für die Allgemeine Hochschulreife (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.10.2012), S. 20f.
115 Vgl. Seyler, D. (2018): Individuelle Textbegegnung und kooperative Aufgabenbearbeitung. Verstehensprozesse beim Nachvollziehen der Perspektiven literarischer Figuren, S. 56f.
116 Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. (2014). Bildungsstandards im Fach Deutsch für die Allgemeine Hochschulreife (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.10.2012), S. 15.
117 Vgl. Kloppert K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 89.
118 Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. (2014). Bildungsstandards im Fach Deutsch für die Allgemeine Hochschulreife (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.10.2012), S. 7.
119 Vgl. Olsen, R. (2023): Empathie und Ekpathie beim literarischen Lesen und ihre Bedeutung für einen intersektionalitätssensiblen Literaturunterricht, in: Abrego, Verónica, et al. Intersektionalität Und Erzählte Welten: Literaturwissenschaftliche Und Literaturdidaktische Perspektiven, S. 445ff.
120 Vgl. Seyler, D. (2018): Individuelle Textbegegnung und kooperative Aufgabenbearbeitung. Verstehensprozesse beim Nachvollziehen der Perspektiven literarischer Figuren, S. 13ff.
121 Vgl. Podelo, J.(2023): Intersektionale Figurenanalyse. Anknüpfungspunkte und Anregungen für eine intersektional ausgerichtete Figurenanalyse mit Praxisbeispiel, in: Abrego, Verónica, et al. Intersektionalität Und Erzählte Welten: Literaturwissenschaftliche Und Literaturdidaktische Perspektiven, S. 325f.
122 Vgl. Kloppert K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 102f.
123 Vgl. Olsen, R. (2023): Empathie und Ekpathie beim literarischen Lesen und ihre Bedeutung für einen intersektionalitätssensiblen Literaturunterricht, in: Abrego, Verónica, et al. Intersektionalität Und Erzählte Welten: Literaturwissenschaftliche Und Literaturdidaktische Perspektiven, S. 445ff.
124 Vgl. Kloppert K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 131f.
125 Vgl. Ebd., S. 133.
126 Vgl. Seyler, D. (2018): Individuelle Textbegegnung und kooperative Aufgabenbearbeitung. Verstehensprozesse beim Nachvollziehen der Perspektiven literarischer Figuren, S. 419.
127 Vgl. Kloppert K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 107f.
128 Dannecker, W. & Schindler, K. (2022) Diversitätsorientierte Deutschdidaktik: Theoretisch-konzeptionelle Fundierung und Perspektiven für empirisches Arbeiten (Band 4), S. 9f.
129 An dieser Stelle wird der englische Begriff „Race“ anstelle der deutschen Übersetzung bewusst genutzt, um etwaige Verbindungen mit den Rassekonzepten der Nationalsozialisten zu vermeiden.
130 Vgl. Dannecker, W. & Schindler, K. (2022) Diversitätsorientierte Deutschdidaktik: Theoretisch-konzeptionelle Fundierung und Perspektiven für empirisches Arbeiten (Band 4), S. 69.
131 Vgl. Kloppert K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 118.
132 Vgl. Seyler, D. (2018): Individuelle Textbegegnung und kooperative Aufgabenbearbeitung. Verstehensprozesse beim Nachvollziehen der Perspektiven literarischer Figuren, S. 434f.
133 Vgl. Ebd., S. 427.
134 Vgl. Kloppert K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 159.
135 Vgl. Seyler, D. (2018): Individuelle Textbegegnung und kooperative Aufgabenbearbeitung. Verstehensprozesse beim Nachvollziehen der Perspektiven literarischer Figuren, S. 49.
136 Vgl. Ebd., S. 47f.
137 Vgl. Ebd., S. 423.
138 Vgl. Spinner, K.H. (1989): Literaturunterricht und moralische Entwicklung, in: Praxis Deutsch 16, S. 13-19, hier: S. 18f.
139 Vgl. Dannecker, W. und Schindler, K. (2022) Diversitätsorientierte Deutschdidaktik: Theoretisch-konzeptionelle Fundierung und Perspektiven für empirisches Arbeiten (Band 4), S. 69.
140 Vgl. Nünning, A. & Nünning, V. (2000): Multiperspektivisches Erzählen. Zur Theorie und Geschichte der Perspektivenstruktur im englischen Roman des 18. bis 20. Jahrhunderts, S. 7.
141 Neuhaus, V (1971): Typen multiperspektivischen Erzählens, S. 1.
142 Vgl. Surkamp, C. (2003): Die Perspektivenstruktur narrativer Texte. Zu ihrer Theorie und Geschichte in englischen Romanen zwischen Viktorianismus und Moderne, S. 39.
143 Fallwickel, M. (2024): Und alle so still, S. 139.
144 Ebd., S. 22.
145 Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 36.
146 Ebd., S. 51.
147 Vgl. Mohajan, H.K. (2022) 'Four Waves of Feminism: A Blessing for Global Humanity', Studies in Social Science & Humanities, VOL 1.
148 Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, 80.
149 Ebd. S. 156.
150 Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 34.
151 Ebd. S. 59.
152 Vgl. Nünning, A. & Nünning, V. (2000): Multiperspektivisches Erzählen. Zur Theorie und Geschichte der Perspektivenstruktur im englischen Roman des 18. bis 20. Jahrhunderts, S. 18.
153 Vgl. Ebd.
154 Vgl. Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 43.
155 Vgl. Ebd., S. 141.
156 Vgl. Kloppert K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 9.
157 Hurrelmann, B. (2002): Leseleistung - Lesekompetenz. Folgerungen aus PISA, mit einem Plädoyer für ein didaktisches Konzept des Lesens als kultureller Praxis, in: Praxis Deutsch 29, S. 6-18, hier: S. 16.
158 Vgl. Kloppert K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 131.
159 Vgl. Ebd. S. 102f.
160 Vgl. Nünning, A. & Nünning, V. (2000): Multiperspektivisches Erzählen. Zur Theorie und Geschichte der Perspektivenstruktur im englischen Roman des 18. bis 20. Jahrhunderts, S. 18.
161 Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 99.
162 Vgl. Fallwickl, M.: Und alle so still, S. 97.
163 Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 95.
164 Ebd., S. 325.
165 Ebd., S. 52f.
166 Ebd., S. 161.
167 Vgl. Kloppert K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 9.
168 Vgl. Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 200.
169 Vgl. Ebd., S. 155.
170 Vgl. Kloppert K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 122f.
171 Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 337.
172 Ebd. S. 51.
173 Fallwickl, M. (2024): Und alle still, S. 313.
174 Ebd. S. 32.
175 Vgl. Ebd., S. 104.
176 Vgl. Podelo, J. (2023): Intersektionale Figurenanalyse. Anknüpfungspunkte und Anregungen für eine intersektional ausgerichtete Figurenanalyse mit Praxisbeispiel, in: Abrego, Verónica, et al. Intersektionalität Und Erzählte Welten: Literaturwissenschaftliche Und Literaturdidaktische Perspektiven. S. 327ff.
177 Vgl. Kloppert, K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 22.
178 Vgl. Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 32ff.
179 Vgl. Kloppert, K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 23.
180 Vgl. Fallwickl, M.: Und alle so still, S. 34.
181 Vgl. Jakobi, S. (2023): Wider die Rezeptionsästhetik? Transmediale und transgenerische Unzuverlässigkeit in den Kinder- und Jugendmedien aus wirkungsästhetischer Perspektive, in: Bernhardt, S. & Henke, I. (Hrsg.) Erzähltheorie(n) und Literaturunterricht Verhandlungen eines schwierigen Verhältnisses, S. 107.
182 Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 95.
183 Ebd., S. 32.
184 Vgl. Prieske, L. (2023): Intersektionalität und Perspektivenstruktur: Entwurf eines Modells für die Untersuchung von Intersektionalität in multiperspektivischen Erzähltexten, in: in: Abrego, Verónica, et al. Intersektionalität Und Erzählte Welten: Literaturwissenschaftliche Und Literaturdidaktische Perspektiven. S. 91f.
185 Vgl. Olsen, R. (2011): Das Phänomen Empathie beim Lesen literarischer Texte. Eine didaktisch-kompetenzorientierte Annäherung, in: Zeitschrift ästhetische Bildung 3, Nr. 1. S. 25-34.
186 Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 34.
187 Ebd., S. 230.
188 Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 80.
189 Ebd., S. 51.
190 Ebd., S. 34.
191 Brausmann, K. (2024). Narrative patriarchaler Identitätspolitik. Zeitschrift für interkulturelle Germanistik 15, S. 106.
192 Vgl. Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 32.
193 Vgl. Ebd., S. 102f.
194 Ebd., S. 32.
195 Vgl. Ebd.
196 Vgl. Hofmann, M. (2023): Unzuverlässiges Erzählen als Herausforderung der Literaturdidaktik Konzeptionelle Überlegungen mit Bezug auf Heinrich von Kleists Verlobung in St. Doming, in: Bernhardt, S. & Henke, I. (Hrsg.) Erzähltheorie(n) und Literaturunterricht Verhandlungen eines schwierigen Verhältnisses, S. 97f.
197 Vgl. Leiß, J. (2023) '(Ent)Dramatisierung als Analyse-, Planungs- und Reflexionsinstrument für gendersensiblen Literaturunterricht', in J. Grow und A.T. Roth (Hrsg.) Gender in den Fachdidaktiken ästhetischer Fächer. Forschung und Konzepte zu Unterricht und Lehrendenbildung, S. 178f.
198 Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 337.
199 Ebd. S. 51.
200 Fallwickl, M. (2024): Und alle still, S. 313.
201 Ebd. S. 32.
202 Vgl. Ebd., S. 104.
203 Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 231f.
204 Vgl. Mohajan, H.K. (2022) 'Four Waves of Feminism: A Blessing for Global Humanity', Studies in Social Science & Humanities, VOL 1.
205 Vgl. Abrego, V., et.al. (2023): Intersektionalität und erzählte Welten – Einführung, in: Abrego, Verónica, et al. Intersektionalität Und Erzählte Welten: Literaturwissenschaftliche Und Literaturdidaktische Perspektiven, S. 24.
206 Vgl. Podelo, J. (2023): Intersektionale Figurenanalyse. Anknüpfungspunkte und Anregungen für eine intersektional ausgerichtete Figurenanalyse mit Praxisbeispiel, in: Abrego, Verónica, et al. Intersektionalität Und Erzählte Welten: Literaturwissenschaftliche Und Literaturdidaktische Perspektiven. S. 327ff.
207 Vgl. Kloppert, K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 22.
208 Vgl. Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 32ff.
209 Vgl. Kloppert, K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 23.
210 Vgl. Fallwickl, M.: Und alle so still, S. 34.
211 Vgl. Hofmann, M. (2023): Unzuverlässiges Erzählen als Herausforderung der Literaturdidaktik Konzeptionelle Überlegungen mit Bezug auf Heinrich von Kleists Verlobung in St. Doming, in: Bernhardt S. & Henke, I. (Hrsg.) Erzähltheorie(n) und Literaturunterricht Verhandlungen eines schwierigen Verhältnisses, S. 89.
212 Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 32.
213 Vgl. Jakobi, S. (2023): Wider die Rezeptionsästhetik? Transmediale und transgenerische Unzuverlässigkeit in den Kinder- und Jugendmedien aus wirkungsästhetischer Perspektive, in: Bernhardt, S. & Henke, I. (Hrsg.) Erzähltheorie(n) und Literaturunterricht Verhandlungen eines schwierigen Verhältnisses, S. 107.
214 Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 95.
215 Ebd., S. 32.
216 Vgl. Prieske, L. (2023): Intersektionalität und Perspektivenstruktur: Entwurf eines Modells für die Untersuchung von Intersektionalität in multiperspektivischen Erzähltexten, in: in: Abrego, Verónica, et al. Intersektionalität Und Erzählte Welten: Literaturwissenschaftliche Und Literaturdidaktische Perspektiven. S. 91f.
217 Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 95.
218 Ebd. S. 59.
219 Vgl. Olsen, R. (2011): Das Phänomen Empathie beim Lesen literarischer Texte. Eine didaktisch-kompetenzorientierte Annäherung, in: Zeitschrift ästhetische Bildung 3, Nr. 1. S. 25-34.
220 Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 34.
221 Ebd., S. 230.
222 Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 80.
223 Ebd., S. 51.
224 Ebd., S. 34.
225 Vgl. Browner, C.H. (2016) 'Reproduction: from rights to justice?'. In: Disch, L. & Hawkesworth, M. (Hrsg.) The Oxford Handbook of Feminist Theory.
226 Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 96.
227 Vgl. Arendt, H. (1970): Macht & Gewalt, S. 45.
228 Vgl. Volkmer, M. & Werner, K. (2020): Die Corona-Gesellschaft. Analysen zur Lage und Perspektiven für die Zukunft.
229 Vgl. Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 14f.
230 Vgl. Podelo, J. (2023): Intersektionale Figurenanalyse. Anknüpfungspunkte und Anregungen für eine intersektional ausgerichtete Figurenanalyse mit Praxisbeispiel, in: Abrego, Verónica, et al. Intersektionalität Und Erzählte Welten: Literaturwissenschaftliche Und Literaturdidaktische Perspektiven, S. 321
231 Brausmann, K. (2024). Narrative patriarchaler Identitätspolitik. Zeitschrift für interkulturelle Germanistik 15, S. 106.
232 Vgl. Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 32.
233 Vgl. Ebd., S. 102f.
234 Ebd., S. 32.
235 Kißling, M. & Neumeier, M. (2023): „da war’s dann so für mich klar, dass er auch ein Mädchen ist eigentlich“ - Sprachliche Suchbewegungen im Sprechen über genderorientierte Kinder- und Jugendliteratur, in: J. Grow und A.T. Roth (Hrsg.) Gender in den Fachdidaktiken ästhetischer Fächer. Forschung und Konzepte zu Unterricht und Lehrendenbildung, S. 35f.
236 Spinner, K.H. (2001): Produktive Methoden zum Fremdverstehen im Literaturunterricht der Grundschule. In: Kammler, C. & Büker, P. (Hrsg.): Begegnungsorientierter Umgang mit Kinder- und Jugendliteratur im interkulturellen Deutschunterricht der Grundschule, S. 138.
237 Vgl. Spinner, K.H. (1989): Literaturunterricht und moralische Entwicklung in: Praxis Deutsch 16, S. 13-19, hier: S. 16ff.
238 Vgl. Spinner, K. H. (2006): „Literarisches Lernen“. In: Praxis Deutsch 200. S. 6-16, hier: S. 9
239 Vgl. hierzu: Kapitel 2.4
240 Vgl. Kloppert, K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 19.
241 Vgl. Spinner, K. H. (2006): „Literarisches Lernen“. In: Praxis Deutsch 200. S. 6-16, hier: S. 10.
242 Vgl. Olsen, R. (2023): Empathie und Ekpathie beim literarischen Lesen und ihre Bedeutung für einen intersektionalitätssensiblen Literaturunterricht, in: Abrego, Verónica, et al. Intersektionalität Und Erzählte Welten: Literaturwissenschaftliche Und Literaturdidaktische Perspektiven, S. 445ff.
243 Vgl. Hofmann, M. (2023): Unzuverlässiges Erzählen als Herausforderung der Literaturdidaktik Konzeptionelle Überlegungen mit Bezug auf Heinrich von Kleists Verlobung in St. Doming, in: Bernhardt, S. & Henke, I. (Hrsg.) Erzähltheorie(n) und Literaturunterricht Verhandlungen eines schwierigen Verhältnisses, S. 94.
244 Vgl. Ebd., S. 97.
245 Vgl. Spinner, K.H. (1989): Literaturunterricht und moralische Entwicklung, in: Praxis Deutsch 16, S. 13-19, hier: S. 16ff.
246 Vgl. Dannecker, W. und Schindler, K. (2022) Diversitätsorientierte Deutschdidaktik: Theoretisch-konzeptionelle Fundierung und Perspektiven für empirisches Arbeiten (Band 4), S. 9.
247 Vgl. Spinner, K.H. (1989): Literaturunterricht und moralische Entwicklung, in: Praxis Deutsch 16, S. 13-19, hier: S. 16ff
248 Vgl. Seyler, D. (2018): Individuelle Textbegegnung und kooperative Aufgabenbearbeitung. Verstehensprozesse beim Nachvollziehen der Perspektiven literarischer Figuren, S. 59ff.
249 Vgl. Kloppert, K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 120f.
250 Vgl. Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 32.
251 Vgl. Dannecker, W. und Schindler, K. (2022) Diversitätsorientierte Deutschdidaktik: Theoretisch-konzeptionelle Fundierung und Perspektiven für empirisches Arbeiten (Band 4), S. 9f.
252 Vgl. Spinner, K.H. (1989): Literaturunterricht und moralische Entwicklung, in: Praxis Deutsch 16, S: 13-19, hier: S. 16f.
253 Vgl. Hofmann, M. (2023): Unzuverlässiges Erzählen als Herausforderung der Literaturdidaktik Konzeptionelle Überlegungen mit Bezug auf Heinrich von Kleists Verlobung in St. Domingo, in: Bernhardt, S. & Henke, I. (Hrsg.) Erzähltheorie(n) und Literaturunterricht Verhandlungen eines schwierigen Verhältnisses, S. 94.
254 Standke, J. und Spinner, K.H. (2016) Erzählende Kinder- und Jugendliteratur im Deutschunterricht: Textvorschläge - Didaktik - Methodik, S. 367.
255 Vgl. Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 14f.
256 Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 227.
257 Vgl. Ebd., S. 36.
258 Vgl. Dawidowski, C. (2015) Literaturdidaktik Deutsch: Eine Einführung, S. 304.
259 Vgl. Dawidowski, C. (2015) Literaturdidaktik Deutsch: Eine Einführung, S. 192.
260 Vgl. Bekes, P. (2022): D6 Erzählungen, in: Baurmann, J., Kammler, C. & Müller, A. (Hrsg.) Handbuch Deutschunterricht: Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens, S. 163.
261 Vgl. Bekes, P. (2022): D8 Roman, in: Baurmann, J., Kammler, C. & Müller, A. (Hrsg.) Handbuch Deutschunterricht: Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens, S. 171.
262 Fallwickl, M. (2024): Und alle so still, S. 26f
263 Vgl. Kloppert, K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 21.
264 Vgl. Bekes, P. (2022): D8 Roman, in: Baurmann, J., Kammler, C. & Müller, A. (Hrsg.) Handbuch Deutschunterricht: Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens, S. 171.
265 Vgl. Baurmann, J. & Müller, A. (2022): H4 Inklusiver Deutschunterricht, in: Baurmann, J., Kammler, C. & Müller, A. (Hrsg.) Handbuch Deutschunterricht: Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens, S. 387f.
266 Vgl. Dawidowski, C. (2015) Literaturdidaktik Deutsch: Eine Einführung, S. 282.
267 Vgl. Dawidowski, C. (2015) Literaturdidaktik Deutsch: Eine Einführung, S. 282
268 Vgl. Spinner, K.H. (1997): Reden lernen. In: Praxis Deutsch 144, S. 16 - 22.
269 Vgl. Seyler, D. (2018): Individuelle Textbegegnung und kooperative Aufgabenbearbeitung. Verstehensprozesse beim Nachvollziehen der Perspektiven literarischer Figuren, S. 50ff.
270 Vgl. Kloppert, K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 9.
271 Vgl. Kloppert, K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 244f.
272 Vgl. Ebd., S. 106.
273 Vgl. Dannecker, W. & Schindler, K. (2022) Diversitätsorientierte Deutschdidaktik: Theoretisch-konzeptionelle Fundierung und Perspektiven für empirisches Arbeiten (Band 4), S. 45.
274 Vgl. Kloppert, K. (2021): Perspektivgestaltung und Perspektivverstehen in Kurzgeschichten, S. 21.
275 Vgl. Spinner, K. (1989): Literaturunterricht und moralische Entwicklung, in: Praxis Deutsch 16, S. 13-19, hier: S. 16ff.
276 Vgl. Prieske, L. (2023): Intersektionalität und Perspektivenstruktur: Entwurf eines Modells für die Untersuchung von Intersektionalität in multiperspektivischen Erzähltexten, in: Abrego, Verónica, et al. Intersektionalität Und Erzählte Welten: Literaturwissenschaftliche Und Literaturdidaktische Perspektiven, S. 91f.
- Quote paper
- Lina Lentge (Author), 2025, Und alle so anders. Perspektivübernahme und Empathieförderung mit Mareike Fallwickls "Und alle so still", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1586929