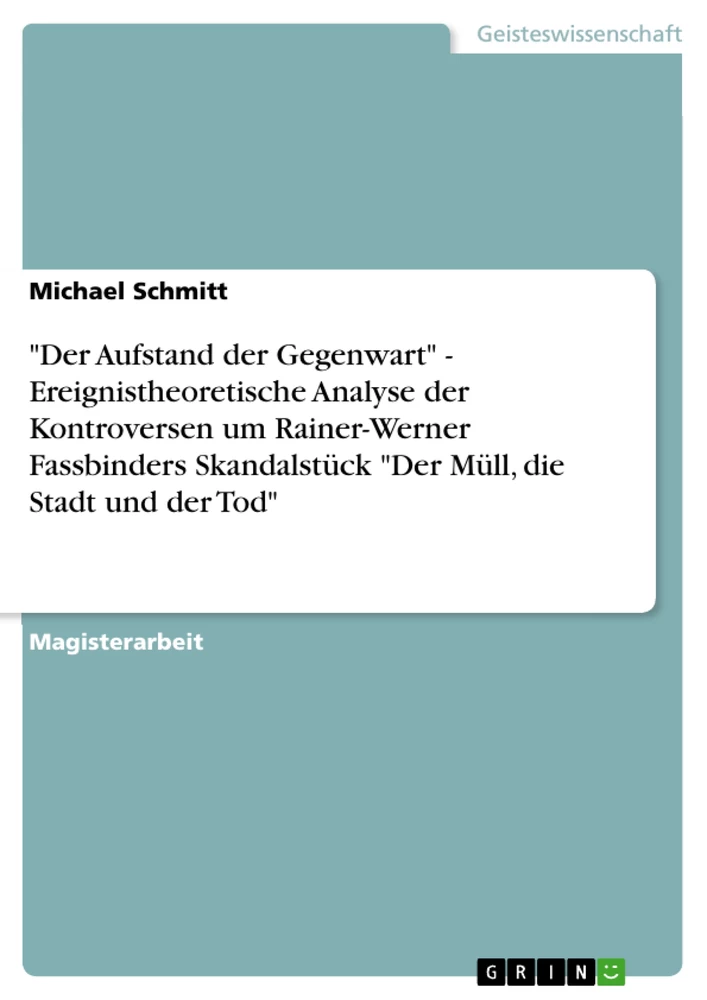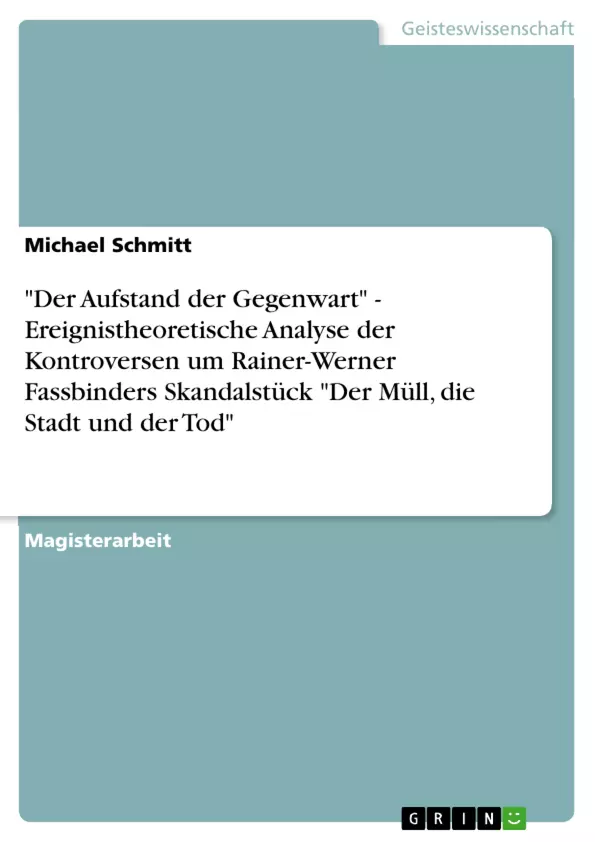Im Herbst 2009 feierte eine Inszenierung von drei Stücken Rainer-Werner Fassbinders Premiere am Mülheimer Theater an der Ruhr. Unter den Stücken befand sich auch das 1974 geschriebene und zwei Jahre später veröffentlichte Stück ‚Der Müll, die Stadt und der Tod’ (im Folgenden ‚Müll’). Es war die erste, wiederholt öffentlich aufgeführte Inszenierung des Stücks an einer deutschen Bühne. Das hat seine Gründe. Der Inhalt des Stücks löste innerhalb eines Jahrzehnts drei Kontroversen aus, 1975, 1984 und 1985, die zuerst in lokalen, später auch in überregionalen und internationalen Print- und Bildmedien ausgetragen wurden. Die Debatten gehören zu den intensivsten und langwierigsten künstlerischen und politischen Auseinandersetzungen, die in der deutschen Nachkriegsgeschichte von einem literarischen Text ausgegangen sind. Im Stück ‚Müll’ präsentierte Fassbinder mit dem ‚Reichen Juden’ eine namenlose jüdische Hauptfigur, die von Habgier, Rachsucht und Geilheit getrieben wird. An besonders dieser, aber auch an weiteren Figurenzeichnungen und am Inhalt des Stücks allgemein entzündeten sich die genannten Kontroversen. Darüber hinaus wurde wiederholt der Vorwurf laut, das Stück, seine Figuren und auch Fassbinder als Autor seien antimsemitisch. Das Stück ‚Müll’ und die dadurch ausgelösten Kontroversen stehen exemplarisch für das Spannungsverhältnis von unverarbeiteter, deutscher Geschichte und dem vitalen Wunsch nach einer unbelasteten und lebenswerten Zukunft. Die nationalsozialistische Vergangenheit der Deutschen und die daraus resultierende Arbeit an der Erinnerung und an der Schuld ist nicht nur ein Hauptthema des hier vorgestellten Stücks, sondern muss auch bei der Lektüre der Arbeit stets mitbedacht werden. Die Bandbreite der in Fassbinders ‚Müll’ angesprochenen Themen und die Reichweite der darauffolgenden Kontroversen haben gezeigt, dass das Stück nicht lediglich aus literatur- bzw. theaterwissenschaftlicher Perspektive diskutiert wurde, sondern verschiedenste Bereiche der Gesellschaft, wie Politik, Wirtschaft, Justiz, Religion, Medien und die Geschichtswissenschaft, zum lebhaften Debattieren angeregt hat. Daher wählt diese Arbeit keinen primär theater- oder medienwissenschaftlichen Zugang zur Thematik, sondern bezieht auch geschichts- und kommunikationswissenschaftliche, psychologische sowie soziologische Theorien und Modelle mit ein.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungen
- Einleitendes
- Einleitung und Fragestellung
- Forschungsstand
- Vorgehensweise
- Elementardaten zum Stück
- Elementardaten
- Kurze Inhaltsangabe
- Literarische Vorlage: Gerhard Zwerenz Roman „Die Erde ist unbewohnbar wie der Mond“
- Analyse des Skandalpotentials von „Müll“
- Einführung in die Ereignistheorie
- Das Ereignis, viele mögliche Zugänge und Definitionen
- Ereignis: Medienereignis
- Historische Kontextualisierung – Zur Entstehung von „Müll“
- Zur Situation im Nachkriegsdeutschland
- Debatten um Schuld und Unschuld
- „Stunde Null“
- Kollektivschuldthese
- Die Situation in Frankfurt am Main
- Ausgewählte Ereignisse der Zeit
- Das „Wunder von Bern - WM-Sieg '54“
- Kniefall von Warschau
- „Gnade der späten Geburt“ und Bitburg-Affäre
- Frankfurter Auschwitzprozesse
- Der Häuserkampf im Westend und Faschismus von Links
- Fassbinder als künstlerischer Leiter am TAT
- Ausgewählte Ereignisse der Zeit
- Die Darstellung von Juden im Werk von R.W. Fassbinder
- Debatten um Schuld und Unschuld
- Die Kontroversen um „Müll“
- 1976: Kontroverse I
- 1984: Kontroverse II
- 1985: Kontroverse III
- Mögliche Interessen der Hauptakteure
- Exkurs: Der Autor und seine Dramenfiguren
- „Der Reiche Jude“: Fiktionalität und Realitätsbezug einer Dramenfigur
- Freiheit und Verantwortung des Autors - Fassbinder ein Antisemit?
- Kunstfreiheit oder Menschenwürde?
- Aufführungsgeschichte
- Ausland
- Westdeutschland und BRD
- 2009: „Müll“-Inszenierung am Mülheimer Theater an der Ruhr
- Chronologische Auflistung zentraler Ereignisse während der Kontroversen
- Das Ereignis - Drei Fallbeispiele und Analyse der Fassbinder-Kontroversen
- Fallbeispiel 1: Ereignis nach Martin Seel
- Das ästhetische Ereignis
- Phänomenologische Ereignis-Analyse der Fassbinder-Kontroversen
- Fallbeispiel 2: Ereignis in der Systemtheorie Luhmanns
- Systeme, Soziale Systeme und Autopoiesis
- Das System Kunst
- Der Übertragungseffekt am Beispiel der Reichstagsverhüllung
- Systemtheoretische Ereignis-Analyse der Fassbinder-Kontroversen
- Fallbeispiel 3: Ereignis als Event
- Der Eventbegriff in Abgrenzung/Erweiterung zum Ereignisbegriff?
- Die Fassbinder-Kontroversen als „Event“?
- Fallbeispiel 1: Ereignis nach Martin Seel
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit befasst sich mit der Ereignistheorie und untersucht die Kontroversen um Rainer Werner Fassbinders Skandalstück „Der Müll, die Stadt und der Tod“ in ihrer historischen und gesellschaftlichen Relevanz. Der Fokus liegt auf der Analyse des Skandals als Ereignis im Sinne verschiedener Ereignistheorien und ihrer Auswirkungen auf das Theater, die Kunst und die Gesellschaft.
- Die Analyse der Kontroversen um Fassbinders „Müll“ in ihrer historischen und gesellschaftlichen Bedeutung
- Die Anwendung verschiedener Ereignistheorien zur Interpretation des Skandals
- Die Untersuchung der Auswirkungen des Skandals auf das Theater, die Kunst und die Gesellschaft
- Die Analyse des Skandalpotentials von „Müll“ im Kontext der Nachkriegsgeschichte Deutschlands
- Die Erörterung der Rolle des Autors und der Kunstfreiheit in der Debatte um „Müll“
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung und Fragestellung, Forschungsstand, Vorgehensweise - Die Arbeit stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung der Kontroversen um „Müll“ im Kontext der Ereignistheorie vor. Der Forschungsstand wird zusammengefasst und die Vorgehensweise erläutert.
- Kapitel 2: Elementardaten zum Stück - Dieses Kapitel liefert grundlegende Informationen über „Müll“, darunter die Inhaltsangabe, die literarische Vorlage von Gerhard Zwerenz und eine Analyse des Skandalpotentials des Stückes.
- Kapitel 3: Einführung in die Ereignistheorie - Dieses Kapitel stellt verschiedene Ansätze der Ereignistheorie vor und definiert den Begriff des Ereignisses im Kontext der Medien und der Kunst.
- Kapitel 4: Historische Kontextualisierung – Zur Entstehung von „Müll“ - Dieser Abschnitt beleuchtet den historischen Kontext der Entstehung von „Müll“ und untersucht die Debatten um Schuld und Unschuld im Nachkriegsdeutschland, die Situation in Frankfurt am Main und die Darstellung von Juden im Werk von R.W. Fassbinder.
- Kapitel 5: Die Kontroversen um „Müll“ - Dieses Kapitel untersucht die Kontroversen um „Müll“ im Detail, beleuchtet die verschiedenen Akteure, ihre Interessen und die chronologische Abfolge der Ereignisse.
- Kapitel 6: Das Ereignis - Drei Fallbeispiele und Analyse der Fassbinder-Kontroversen - Dieses Kapitel analysiert die Fassbinder-Kontroversen anhand von drei Fallbeispielen aus der Ereignistheorie: Martin Seel, Niklas Luhmann und die Eventtheorie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen „Der Müll, die Stadt und der Tod“, Rainer Werner Fassbinder, Ereignistheorie, Skandal, Kontroversen, Kunstfreiheit, Medienereignis, Nachkriegsgeschichte, Deutschland, Frankfurt am Main, Antisemitismus und die Darstellung von Juden im Theater.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Fassbinders Stück 'Der Müll, die Stadt und der Tod'?
Das Stück thematisiert die Immobilienspekulation im Frankfurter Westend und enthält die Figur des „Reichen Juden“, was zu massiven Antisemitismus-Vorwürfen führte.
Warum gilt das Stück als Skandalstück?
Die Darstellung einer jüdischen Figur mit negativen Attributen wie Habgier löste in der deutschen Nachkriegsgesellschaft heftige Kontroversen über Kunstfreiheit und Antisemitismus aus.
Was besagt die Ereignistheorie im Kontext dieses Skandals?
Sie analysiert, wie aus einem literarischen Text ein gesellschaftliches „Ereignis“ wird, das verschiedene Systeme wie Politik, Justiz und Medien gleichzeitig in Aufruhr versetzt.
Welche Rolle spielt die historische Kontextualisierung?
Der Skandal muss vor dem Hintergrund der unbewältigten nationalsozialistischen Vergangenheit und den Debatten um Schuld und Erinnerung im Nachkriegsdeutschland gesehen werden.
Wann wurde das Stück erstmals erfolgreich in Deutschland aufgeführt?
Eine wiederholt öffentlich aufgeführte Inszenierung fand erst im Jahr 2009 am Mülheimer Theater an der Ruhr statt, Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung.
- Zur Situation im Nachkriegsdeutschland
- Citar trabajo
- Michael Schmitt (Autor), 2010, "Der Aufstand der Gegenwart" - Ereignistheoretische Analyse der Kontroversen um Rainer-Werner Fassbinders Skandalstück "Der Müll, die Stadt und der Tod", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158693