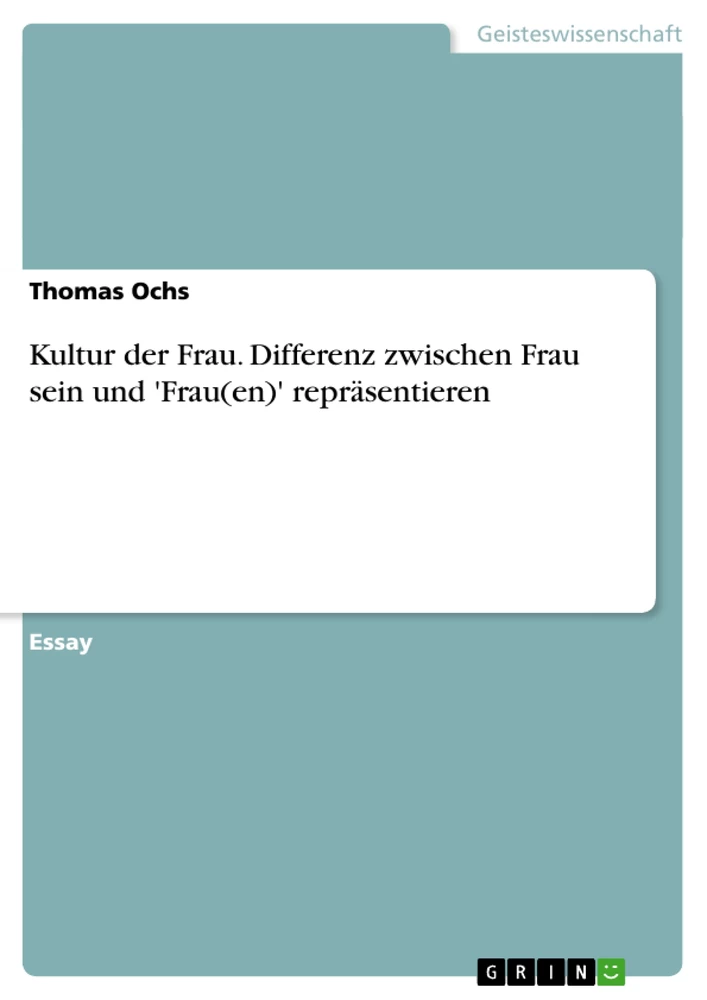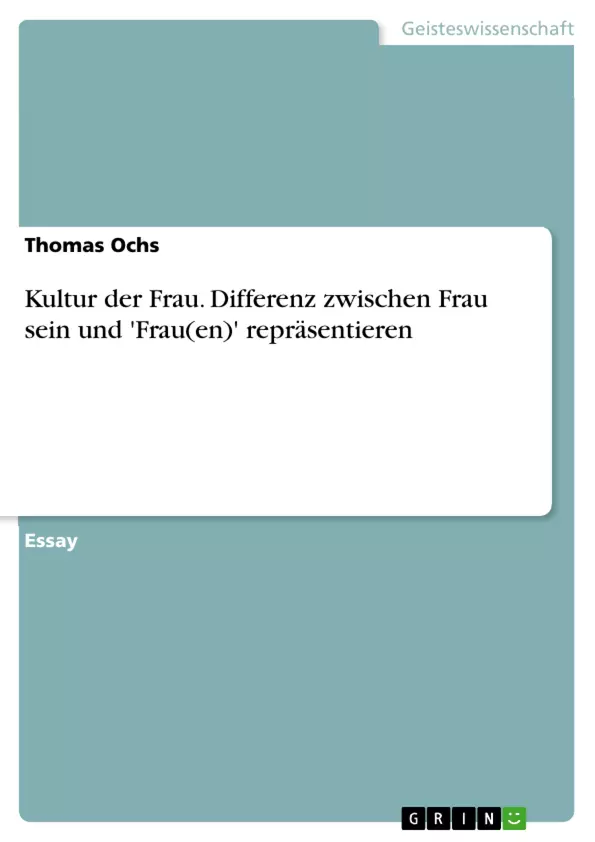Vor nunmehr sechs Jahren erhielt die österreichische Schriftstellerin Elfriede Jelinek den Nobelpreis für Literatur. Man müsse den Preis unweigerlich annehmen; gerade deshalb weil man ihn nicht nur für sich selbst, also für die eigene künstlerische Leistung, sondern weil man ihn stellvertretend für alle Frauen erhalten hat, konstatiert die Preisträgerin in einem Interview mit dem ORF2, unmittelbar nach der erfreulichen Nachricht aus Schweden. Die Tatsache, dass Elfriede Jelinek diesen Preis nicht nur für ihr Schaffen erhalten hat, sondern gerade aufgrund ihrer Re-Präsentationsfunktion, lässt die kulturelle Differenz erhahnen, die innerhalb einer Frau/‚Frau’ schlummert. Elfriede Jelinek steht als öffentliche Person nicht nur für ihre literarische Tätigkeit, sondern auch für das Kulturgut ‚Frau’.
Diese Differenz ist nun im Groben schnell zusammengefasst, aber en detail schwer diskursiv zu fassen bzw. zu trennen. Man ist nicht nur das, was man ist, sondern ist auch das, was man repräsentiert bzw. unweigerlich repräsentieren muss. Im Besonderen Fall des Weiblichen bzw. des Frau-seins und Frau-repäsentierens: man ist Frau und zugleich repräsentiert man als ‚Frau’ eine ganze Kultur.
Kultur der Frau. Differenz zwis chen Frau sein und ‚Fr au (en)’ repr äsentieren.
Das Außerhalb dient dem Leben, das genau dort nicht stattfindet, sonst wären wir alle ja nicht mittendrinnen, im Vollen, im vollen Menschenleben, und es dient der Beobachtung des Lebens, das immer woanders stattfindet. Dort, wo man nicht ist.1
Vor nunmehr sechs Jahren erhielt die österreichische Schriftstellerin Elfriede Jelinek den Nobelpreis für Literatur. Man müsse den Preis unweigerlich annehmen; gerade deshalb weil man ihn nicht nur für sich selbst, also für die eigene künstlerische Leistung, sondern weil man ihn stellvertretend für alle Frauen erhalten hat, konstatiert die Preisträgerin in einem Interview mit dem ORF2, unmittelbar nach der erfreulichen Nachricht aus Schweden. Die Tatsache, dass Elfriede Jelinek diesen Preis nicht nur für ihr Schaffen erhalten hat, sondern gerade aufgrund ihrer Re-Präsentationsfunktion, lässt die kulturelle Differenz erhahnen, die innerhalb einer Frau/‚Frau’ schlummert. Elfriede Jelinek steht als öffentliche Person nicht nur für ihre literarische Tätigkeit, sondern auch für das Kulturgut ‚Frau’.
Diese Differenz ist nun im Groben schnell zusammengefasst, aber en detail schwer diskursiv zu fassen bzw. zu trennen. Man ist nicht nur das, was man ist, sondern ist auch das, was man repräsentiert bzw. unweigerlich repräsentieren muss. Im Besonderen Fall des Weiblichen bzw. des Frau-seins und Frau-repäsentierens: man ist Frau und zugleich repräsentiert man als
‚Frau’ eine ganze Kultur. Die Kultur der ‚Frau’; an diesem Punkt gilt es zu unterscheiden zwischen natürlich-biologischen Prämissen des Weiblichen und kulturellen Gegebenheiten bzw. gesellschaftskulturellen Konnotationen der ‚Frau’2. Oberflächlich betrachtet, können Menschen von ihren körperlichen Gegebenheiten als weiblich oder männlich klassifiziert werden3. Die dieser Unterscheidung inhärenten Funktion ist unweigerlich eine gesellschaftliche Konnotierung und Einordnung in kulturelle Systeme und Anordnungen. Aber grundsätzlich gibt die Natur diesen Duktus aufgrund verschiedener Geschlechtsverhältnisse auch vor. Die daraus entstehenden und kulturell aufgeladenen,
„selbstgesponnene[n] Bedeutungsgewebe“4 (Kultur5 ) sind Teil menschlicher Existenz und auch möglicher Abgrenzung vom Tierisch-Animalischen. Biologisch betrachtet liegt diese geschlechtliche Differenz zwischen ‚weiblich’ und ‚männlich’ in einer unterscheidbaren körperlichen Konstitution. Versucht man diese anatomische Geschlechtlichkeit jedoch innerhalb eines kulturellen Systems zu diskutieren bzw. in ihren Gegebenheiten aufzudröseln eröffnet sich im Bezug auf ‚Weiblichkeit’ ein kulturelles Problem.
„Eine Frau zu ‚sein’, ist sicherlich nicht alles, was man ist.“6 Mit ihrem Abschnitt Die Subjekte von Geschlecht/Geschlechtsidentität/Begehren innerhalb ihrer theoretischen Abhandlung Das Unbehagen der Geschlechter postuliert Judith Butler einen immens wichtigen Ansatz für den Diskurs rund um eine Kultur der Frau (Geschlechtsidentitäten). Anschließend an das eingangs beschriebene Beispiel bezüglich Elfriede Jelinek tut sich das Problemfeld zwischen der Repräsentationsfunktion als ‚Frau’ und dem Frau sein weiter auf. Begrifflichkeiten des Weiblichen und der Frau sind gesellschaftlich konnotiert. Sie vermitteln unabhängig jedweder Kultur immer gesellschaftlich festgelegte Codes. Schlagworte wie Feminismus und Emanzipation stellen sich im westlichen Kulturraum diesbezüglich die Frage nach der Veränderbarkeit und Steuerung solcher Gegebenheiten.
Es genügt also nicht zu untersuchen, wie Frauen in Sprache und Politik vollständiger repräsentiert werden können. Die feministische Kritik muß auch begreifen, wie die Kategorie ‚Frau(en)’, das Subjekt des Feminismus, gerade durch jene Machtstrukturen hervorgebracht und eingeschränkt wird, mittels derer das Ziel der Emanzipation erreicht werden soll.7
Die fast schon ironische Problematik des ganzen feministisch-politischen Diskurses reicht wohl noch weiter als das, was Judith Butler mit ihrem Verweis auf die konstituierenden Machtstrukturen derselben Kategorien, die der Feminismus zu verteidigen versucht, beschreibt. Nicht nur dass diese Kategorien Mann und Frau von den Machtstrukturen selbst konstruiert wurden, sondern auch dass beispielsweise die Forderungen einer gendergerechten
[...]
1 Elfriede Jelinek, „Im Abseits“, 2005, http://www.elfriedejelinek.com/, 01.05.2010.
2 Vgl. Clifford Geertz, Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, Übers. Brigitte Luchesi/Rolf Bindemann, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991, S. 9 & S. 15.
3 Diese oberflächliche Betrachtung soll an diesem Punkt genügen; gleichzeitg muss aber auch klar sein, dass eine strikte, biologische Unterscheidung nicht unbedingt wissenschaftlich korrekt bzw. diskursiv genug ist; für den hier zu erläuternden Sachverhalt aber durchaus ausreichend.
4 Geertz, Dichte Beschreibung, 1991, S. 9.
5 Vgl. Ebd., Kulturbegriff von Geertz soll an dieser Stelle ausreichen um sich der eigentlichen Problematik nähern zu können.
6 Judith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter, Übers. Kathrina Menke, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2008, S. 18.
Häufig gestellte Fragen zu "Kultur der Frau. Differenz zwis chen Frau sein und ‚Fr au (en)’ repr äsentieren"
Worum geht es in diesem Text?
Der Text befasst sich mit der kulturellen Differenz zwischen dem Frau-Sein und der Repräsentation von "Frau", wobei die Arbeit von Elfriede Jelinek als Beispiel dient, um die Repräsentationsfunktion von Frauen in der Kultur zu beleuchten.
Was ist die zentrale These des Textes?
Die zentrale These ist, dass es eine Differenz zwischen dem biologisch-natürlichen Frau-Sein und den kulturellen bzw. gesellschaftlichen Konnotationen der "Frau" gibt, die durch Repräsentationsfunktionen und gesellschaftliche Erwartungen geformt werden.
Welche Rolle spielt Elfriede Jelinek in diesem Text?
Elfriede Jelinek wird als Beispiel angeführt, um zu verdeutlichen, wie eine Frau in der Öffentlichkeit nicht nur für ihre eigene Leistung steht, sondern auch stellvertretend für das Kulturgut "Frau" repräsentiert.
Was versteht der Text unter der "Kultur der ‚Frau’"?
Die "Kultur der ‚Frau’" bezieht sich auf die gesellschaftlichen und kulturellen Konnotationen, die mit dem Begriff "Frau" verbunden sind, und die sich von den rein biologischen Prämissen des Weiblichen unterscheiden.
Welche Rolle spielt Judith Butler in diesem Kontext?
Judith Butlers Theorie "Das Unbehagen der Geschlechter" wird herangezogen, um das Problemfeld zwischen der Repräsentationsfunktion als "Frau" und dem eigentlichen Frau-Sein zu untersuchen. Dabei wird betont, dass die Kategorien und Begriffe, die das Weibliche beschreiben, gesellschaftlich konnotiert sind.
Welche Problematik wird in Bezug auf den Feminismus angesprochen?
Der Text verweist auf die Problematik, dass feministische Kritik nicht nur untersuchen muss, wie Frauen in Sprache und Politik besser repräsentiert werden können, sondern auch, wie die Kategorie "Frau(en)" selbst durch Machtstrukturen hervorgebracht und eingeschränkt wird.
Was wird unter dem Begriff "Repräsentationsfunktion" verstanden?
Die Repräsentationsfunktion beschreibt die Rolle, die eine Frau als öffentliche Person einnimmt, indem sie nicht nur für sich selbst, sondern auch für eine ganze Kultur steht. Im Fall von Elfriede Jelinek steht sie stellvertretend für das Kulturgut "Frau".
Wie wird der Kulturbegriff in diesem Text verwendet?
Der Kulturbegriff wird im Sinne von Clifford Geertz als "selbstgesponnene[n] Bedeutungsgewebe" verstanden, das Teil menschlicher Existenz und möglicher Abgrenzung vom Tierisch-Animalischen ist.
Welche Quellen werden in diesem Text zitiert?
Der Text zitiert Elfriede Jelinek, Clifford Geertz und Judith Butler.
- Citation du texte
- Thomas Ochs (Auteur), 2010, Kultur der Frau. Differenz zwischen Frau sein und 'Frau(en)' repräsentieren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158750