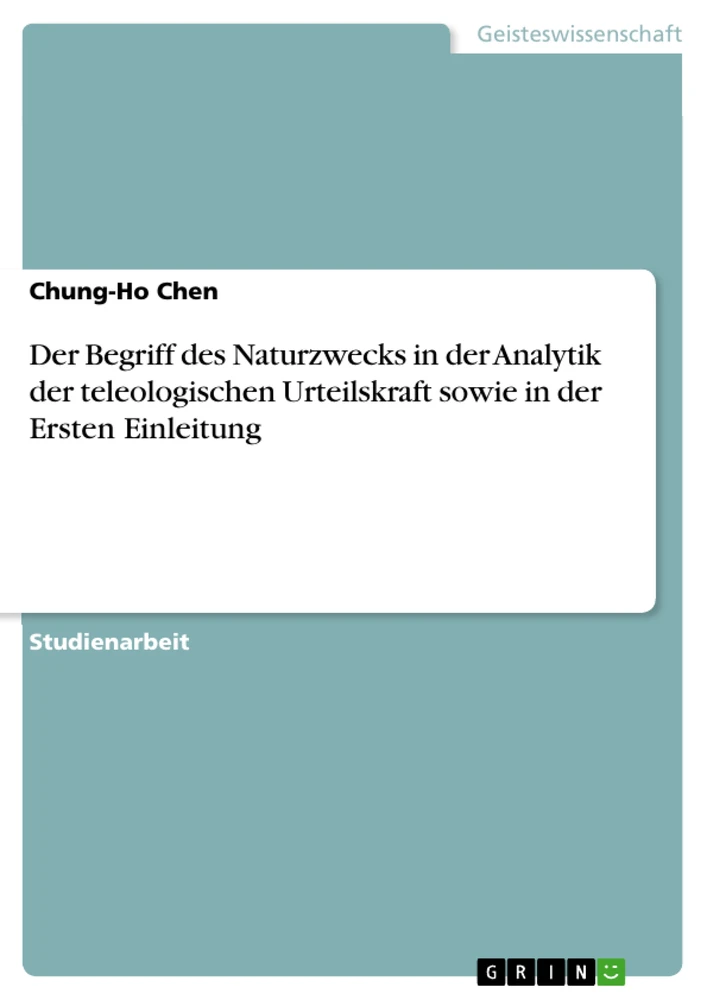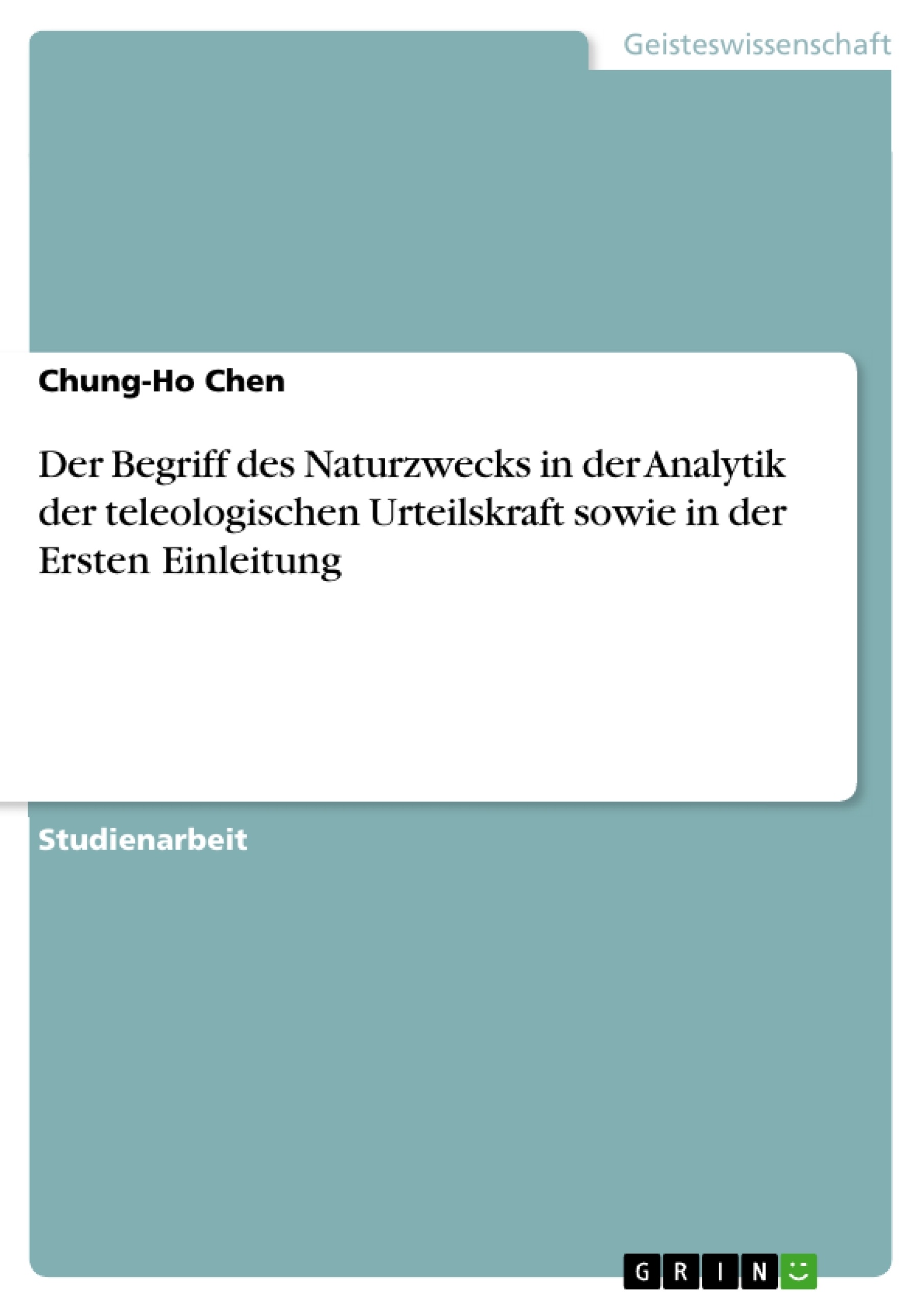Ohne Zweifel ist der Begriff des Naturzwecks der Kernbegriff der Kritik der teleologischen Urteilskraft. Um diesen Begriff zu erklären, entfaltet Kant seine eigene Naturteleologie. Sogar wird dieser Begriff als die Kernfrage, die Kant zur Rechtfertigung seiner Naturteleologie bewältigen muss, angesehen, nämlich ob der Begriff des Naturzwecks philosophisch kohärent ist und inwiefern dieser Begriff ohne Selbstwiderspruch gebraucht werden kann.
Genau genommen, ist der Begriff des Naturzwecks der wichtigste Begriff in der Analytik der teleologischen Urteilskraft. Man könnte sagen, dass das Ziel der gesamten Analytik die Erörterung dieses Begriffs ist. Insbesondere in §§64-65 setzt sich Kant mit diesem Begriff durch die Charakterisierung der organisierten Wesen als Naturzweck auseinander. Man könnte der Meinung sein, dass Kant die Absicht hat, durch diesen Begriff das Phänomen des organisierten Wesens zu erklären.
Aber das ist meines Erachtens ein Missverständnis, dass Kants Definition des Naturzwecks aus der Charakterisierung des organisierten Wesens stammen würde, oder dass Kants Absicht lediglich die Erklärung des Phänomens des organisierten Wesens gewesen wäre. Vielleicht ist sich Kant auch bewusst gewesen, dass es zu einem solchen Missverständnis kommen könnte, weswegen er in §66 diesen Gedanken deutlich widerspricht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Der Begriff des Naturzwecks in der Analytik
- 1.1 Die Unterscheidung zwischen dem Verstand und der Vernunft
- 1.2 Die Unterscheidung zwischen Kunstprodukt und Naturprodukt
- 2 Der Begriff des Naturzwecks in der Ersten Einleitung
- 2.1 Die Zweckmäßigkeit der Natur als ein Prinzip a priori der reflektierenden Urteilskraft
- 2.2 Der Begriff des Naturzwecks als ein Begriff für den objektiven Gebrauch der Zweckmäßigkeit der Natur
- 2.2.1 Der Begriff der Erzeugung der Dinge
- 2.2.2 Die reflektierende Urteilskraft und die Vernunft in der teleologischen Beurteilung
- 2.2.2.1 Die reflektierende Urteilkraft als eine zu empirischen Begriffen gehörende Handlung des Erkenntnisvermögen
- 2.2.2.2 Der Begriff des Zwecks der Vernunft als ein Begriff der Dinge
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit von Chung-Ho Chen untersucht den Begriff des Naturzwecks im Kontext der Kantischen Philosophie, insbesondere in der "Kritik der teleologischen Urteilskraft". Das Hauptziel ist die Klärung des Begriffs und seiner philosophischen Kohärenz, insbesondere im Bezug auf die Frage, ob und inwiefern der Begriff des Naturzwecks ohne Selbstwiderspruch verwendet werden kann.
- Die Unterscheidung zwischen dem Verstand und der Vernunft
- Die Rolle der reflektierenden Urteilskraft im teleologischen Denken
- Die Zweckmäßigkeit der Natur als a priori Prinzip
- Der Begriff des Naturzwecks als ein Begriff für den objektiven Gebrauch der Zweckmäßigkeit der Natur
- Die Frage nach der philosophischen Kohärenz des Naturzwecks
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Begriff des Naturzwecks als Kernbegriff der "Kritik der teleologischen Urteilskraft" vor und erläutert die zentrale Frage der Arbeit, nämlich die philosophische Kohärenz und der korrekte Gebrauch dieses Begriffs.
Das erste Kapitel analysiert den Begriff des Naturzwecks in der "Analytik der teleologischen Urteilskraft" im Kontext der Unterscheidung zwischen Verstand und Vernunft, sowie der Differenz zwischen Kunstprodukten und Naturprodukten.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Begriff des Naturzwecks in der "Ersten Einleitung" und beleuchtet die Zweckmäßigkeit der Natur als a priori Prinzip der reflektierenden Urteilskraft. Es geht auch auf die Rolle des Naturzwecks als Begriff für den objektiven Gebrauch der Zweckmäßigkeit der Natur ein.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die zentralen Themen der teleologischen Urteilskraft, Naturzweck, reflektierende Urteilskraft, Vernunft, Verstand, Zweckmäßigkeit, Organisierte Wesen, Naturganze, Kantische Philosophie, Kritik der teleologischen Urteilskraft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein „Naturzweck“ bei Kant?
Ein Naturzweck ist ein Ding, das sowohl Ursache als auch Wirkung seiner selbst ist, wie es Kant am Beispiel organisierter Wesen (Organismen) erläutert.
Was ist der Unterschied zwischen Kunst- und Naturprodukten?
Während Kunstprodukte durch eine äußere Vernunft (den Handwerker) entstehen, tragen Naturprodukte (Organismen) ihr Bildungsprinzip in sich selbst.
Welche Rolle spielt die reflektierende Urteilskraft?
Die reflektierende Urteilskraft nutzt den Begriff der Zweckmäßigkeit als regulatives Prinzip, um die Natur dort zu verstehen, wo mechanische Erklärungen des Verstandes nicht ausreichen.
Ist der Begriff des Naturzwecks philosophisch kohärent?
Kant untersucht genau diese Frage, um sicherzustellen, dass die Teleologie nicht im Widerspruch zur Kausalität des Verstandes steht.
In welchem Werk thematisiert Kant den Naturzweck?
Zentral ist die „Kritik der teleologischen Urteilskraft“ (Teil der Kritik der Urteilskraft) sowie deren „Erste Einleitung“.
- Citation du texte
- Chung-Ho Chen (Auteur), 2008, Der Begriff des Naturzwecks in der Analytik der teleologischen Urteilskraft sowie in der Ersten Einleitung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158813