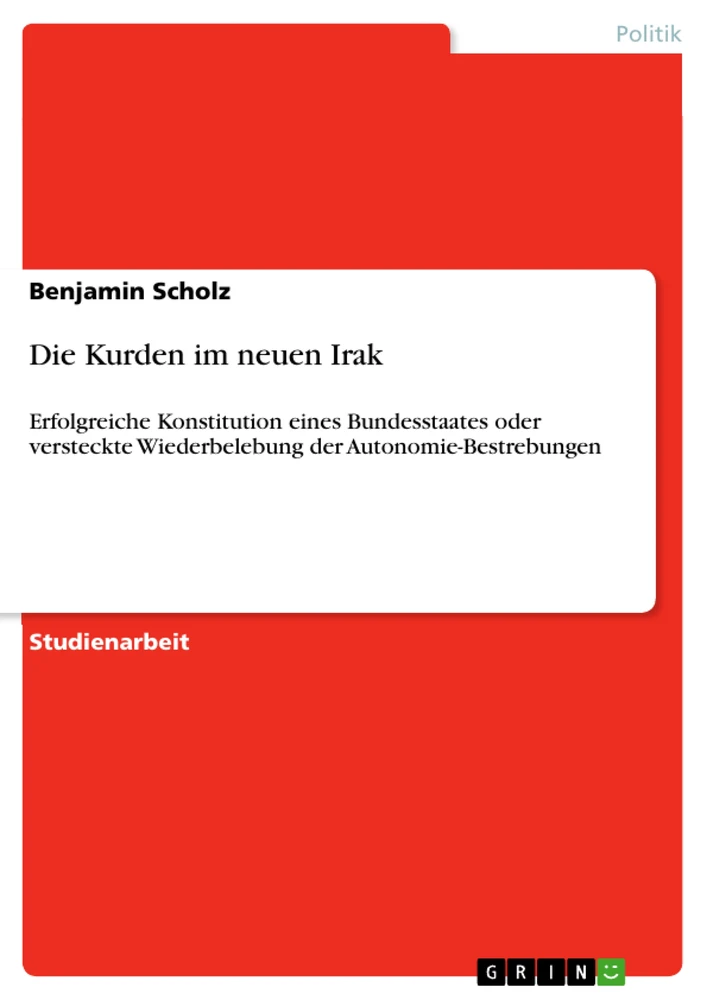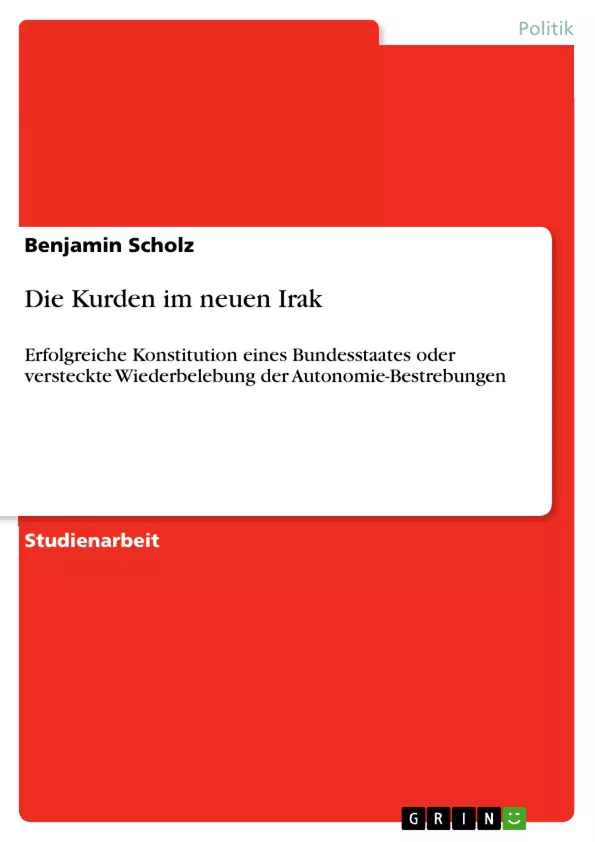INHALTSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG
1.1 THEMA UND RELEVANZ
1.2 FRAGESTELLUNG UND HYPOTHESEN
1.3 THEORIE
1.4 METHODIK UND GLIEDERUNG
2. HAUPTTEIL
2.1 EIN GESCHICHTLICHER ABRISS - DIE BEDEUTUNG EXTERNER MÄCHTE
2.2 DIE ETHNISCHE KONFLIKTLINIE - DER FORMALE STAATSAUFBAU
2.2.1 DIE IRAKISCHE BUNDESVERFASSUNG
2.2.2 DER VERFASSUNGSENTWURF KURDISTANS
2.2.3 DIE WAHLEN - KRÄFTEVERHÄLTNISSE IN LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE
2.3 WEITERE GEGENWÄRTIGE KONFLIKTLINIEN
2.3.1 INTERNATIONALE AKTEURE
2.3.2 DIE WIRTSCHAFT - DAS ÖL-GESETZ
3. FAZIT
3.1 ERFOLGREICHE BUNDESSTAATEN-KONSTITUTION, VERSTECKTE WIEDERBELEBUNG DER AUTONOMIE-BESTREBUNGEN?
5. ANHANG
5.1 QUELLENVERZEICHNIS
5.2 DIE VERTEILUNG DER PARLAMENTSSITZE
5.2 DIE REGIERUNGSKONSTELLATIONEN
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1 THEMA UND RELEVANZ
- 1.2 FRAGESTELLUNG UND HYPOTHESEN
- 1.3 THEORIE
- 1.4 METHODE UND GLIEDERUNG
- 2. HAUPTTEIL
- 2.1 EIN GESCHICHTLICHER ABRISS - DIE BEDEUTUNG EXTERNER MÄCHTE
- 2.2 DIE ETHNISCHE KONFLIKTLINIE – DER FORMALE STAATSAUFBAU
- 2.2.1 DIE IRAKISCHE BUNDESVERFASSUNG
- 2.2.2 DER VERFASSUNGSENTWURF FÜR KURDISTAN
- 2.2.3 DIE WAHLEN - KRÄFTEVERHÄLTNISSE IN LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE
- 2.3 WEITERE GEGENWÄRTIGE KONFLIKTLINIEN
- 2.3.1 INTERNATIONALE AKTEURE
- 2.3.2 DIE WIRTSCHAFT - DAS ÖL-GESETZ
- 3. FAZIT
- 3.1 DIE ERFOLGREICHE BUNDESSTAATEN-KONSTITUTION, VERSTECKTE WIEDERBELEBUNG DER AUTONOMIE-BESTREBUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die aktuelle Situation der Kurden im Irak im Kontext der Staatsentwicklung nach dem 3. Golfkrieg zu untersuchen. Es wird analysiert, ob es sich bei der gegenwärtigen Situation um eine erfolgreiche Konstitution eines Bundesstaates handelt oder ob die Kurden ihre Autonomiebestrebungen weiterhin verfolgen. Im Zentrum stehen die Rolle der Kurden in der irakischen Politik, die Bedeutung von außenpolitischen Einflussfaktoren und die Konflikte um Ressourcen, insbesondere Öl.
- Die Rolle der Kurden in der irakischen Staatsentwicklung
- Die Bedeutung externer Einflussfaktoren auf die politische Situation im Irak
- Der Einfluss ethnischer Konflikte auf die Stabilität des Iraks
- Die Verhandlungen über die Ausgestaltung der Gesetze und die Bedeutung des Öl-Gesetzes
- Die Autonomiebestrebungen der Kurden und ihre Auswirkungen auf die irakische Einheit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einleitung in das Thema und stellt die Relevanz der Kurden im neuen Irak heraus. Die Arbeit analysiert die aktuelle Situation im Kontext historischer Konflikte und der einflussreichen externen Akteure. Die Fragestellung wird definiert und die wichtigsten Hypothesen der Arbeit werden aufgestellt.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit den verschiedenen Konfliktlinien im Irak, sowohl historisch als auch aktuell. Es wird die ethnische Dimension der Konflikte beleuchtet und die Rolle der irakischen Verfassung, des Verfassungsprojekts für Kurdistan und der Wahlen wird untersucht. Die Bedeutung internationaler Akteure und die wirtschaftspolitischen Konflikte, insbesondere das Öl-Gesetz, werden ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen und Themen wie ethnische Konflikte, Bundesstaatlichkeit, Autonomie, Irak, Kurden, Öl-Gesetz, internationale Akteure, politische Macht, Staatsentwicklung und Stabilität. Dabei werden die Erfahrungen der Kurden im neuen Irak im Kontext der politischen und ökonomischen Veränderungen seit 2003 untersucht.
- Arbeit zitieren
- Diplom-Politologe Benjamin Scholz (Autor:in), 2009, Die Kurden im neuen Irak, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158847