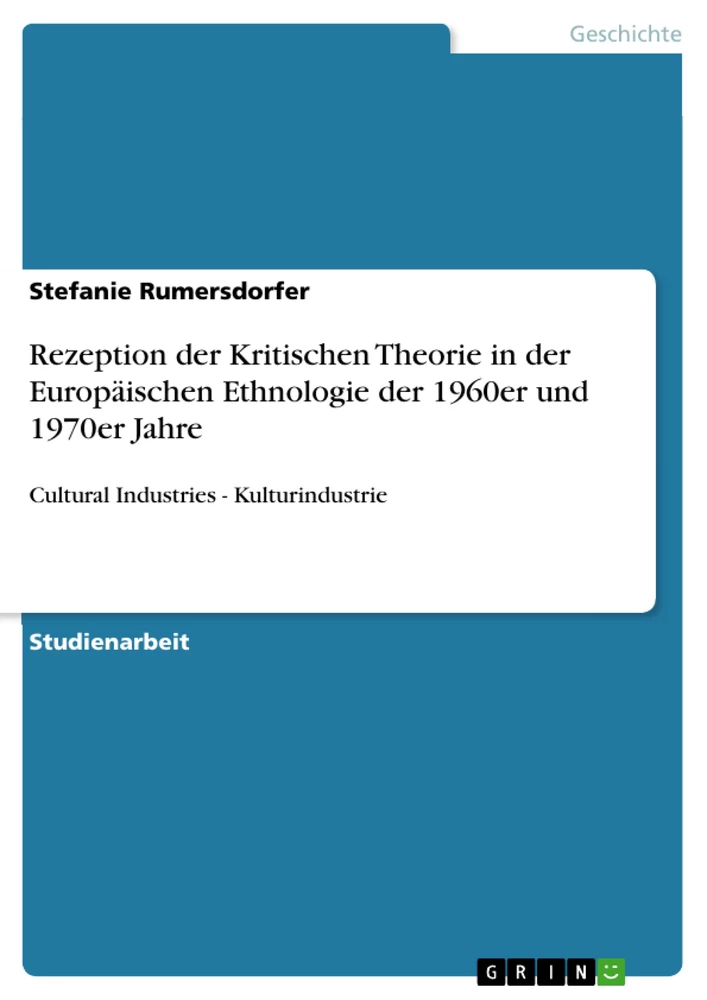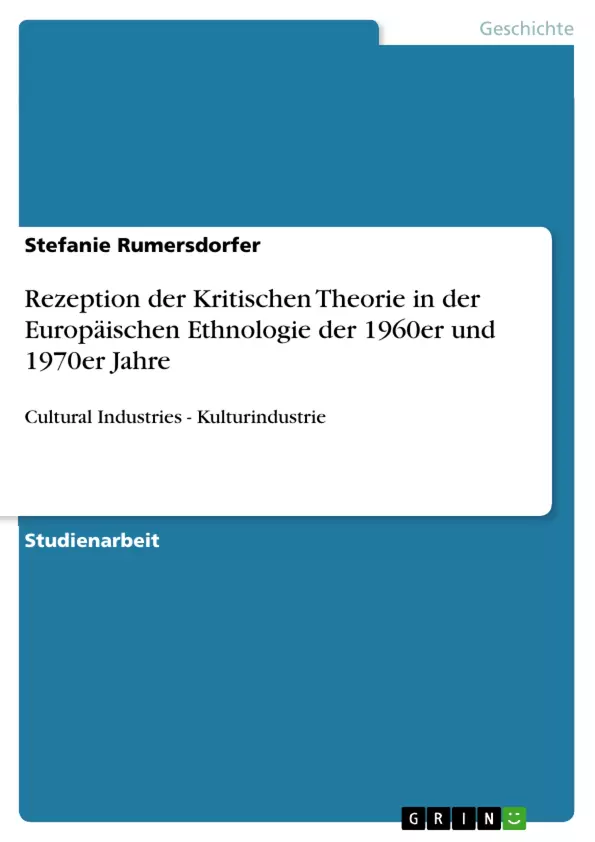Die Welt in der wir leben ist eine Schnelllebige. Haben wir uns gerade eben noch mit dem neuesten Stand der Technik beschäftigt, ist diese im nächsten Moment schon wieder über-holt und nicht mehr up-to-date. Die Menschen, vor allem jene Personen die im Dienste der Wissenschaft forschen, wollen immer höher, immer weiter, immer schneller an ein Ziel ge-langen, welches sie selbst noch nicht einmal sehen, und ziehen mit diesem Denken die ganze Gesellschaft und somit jedes einzelne Individuum in diesen Bann. Alle wollen Teil des großen Ganzen, und somit dieser schnelllebigen Welt, sein. An der Stelle, wo man bemüht ist mög-lichst viele Personen an diesem Phänomen teil haben zu lassen, treten Massenkommunikati-onsmittel und Massenkultur auf. Unzählige Menschen pilgern zu Filmen, Museen und Kunstwerken, von denen sie meinen, diese Art von „Kunst“ konsumieren zu müssen. Dem Begriff „Konsument“ steht jener des „Anbieters“ gegenüber. Dieser stellt Kultur bereit, die im wahrsten Sinne des Wortes gekauft und wieder weggeworfen werden kann. So will man Individuen gleich und unkritisch machen, damit sie sich nicht gegen die gesellschaftlichen Gegebenheiten wehren. Erich Fromm drückt dies in seinem Buch „Die Kunst des Liebens“ (1956) wie folgt aus: „Die heutige Gesellschaft predigt das Ideal einer nicht-individualisierten Gleichheit, weil sie menschliche Atome braucht, die sich untereinander völlig gleichen, damit sie im Massenbetrieb glatt und reibungslos funktionieren, damit allen den gleichen Anweisungen folgen und jeder trotzdem überzeugt ist, das zu tun, was er will. Genauso wie die moderne Massenproduktion die Standardisierung der Erzeugnisse verlang, so verlangt auch der gesellschaftliche Prozeß die Standardisierung des Menschen, und diese Standardisierung nennt man dann „Gleichheit““ (Fromm 1956, S.26). Eine ähnliche Auffassung, wie die Gesellschaft funktioniert und somit alle Akteur/innen in ihren Aufgaben miteinschließt, haben auch Theodor W. Adorno und Max Horkheimer. Sie legen mit ihrer Schrift „Dialektik der Aufklärung“ (1947), welches als Hauptwerk der Kritischen Theorie zählt, einen Grundbaustein für die Kritik an der Gesellschaft. Der damit verbundene Begriff „Kulturindustrie“ schlägt weite Wellen, welche bis in die Europäische Ethnologie eindringen und diese in ihrem Selbstverständnis als auch der Präsentation von Kultur nach außen nicht unwesentlich beeinflussen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Input
- Kritische Theorie und Dialektik der Aufklärung
- Kulturindustrie
- Rezeption in den 60er und 70er Jahren
- ,,Einflüsse von Funk und Fernsehen auf lebendiges Singen". Referat von Ernst Klusen
- ,,Volkstümliches Erzählgut im Unterricht". Referat von Wolfgang Brückner
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Rezeption der Kritischen Theorie in der Europäischen Ethnologie der 1960er und 1970er Jahre. Sie analysiert die Auswirkungen der Kulturindustrie auf die Gesellschaft und deren Einfluss auf das Selbstverständnis der Ethnologie.
- Die Dialektik der Aufklärung und die Kritik an der Manipulation des Menschen durch die Kulturindustrie
- Der Einfluss der Massenkommunikationsmittel auf die Entwicklung der Gesellschaft und des individuellen Bewusstseins
- Die Standardisierung von Kultur und die Frage nach Autonomie und Individualität
- Die Rezeption der Kritischen Theorie in der Europäischen Ethnologie der 1960er und 1970er Jahre
- Die Auswirkungen der Kulturindustrie auf die Präsentation von Kultur in der Ethnologie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und beleuchtet die Auswirkungen der schnelllebigen modernen Gesellschaft auf die Individuen. Es wird auf die Rolle der Massenkommunikation und der Kulturindustrie in diesem Kontext eingegangen.
- Theoretischer Input: Dieses Kapitel behandelt die Kritische Theorie und die Dialektik der Aufklärung. Es analysiert die Thesen von Adorno und Horkheimer und deren Kritik an der Manipulation des Menschen durch den Spätkapitalismus.
- Rezeption in den 60er und 70er Jahren: Dieses Kapitel beleuchtet die Rezeption der Kritischen Theorie in der Europäischen Ethnologie der 1960er und 1970er Jahre. Es analysiert zwei Beispiele aus dieser Zeit: das Referat von Ernst Klusen zu den Einflüssen von Funk und Fernsehen auf das lebendige Singen und das Referat von Wolfgang Brückner zum volkstümlichen Erzählgut im Unterricht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die zentralen Themen der Kritischen Theorie, der Kulturindustrie, der Massenkommunikation, der Manipulation und der Rezeption dieser Konzepte in der Europäischen Ethnologie. Darüber hinaus werden Themen wie Standardisierung, Individualität, Autonomie und die Präsentation von Kultur in der Ethnologie behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptwerk der Kritischen Theorie?
Die „Dialektik der Aufklärung“ (1947) von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer gilt als das fundamentale Werk der Kritischen Theorie.
Was versteht man unter dem Begriff "Kulturindustrie"?
Kulturindustrie bezeichnet die kommerzielle Vermarktung von Kultur, die zur Standardisierung des Menschen und zur Unterdrückung kritischen Denkens führt.
Wie beeinflusste die Kritische Theorie die Europäische Ethnologie?
In den 1960er und 70er Jahren führte die Rezeption der Theorie zu einer kritischen Hinterfragung von Massenkultur und der Manipulation durch Medien wie Funk und Fernsehen.
Welchen Standpunkt vertrat Erich Fromm zur Standardisierung?
Fromm kritisierte, dass die moderne Gesellschaft eine „nicht-individualisierte Gleichheit“ fordert, damit Menschen im Massenbetrieb reibungslos funktionieren.
Welche ethnologischen Referate werden in der Arbeit analysiert?
Analysiert werden Arbeiten von Ernst Klusen (Einfluss von Medien auf das Singen) und Wolfgang Brückner (volkstümliches Erzählgut im Unterricht).
- Quote paper
- Stefanie Rumersdorfer (Author), 2009, Rezeption der Kritischen Theorie in der Europäischen Ethnologie der 1960er und 1970er Jahre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158924