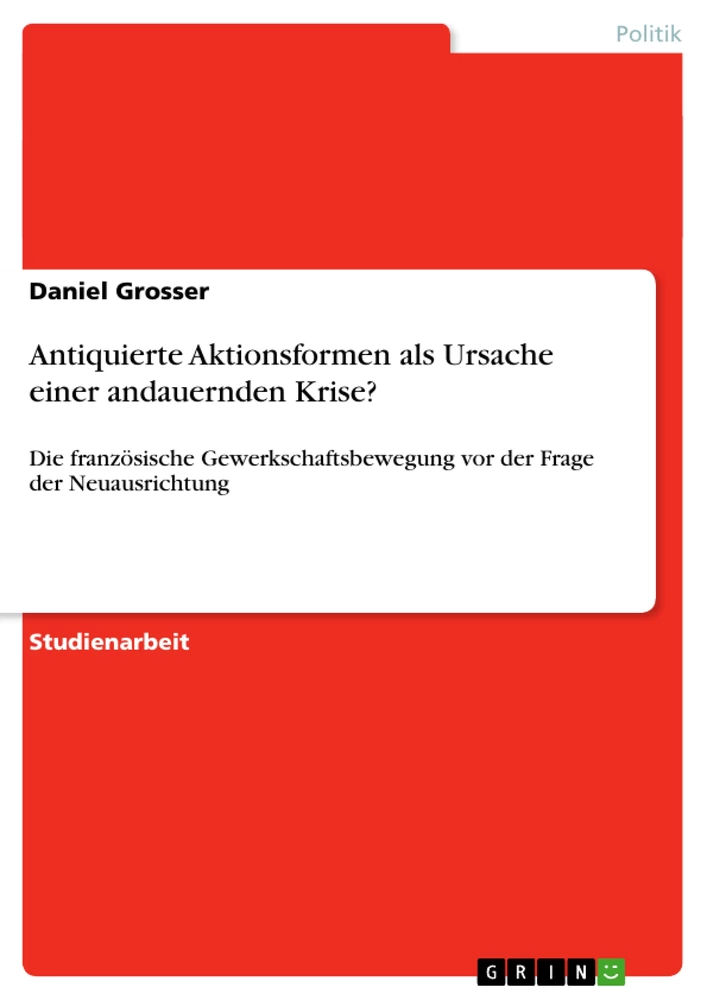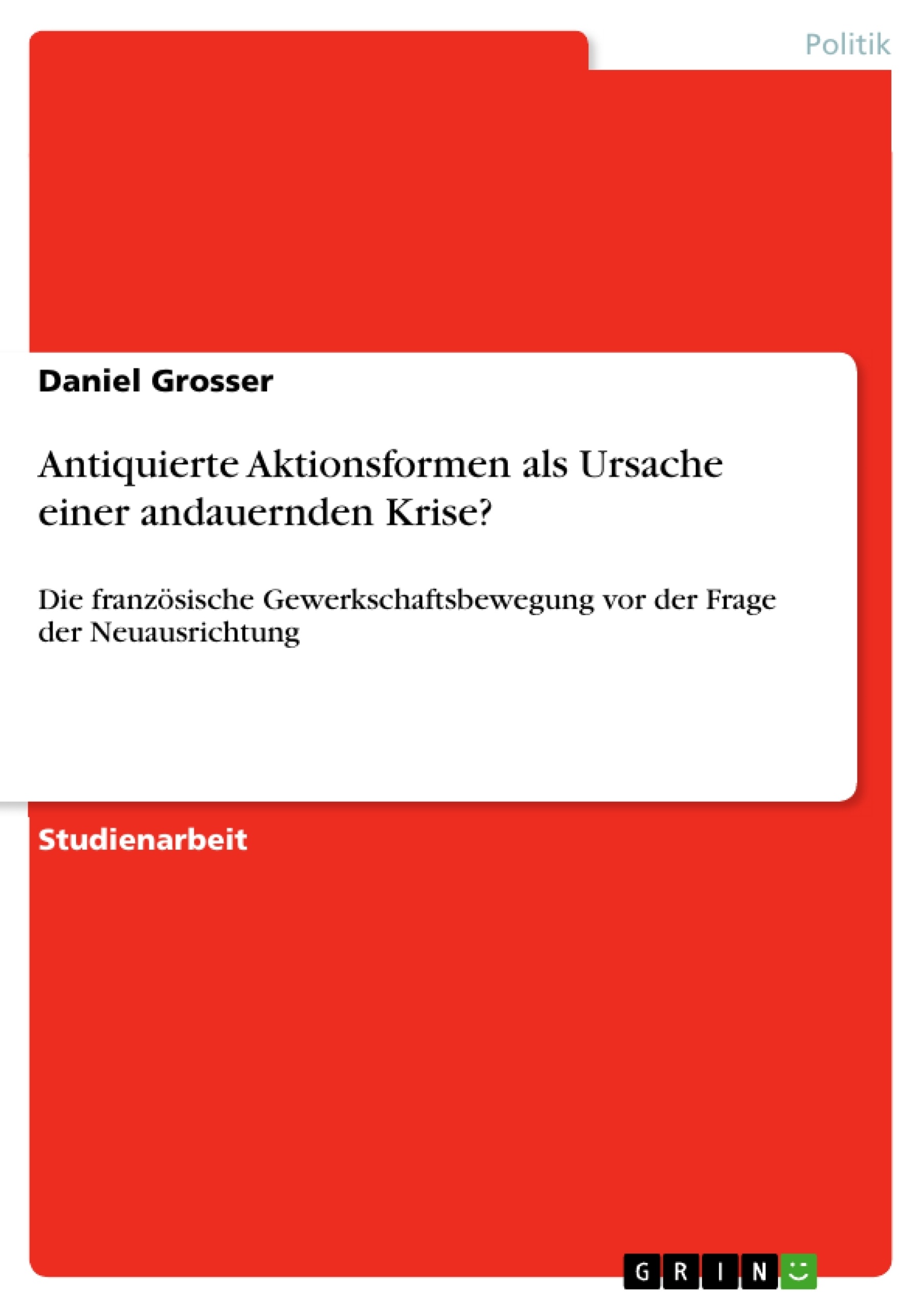Die heute existierenden Arbeitnehmergewerkschaften in Frankreich scheinen dem Laien vor allem durch ihre augenscheinlich radikale Aktionsweise ein Begriff zu sein: Sie seien durch eine ausgeprägte Streikfreude, angeführt durch den Generalstreik als schärfstem Schwert branchenübergreifender Arbeitskämpfe, zu charakterisieren. Angeführt durch die kommunistische CGT wurde dieses durch die Verfassung legitimierte Mittel zuletzt im März 2009 angewendet, um von Präsident Nicolas Sarkozy eine soziale Wirtschaftspolitik und die Rückdrängung von Kurzarbeit zu fordern.
Fraglich ist jedoch, ob direkte Aktionsformen in globalisierten Wirtschafts- und Arbeitsmärkten zukunftsfähig sind. Trotz großen Vertrauens seitens der Basis bei Betriebsrats- oder Arbeitsgerichtswahlen leiden die Gewerkschaften seit langem an Mitgliederverlusten und damit finanziellen Einbußen und geringerer Mobilisierungsfähigkeit. In der vorliegenden Hausarbeit möchte ich, vordergründig am Beispiel der CGT, untersuchen, in wieweit sich die Gewerkschaften hinsichtlich ihrer Einflussnahme auf die Regierung auf Faktoren wie der gesellschaftlichen Individualisierung oder der Herausbildung neuer Berufszweige eingestellt haben und welche Strategien sie gewählt haben oder nutzen könnten, um sich aus ihrer seit dem Ende der 1970er Jahren angespannten Lage zu manövrieren. Ebenfalls soll dabei herausgestellt werden, ob sie ihre schwierige Situation zum Beispiel durch eine zu enge Bindung an Parteien selbst mitverursacht haben oder ob sie lediglich Fremdeinflüssen unterliegen.
Um die bisherige Aktionsweise der Gewerkschaften zu verstehen, sollen zunächst ihre historischen Wurzeln und die daraus entstandenen Handlungsweisen betrachtet werden. Hieran schließt sich eine Analyse der verschiedenen Ursachen für die heutige Lage der Gewerkschaften an. Zuletzt erörtere ich in Frage kommende Gegenmaßnahmen, um eine Antwort auf die Frage zu finden, ob die bisher angewendeten Strategien noch zeitgemäß sind oder eine grundlegende Neuausrichtung ratsam erscheint.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Herausbildung der französischen Richtungsgewerkschaften
- 2.1. Rechtliche und betriebliche Hürden um 1900
- 2.2. Entstehung der CGT als erstem französischen Gewerkschaftsbund
- 2.3. Entstehung der übrigen repräsentativen Gewerkschaften
- 3. Direkte Aktion
- 4. Kooperationen mit Parteien
- 5. Adressaten der Forderungen
- 6. Mitgliederschwund und ideologische Orientierungslosigkeit
- 7. Die deutsche Gewerkschaftslandschaft als Vorbild?
- 8. Wege aus der Krise
- 9. Fazit
- 10. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Situation der französischen Gewerkschaftsbewegung im Kontext des gesellschaftlichen Wandels und der globalisierten Wirtschaft. Am Beispiel der CGT wird analysiert, inwieweit sich die Gewerkschaften auf neue Herausforderungen wie Individualisierung und neue Berufszweige eingestellt haben. Die Arbeit beleuchtet auch die Rolle von Parteienbindungen und die Frage, ob die bisherigen Aktionsformen noch zeitgemäß sind.
- Die Herausbildung der französischen Gewerkschaftslandschaft
- Die Rolle der CGT in der französischen Gewerkschaftsbewegung
- Die Auswirkungen von gesellschaftlicher Individualisierung und neuen Berufszweigen auf die Gewerkschaften
- Die Beziehung zwischen Gewerkschaften und politischen Parteien
- Die Frage der Neuausrichtung der Gewerkschaftsstrategie
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Arbeit stellt die Problemstellung der französischen Gewerkschaftsbewegung vor und skizziert den Forschungsansatz. Sie beleuchtet die scheinbar radikale Aktionsweise der Gewerkschaften und fragt nach ihrer Zukunftsfähigkeit im Kontext globalisierter Märkte.
- Kapitel 2: Die Herausbildung der französischen Richtungsgewerkschaften: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung der französischen Gewerkschaftslandschaft und die verschiedenen Richtungen, die sich entwickelt haben. Es analysiert die rechtlichen und betrieblichen Hürden, die den Aufstieg von Gewerkschaften im frühen 20. Jahrhundert erschwerten, sowie die Entstehung der CGT als erster französischer Gewerkschaftsbund.
- Kapitel 3: Direkte Aktion: Der dritte Abschnitt befasst sich mit der Aktionsweise der Gewerkschaften und deren Einsatz von direkter Aktion. Es werden die Formen und Folgen der Aktionsformen erläutert, insbesondere der Generalstreik, und ihre Relevanz in der heutigen Zeit diskutiert.
- Kapitel 4: Kooperationen mit Parteien: Dieses Kapitel analysiert die Beziehung zwischen Gewerkschaften und politischen Parteien. Es wird die Frage behandelt, inwieweit die Zusammenarbeit mit Parteien die Handlungsfähigkeit der Gewerkschaften beeinflusst.
- Kapitel 5: Adressaten der Forderungen: Dieser Abschnitt beleuchtet die Adressaten der gewerkschaftlichen Forderungen. Es wird diskutiert, welche Akteure die Gewerkschaften mit ihren Forderungen erreichen wollen und welche Strategien sie dafür einsetzen.
- Kapitel 6: Mitgliederschwund und ideologische Orientierungslosigkeit: In diesem Kapitel wird der anhaltende Mitgliederschwund der Gewerkschaften und die damit verbundenen Herausforderungen untersucht. Es wird die Frage nach der ideologischen Orientierung und der Fähigkeit der Gewerkschaften, sich an die sich wandelnden gesellschaftlichen Verhältnisse anzupassen, diskutiert.
- Kapitel 7: Die deutsche Gewerkschaftslandschaft als Vorbild?: Hier wird die deutsche Gewerkschaftslandschaft als mögliches Vorbild für die französischen Gewerkschaften vorgestellt und analysiert, ob deren Strategien und Strukturen für Frankreich relevant sind.
- Kapitel 8: Wege aus der Krise: Dieses Kapitel beleuchtet mögliche Strategien, mit denen die französischen Gewerkschaften aus ihrer aktuellen Krise herausfinden könnten. Es werden verschiedene Ansätze und Lösungsansätze diskutiert, die der aktuellen Situation Rechnung tragen.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der französischen Gewerkschaftsbewegung, insbesondere der CGT, im Kontext von gesellschaftlicher Individualisierung, globalisierten Wirtschafts- und Arbeitsmärkten, direkter Aktion, Parteienbindung und strategischer Neuausrichtung. Die Arbeit analysiert die historischen Wurzeln der Gewerkschaften und die Herausforderungen, die sich aus den Veränderungen im 21. Jahrhundert ergeben. Sie untersucht die Rolle von direkter Aktion und Kooperationen mit politischen Parteien und beleuchtet die Frage, ob eine grundlegende Neuausrichtung der Gewerkschaftsstrategie notwendig ist, um der aktuellen Krise zu begegnen.
Häufig gestellte Fragen
Warum befinden sich französische Gewerkschaften in einer Krise?
Trotz hoher Mobilisierungsfähigkeit bei Streiks leiden sie unter massivem Mitgliederschwund, finanziellen Einbußen und einer ideologischen Orientierungslosigkeit in globalisierten Märkten.
Was ist die CGT?
Die CGT (Confédération générale du travail) ist der älteste und traditionell kommunistisch orientierte Gewerkschaftsbund Frankreichs, bekannt für seine radikalen Aktionsformen.
Was versteht man unter "direkter Aktion"?
Direkte Aktionen umfassen radikale Kampfmittel wie den Generalstreik oder branchenübergreifende Arbeitskämpfe, um politischen Druck direkt auf die Regierung auszuüben.
Sind die Aktionsformen französischer Gewerkschaften noch zeitgemäß?
Dies wird kritisch hinterfragt, da gesellschaftliche Individualisierung und neue Berufszweige oft kooperativere oder flexiblere Strategien erfordern, als sie der traditionelle Generalstreik bietet.
Welche Rolle spielt die Bindung an politische Parteien?
Die enge Bindung an Parteien (wie früher die CGT an die KPF) wird oft als Mitursache für die Krise gesehen, da sie die Unabhängigkeit schwächt und potenzielle Mitglieder abschrecken kann.
Können deutsche Gewerkschaften als Vorbild dienen?
Die Arbeit untersucht, ob das deutsche Modell der Sozialpartnerschaft und Konsensorientierung Wege aus der französischen Krise aufzeigen könnte.
- Quote paper
- Daniel Grosser (Author), 2010, Antiquierte Aktionsformen als Ursache einer andauernden Krise?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159048