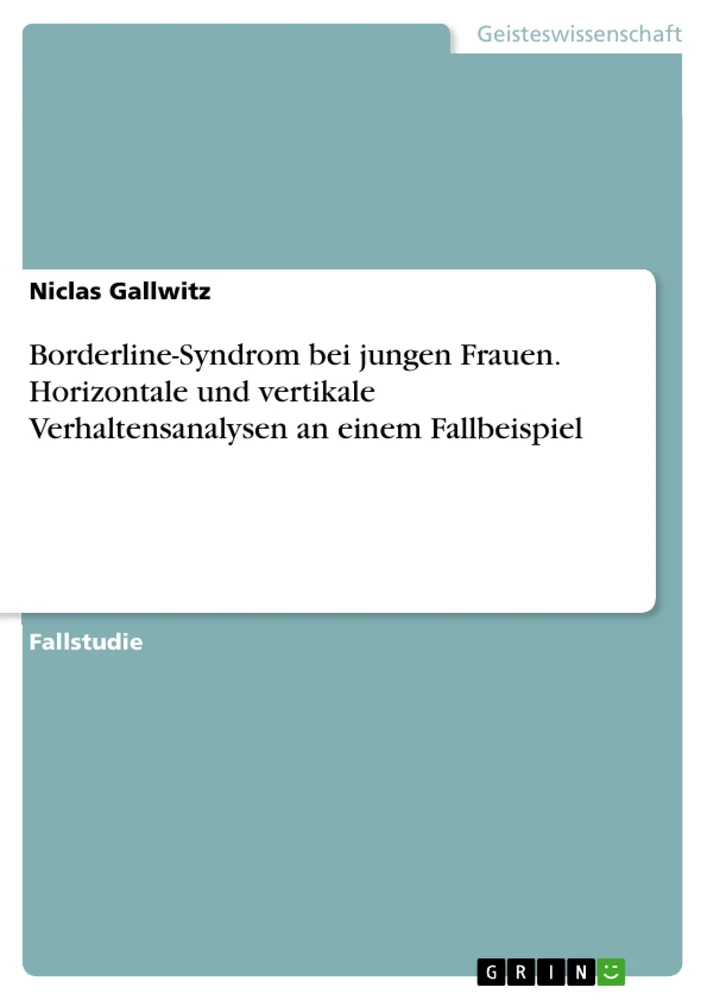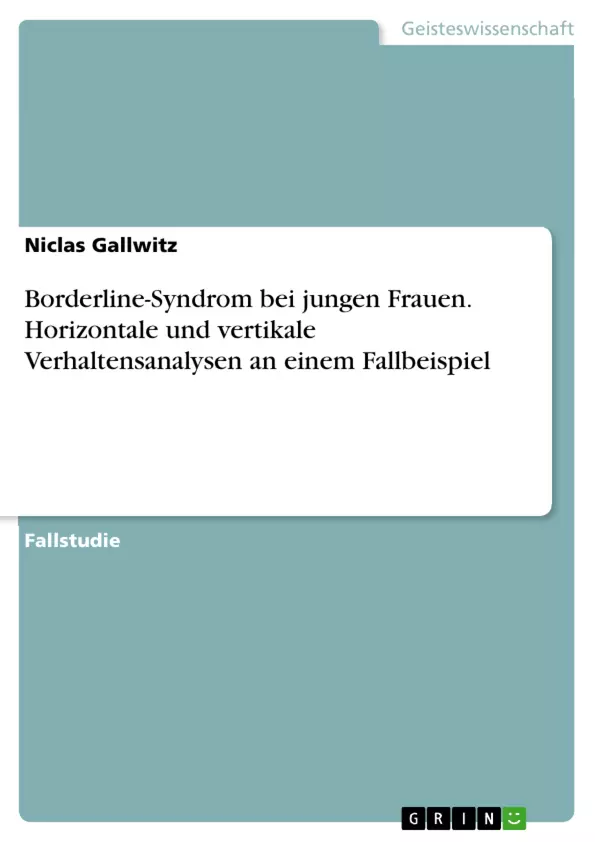Ausgangslage der hier vorliegenden Arbeit ist eine Fallkonzeptualisierung und Therapieplanung anhand des Fallbeispiels der Borderline-Patientin "Frau S.". Dabei soll eine horizontale und vertikale Verhaltensanalyse durchgeführt und beispielhaft dargestellt werden. Ziel dieser Arbeit ist es die Fragestellung, warum insbesondere junge Frauen von der Borderline-Erkrankung betroffen sind, zu beantworten. Dazu werden im Theorieteil zunächst die wichtigsten theoretischen und empirischen Grundlagen erläutert. Es wird herausgearbeitet, was das Borderline-Syndrom genau ist, welche Symptome diese Erkrankung aufweisen kann und welche möglichen Entstehungsursachen vorhanden sind. Weiter wer den allgemeine Prävalenzraten in der Bevölkerung und spezifisch bei jugendlichen Männern und Frauen dargestellt. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden dann Mikro- und Makroanalysen anhand des Falles von Frau S. beispielhaft dargestellt und durchgeführt. Die Einzelfallanalyse beginnt mit einer Makroanalyse, in der die biographischen Lernerfahrungen des Patienten erarbeitet werden. Dabei wird ein Zusammenhang zu dem bio-psycho-sozialen-Krankheitsmodell her gestellt und mögliche disponierende, auslösende und aufrechterhaltende Faktoren diskutiert, wobei Belastungen bzw. Stressoren und Ressourcen gegenüber gestellt werden. Anschließend an die Makroanalyse wird die Mikroanalyse anhand des SOR(K)C-Modells erläutert. Den Abschluss dieser Arbeit bildet im Diskussionsteil die kritische Reflexion zur Thematik. Dabei werden wichtige Handlungsempfehlungen zur Prävention von Borderline abgeleitet. Die Arbeit schließt mit einem Fazit ab.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- A Einleitung
- I Der Fall von Frau S.
- B Theoretische und empirische Grundlagen
- I Borderline-Persönlichkeitsstörung
- II Borderline bei jungen Frauen
- III Ätiologie des Borderline-Syndroms
- IV Diagnostik und Therapie
- C Fallkonzeptualisierung und Therapieplanung
- I Problemanalyse auf der Makroebene – Vertikale Verhaltensanalyse
- 1 Biografische Anamnese
- 2 Biografische Lernerfahrungen
- a Klassische Konditionierung
- b Operante Konditionierung
- c Lernen am Modell
- 3 Zusammenfassung der Stressoren und Ressourcen
- II Problemanalyse auf der Mikroebene – horizontale Verhaltensanalyse
- 1 Reaktionskomponente R
- 2 Stimuluskomponente S
- 3 Konsequenzkomponente C
- 4 Organismuskomponente O
- III Therapieziele und Behandlungsplan
- I Problemanalyse auf der Makroebene – Vertikale Verhaltensanalyse
- D Diskussion
- E Ausblick und Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung & Themen
Diese Arbeit befasst sich mit dem Borderline-Syndrom bei jungen Frauen und untersucht, warum diese Gruppe besonders häufig betroffen ist. Hierfür wird eine detaillierte Fallkonzeptualisierung und Therapieplanung anhand eines konkreten Fallbeispiels vorgenommen, ergänzt durch horizontale und vertikale Verhaltensanalysen.
- Definition, Symptomatik und Ätiologie der Borderline-Persönlichkeitsstörung
- Prävalenz und Risikofaktoren des Borderline-Syndroms bei jungen Frauen
- Analyse biographischer Lernerfahrungen mittels klassischer und operanter Konditionierung sowie Lernen am Modell
- Anwendung des SOR(K)C-Modells zur Problemanalyse auf Mikroebene
- Entwicklung von Therapieempfehlungen, insbesondere Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT)
- Diskussion von Präventionsstrategien im Kontext der emotionalen Entwicklung von Kindern und Familien
Auszug aus dem Buch
Der Fall von Frau S.
Die 35-jährige Frau S., jugendliches Äußeres und gemäß ihrer Angaben Mutter eines 2-jährigen Sohnes, kommt auf eigene Initiative in die Beratungsstelle. Sie berichtet im Erstgespräch, dass sie bis vor einigen Monaten eine „toxische Beziehung" geführt habe. Ihr Exfreund sei alkoholabhängig gewesen. Sie hätten sich oft gestritten, wobei sowohl er als auch sie körperlich aggressiv geworden seien, und es habe während der 2-jährigen Beziehung mehrere Zerwürfnisse gegeben. Sie habe häufig Wutausbrüche gehabt und ihren Exfreund absichtlich eifersüchtig gemacht. Weiterhin habe sie ihren Exfreund mit dessen Bruder betrogen. Nach kurzzeitigen Kontaktabbrüchen habe sie immer wieder Kontakt zu ihm gesucht und gewollt, dass er ihre Situation verstehe. Sie hätten sich immer wieder versöhnt, bis sich die Situation schließlich so zugespitzt habe, dass sie immer öfter darüber nachgedacht habe, nicht mehr leben zu wollen. Nach einem heftigen Streit habe sie schließlich den Kontakt zu ihm bis heute abgebrochen. Seit Ende ihrer Beziehung und dem Auszug gehe es ihr generell etwas besser und sie verspüre wieder mehr Lebensfreude. Insbesondere wenn sie allein daheim sei, leide sie jedoch häufig unter Angstzuständen mit subjektiver Atemnot und einem starken Druckgefühl in der Brust. Sie befürchte, dass ihr Expartner im Rausch plötzlich wieder vor ihrer Tür stehen könnte. Generell sei sie schnell sehr aufgeregt und ständig hoch angespannt „wie unter Strom“, habe einen starken Bewegungsdrang. Wenn der Druck zu groß sei, verletzte sie sich gelegentlich selbst, v.a. durch oberflächliche Schnitte an den Unterarmen oder indem sie ihre Hand gegen die Wand schlage. Gelegentlich „kiffe“ sie auch, um ruhiger zu werden. Um sich abzulenken, putze sie oft die Wohnung oder räume Sachen um. Es helfe ihr manchmal auch laute Musik zu hören und dabei zu tanzen. Sie fühle sich oft ängstlich und allein gelassen, da sie doch „eh nicht liebenswert“ sei. Manchmal fühle sie sich auch nur innerlich „leer“. Sie sei generell sehr chaotisch und es falle ihr manchmal schwer, ihren Alltag zu managen und konzentriert bei einer Sache zu bleiben. Sie sei schnell überfordert, wolle aber alles tun, damit es ihrem Sohn gut gehe. Die Bindung zwischen den beiden sei sehr gut. Gleichzeitig habe sie Probleme damit, Kontrolle abzugeben und sich auf andere zu verlassen, obwohl sie sich eigentlich sehnlichst eine eigene „normale Familie“ wünsche. Sie wolle ihre Ruhe haben und endlich ankommen, sei jedoch mit der letzten Beziehung „mal wieder gescheitert“. Als körperliche Beschwerden nennt Frau S. eine starke Skoliose sowie eine Multiple Sklerose.
Zusammenfassung der Kapitel
A Einleitung: Führt in die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) ein, beschreibt Symptome und Prävalenz bei jungen Frauen und stellt die Forschungsfrage nach den Gründen dieser Häufung.
B Theoretische und empirische Grundlagen: Erläutert die BPS nach ICD-10 und APA, thematisiert ihre Ätiologie, Prävalenzraten bei jungen Frauen und die Diagnose- sowie Therapieansätze wie DBT und Schematherapie.
C Fallkonzeptualisierung und Therapieplanung: Stellt eine detaillierte Fallkonzeptualisierung und Therapieplanung für eine Patientin (Frau S.) vor, basierend auf horizontalen und vertikalen Verhaltensanalysen unter Berücksichtigung biografischer Lernerfahrungen, Stressoren und Ressourcen.
D Diskussion: Reflektiert kritisch über die Anwendung der Verhaltensanalyse, die Notwendigkeit individueller Therapieansätze und betont die Bedeutung von Präventionsmaßnahmen im Kindes- und Jugendalter.
E Ausblick und Fazit: Fasst die Erkenntnisse zusammen und unterstreicht die Relevanz der Verhaltensanalyse als therapeutisches Instrument, während die Forschungsfrage zur geschlechtsspezifischen Prävalenz als weiterhin offen und forschungsbedürftig hervorgehoben wird.
Schlüsselwörter
Borderline-Persönlichkeitsstörung, BPS, Verhaltensanalyse, Fallkonzeptualisierung, Therapieplanung, Dialektisch-Behaviorale Therapie, DBT, junge Frauen, psychische Erkrankungen, Kindheitserfahrungen, traumatische Erfahrungen, Emotionsregulation, Selbstverletzung, SOR(K)C-Modell.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit grundsätzlich?
Die Arbeit befasst sich mit dem Borderline-Syndrom bei jungen Frauen und erstellt eine detaillierte Fallkonzeptualisierung und Therapieplanung für ein Fallbeispiel, um die Symptomatik und mögliche Behandlungsstrategien zu beleuchten.
Was sind die zentralen Themenfelder?
Zentrale Themenfelder sind die Definition und Ätiologie der Borderline-Persönlichkeitsstörung, ihre Prävalenz bei jungen Frauen, vertikale und horizontale Verhaltensanalysen sowie therapeutische Ansätze wie die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT).
Was ist das primäre Ziel oder die Forschungsfrage?
Das primäre Ziel ist die Beantwortung der Forschungsfrage, warum insbesondere junge Frauen von der Borderline-Erkrankung betroffen sind, und die beispielhafte Darstellung einer Fallkonzeptualisierung und Therapieplanung.
Welche wissenschaftliche Methode wird verwendet?
Die Arbeit verwendet horizontale und vertikale Verhaltensanalysen, insbesondere das SOR(K)C-Modell, um das Problemverhalten einer Patientin zu konzeptualisieren und Therapieansätze abzuleiten.
Was wird im Hauptteil behandelt?
Im Hauptteil werden die theoretischen und empirischen Grundlagen der BPS dargelegt, eine detaillierte Fallkonzeptualisierung für Frau S. durchgeführt und konkrete Therapieziele und ein Behandlungsplan vorgestellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Borderline-Persönlichkeitsstörung, BPS, Verhaltensanalyse, Fallkonzeptualisierung, Therapieplanung und Dialektisch-Behaviorale Therapie.
Welche spezifischen biographischen Lernerfahrungen werden bei Frau S. hervorgehoben?
Bei Frau S. werden biographische Lernerfahrungen wie eine instabile und chaotische Kindheit, Vernachlässigung durch die Mutter, der Missbrauch durch den Stiefgroßvater sowie die Beobachtung dysfunktionaler Beziehungsmuster hervorgehoben.
Wie wird das SOR(K)C-Modell in der Problemanalyse der Mikroebene angewendet?
Das SOR(K)C-Modell wird zur Analyse des Problemverhaltens von Frau S. eingesetzt, indem Stimuli (S), Organismus-Variablen (O), Reaktionen (R), Kontingenzen (K) und Konsequenzen (C) des Verhaltens untersucht werden.
Warum konnte die Forschungsfrage zur höheren Prävalenz bei jungen Frauen nicht eindeutig beantwortet werden?
Die Forschungsfrage konnte nicht eindeutig beantwortet werden, da die genannten Risikofaktoren nicht kausal beschrieben werden können und auch bei anderen Geschlechtern auftreten können, was weitere kontrollierte Studien erforderlich machen würde.
Welche Präventionsstrategien werden empfohlen, um der Entwicklung einer BPS entgegenzuwirken?
Es werden eine sichere Eltern-Kind-Bindung, Programme zur Förderung elterlicher Fähigkeiten, Reduktion von Kindesmisshandlung und Vernachlässigung sowie frühzeitige Schulung emotionaler Intelligenz bei Kindern empfohlen.
- Quote paper
- Niclas Gallwitz (Author), 2023, Borderline-Syndrom bei jungen Frauen. Horizontale und vertikale Verhaltensanalysen an einem Fallbeispiel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1590585