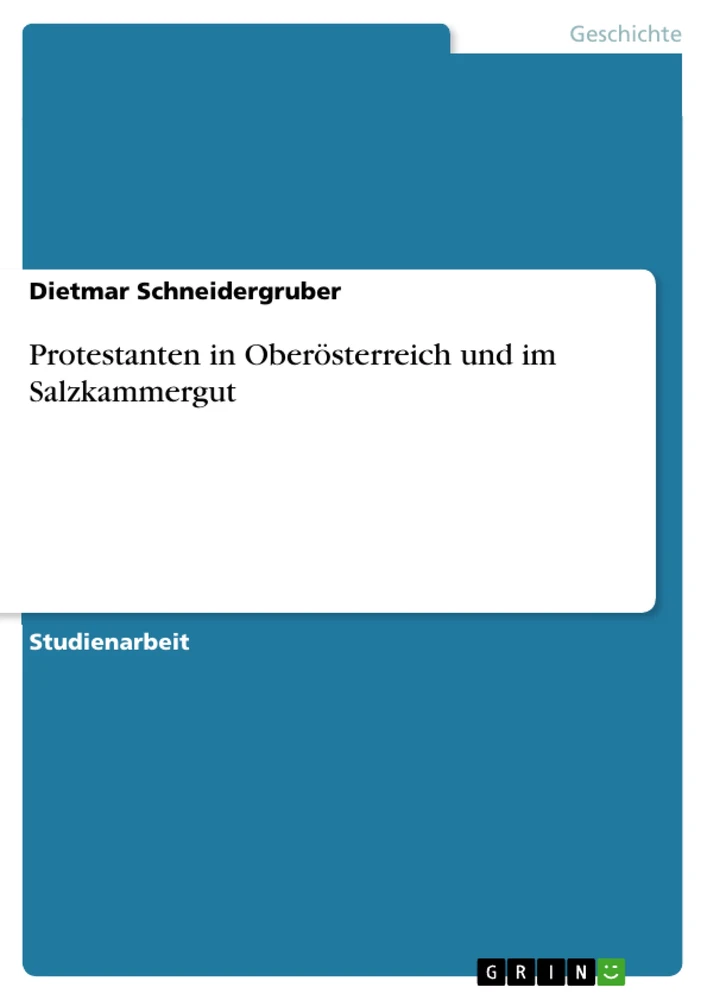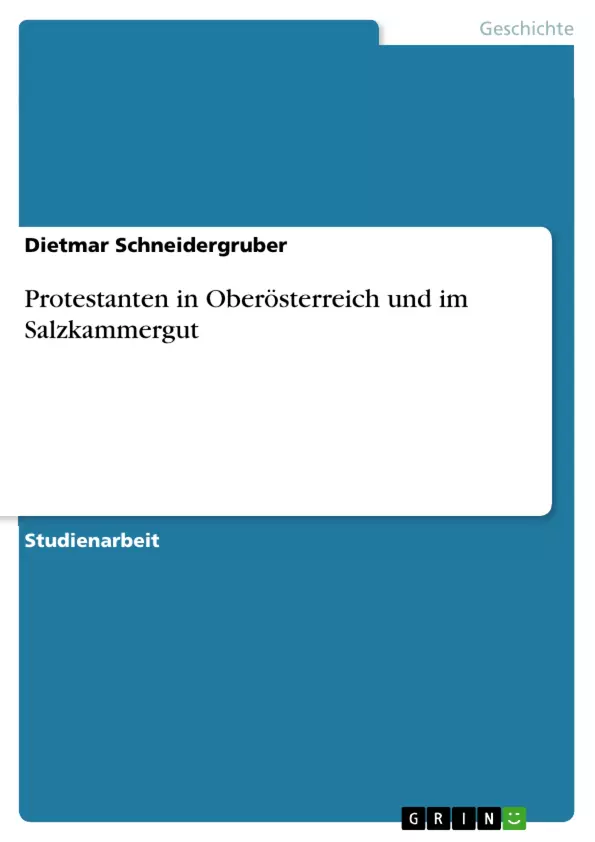Das Salzkammergut war ein besonderer Teil des Habsburgerreiches, der wirtschaftlich sehr bedeutend durch den Salzabbau war. Es war nicht Teil des Landes ob der Enns, sondern unterstand direkt den Erzherzögen von Österreich. Der Begriff Salzkammergut von heute ist aber ein touristischer Begriff, der mit den historischen Dimensionen nur wenig zu tun hat.
Die Verwaltung des Kammergutes war in Gmunden, also außerhalb. Noch heute steht ein Löwe an der alten Bundesstraße bei Traunkirchen, der die Grenze des alten Salzkammergutes markiert. Er ist zwar erst 1861 errichtet worden, aber die Grenze war damals noch präsent. Aber sehr gefährlich erscheint er nicht, er hat nämlich keine Zunge.
Aber noch etwas anderes ist markant für das sogenannte innere Salzkammergut. Nirgendwo in Oberösterreich ist der Anteil der Protestanten höher als in den Ortschaften Gosau, Hallstatt und Obertraun. Auch zahlreiche Namen von Bergen wie Predigtstuhl oder Feuerkogel haben mit dem Protestantismus zu tun. Noch heute wacht das Kloster Traunkirchen, das 1622 an die Jesuiten übergeben wurde, über den Zugang zum inneren Salzkammergut. Und in früheren Jahrhunderten natürlich auch über den rechten Glauben. Aber es nutze wenig. Immerhin sind in Oberösterreich neun Toleranzgemeinden nach dem Toleranzpatent von 1781 entstanden, nur in Kärnten waren es noch mehr. So sieht man, wie Geschichte jahrhundertelang nachwirkt bis in unsere heutige Zeit.
c_1
1 Das innere Salzkammergut – eine Begriffsbestimmung
2 Der Augsburger Religionsfrieden und der Westfälischen Frieden
3 Die Gegenreformation in Oberösterreich
4 Die Gegenreformation im Salzkammergut
5 Der Geheimprotestantismus
6 Conclusio
7 Bibliographie: Die Protestanten in Oberösterreich und im Salzkammergut
1 Das innere Salzkammergut – eine Begriffsbestimmung
Das Salzkammergut war ein besonderer Teil des Habsburgerreiches, der wirtschaftlich sehr bedeutend durch den Salzabbau war. Es war nicht Teil des Landes ob der Enns, sondern unterstand direkt den Erzherzögen von Österreich. Der Begriff Salzkammergut von heute ist aber ein touristischer Begriff, der mit den historischen Dimensionen nur wenig zu tun hat.
Die Verwaltung des Kammergutes war in Gmunden, also außerhalb. Noch heute steht ein Löwe an der alten Bundesstraße bei Traun-kirchen, der die Grenze des alten Salzkammergutes markiert. Er ist zwar erst 1861 errichtet worden, aber die Grenze war damals noch präsent. Aber sehr gefährlich erscheint er nicht, er hat nämlich keine Zunge.

https://www.nachrichten.at/storage/med/download/260569_HOAMAT_Salzkammergut_NEU.pdf
Aber noch etwas anderes ist markant für das sogenannte innere Salzkammergut. Nirgendwo in Oberösterreich ist der Anteil der Protestanten höher als in den Ortschaften Gosau, Hallstatt und Obertraun. Auch zahlreiche Namen von Bergen wie Predigtstuhl oder Feuerkogel haben mit dem Protestantismus zu tun. Noch heute wacht das Kloster Traunkirchen, das 1622 an die Jesuiten übergeben wurde, über den Zugang zum inneren Salzkammergut. Und in früheren Jahrhunderten natürlich auch über den rechten Glauben. Aber es nutze wenig. Immerhin sind in Oberösterreich neun Toleranzgemeinden nach dem Toleranzpatent von 1781 entstanden, nur in Kärnten waren es noch mehr. So sieht man, wie Geschichte jahrhundertelang nachwirkt bis in unsere heutige Zeit.
2 Der Augsburger Religionsfrieden und der Westfälischen Frieden
Der Augsburger Religionsfrieden brachte das Ende der religiösen Einheit des HRR. Der Friede bescherte den Ständen des Reiches die Religionsfreiheit in Form der Wahlmöglichkeit zwischen der protestantischen und der katholischen Konfession, nicht aber den Untertanen. Auch wurde die Konfession der Calvinisten oder der Täufer völlig ausgelassen. Das wurde später als „Cuius regio, eius religio“ bezeicnet. Man kann es auch als Sieg der Territorialherrn über das Reich in der Verfassungsgeschichte sehen. Den Untertanen wurde das Recht zum Abzug zugestanden. Die Protestanten konnten die Forderung nach freier Konfessionswahl durch die Untertanen nicht durchsetzen.[1] Das Ganze war auch insofern ein bedeutender Schritt, da für die Gleichstellung der beiden Konfessionen die geistliche Jurisdiktion der Bischöfe aufgehoben werden musste. Trotz alledem blieben viele Fragen ungelöst, theologische sowieso, aber auch genügend weltliche juristische Probleme. Diese führten auch zum Dreißigjährigen Krieg.
Der Abschluss des Westfälischen Friedens fand keine Zustimmung des Papstes Innozenz X., da weltliche Mächte in den Bereich der geistlichen Gewalt eingriffen. Darauf wird sich auch Erzbischof Firmian von Salzburg mit der Ausweisung der Protestanten beziehen. Der päpstliche Protest hatte allerdings keine Wirkung. Der Staat war nicht mehr für die Religion da und der Papst hatte somit kein Recht sich in Fragen der Verfassung aus dogmatischen Gründen einzumischen.[2] Es waren mit dem Westfälischen Frieden drei Religionen im HRR zugelassen. Katholiken, Lutheraner und Calvinisten waren auf eine Stufe gestellt. Als Grundlage nahm man den 1. Jänner 1624 für den Besitzstand der Konfessionen. Der Zustand zu diesem Zeitpunkt sollte in Zukunft beibehalten werden. In Fragen des Bekenntnisses wurde Gewaltanwendung ausgeschlossen und verboten. Bekenntnisfragen durch Stimmenmehrheit zu entscheiden. Den Untertanen andersgläubiger Landesherren wurde das Recht auf freie Hausandacht oder im äußersten Falle auf Auswanderung nach genügender Frist zugestanden.
Nur die habsburgischen Erbländer – dazu gehört das Land ob der Enns - wurden von diesen Bestimmungen ausgeschlossen. Andere Landesherrn verfolgten eher eine Politik religiöser Privilegierung, vorwiegend aus dem Grund der Förderung des Gewerbes und der landesfürstlichen Macht. Das Paradebeispiel ist Brandenburg, aber auch andere Landesherrn agierten ähnlich.[3]
3 Die Gegenreformation in Oberösterreich
Nach dem Augsburger Religionsfrieden gab es in Österreich Strömungen, die einen Ausgleich zwischen Katholiken und Lutheranern suchten. Allen voran ist Kaiser Maximilian II (1527 – 1576) zu nennen. In dessen Zeit erreichte der Protestantismus in Oberösterreich seinen Höhepunkt.[4] Sicherlich kann man sagen, dass er ein auf die Wahrung des Augsburger Religionsfrieden bedachter Herrscher war, der eher dem Humanismus zugeneigt war, aber aus familiären Gründen Katholik blieb. Immerhin hatte Maximilian II beiden adeligen Ständen in Niederösterreich 1568 die Religionskonzession gewährt und den Ständen ob der Enns die Gleichbehandlung zugesichert.[5] Sicherlich war es auch ein Grund, dass die protestantischen Stände auch die Steuern genehmigen sollten und Kriege gegen die Türken eben teuer waren.
Bei Amtsantritt Rudolf II 1576 war die katholische Kirche im Land ob der Enns auf einen Tiefpunkt gewesen. Einzelne Klöster waren verwaist, der Klerus sittlich, wirtschaftlich und religiös herabgesunken.[6] Daher setzte die Reform zunächst beim Klerus selber an. Die Beschlüsse des Konzils von Trient sollten umgesetzt werden. Der Grund für die einsetzende Gegenreformation war sicherlich der zweite Bauernaufstand in Oberösterreich (1594-1597).
Rudolf II setzte nur noch katholische Pfarrer ein, was von vielen auf dem Lande nicht goutiert wurde. Bauern verjagten katholische Pfarrer und bedrohten sie mit dem Tode, sodass diese flohen.[7] Die Religion war sicherlich nicht der einzige Grund. Rudolf II hatte eine Kriegssteuer eingeführt und die Forderungen der Grundherrschaft waren auch nicht gering. 1597 erließ Rudolf II eine Resolution, in der die Abschaffung der Prädikanten (evangelische Prediger) und die Wiedereinsetzung der katholischen Pfarrer angeordnet wurde, die durch die Reformation verloren gegangen waren. [8] So wurde nach und nach jede einzelne Stadt in Oberösterreich unter Druck gesetzt. 1600 wurden angesehene Stadtbürger von Linz eingekerkert, wobei eine Person in Folge der Anstrengungen auch starb. Die Jesuiten wurden 1599 in die Stadt berufen und bereiteten so die Abberufung der ständischen Prediger und Schulmeister vor.[9]
Beeinflusst wurde diese Zeit auch massiv durch die psychischen Probleme Rudolf II, die in späterer Lebensphase auftraten. Es kam auch zu einem Streit innerhalb des Herrscherhauses zwischen Kaiser Rudolf II und Erzherzog Matthias. Die protestantischen Stände unterstützten Erzherzog Matthias, da sie sich von ihm mehr erwarteten. Kaiser Rudolf II – vermutlich wirklich krankheitsbedingt regierungsunfähig – verband sich mit den protestantischen
böhmischen Ständen in Prag, weil Erzherzog Matthias ihn zum Rücktritt zwingen wollte. Der Kaiser machte vor allem große religiöse Zugeständnisse den Adeligen in Böhmen und Schlesien im Majestätsbrief von 1609.[10] Erzherzog Matthias übernahm mit dem Vertrag von Lieben 1608 die Macht in Ungarn, Mähren und Österreich ob und unter der Enns. Letztlich war Kaiser Rudolf II nur noch ein Kaiser ohne Land, seine Brüder hatten die Macht in den Landesteilen übernommen. Der Bruderzwist fand mit dem Tod des Kaisers Rudolf II 1612 ein Ende. Sein Nachfolger und Bruder Kaiser Matthias stand stark unter dem Einfluss des Wiener Bischofs Klesl, der bei den Protestanten besonders verhasst war. Schon 1619 starb Kaiser Matthias kinderlos. Nachfolger wurde der streng katholische Ferdinand II, dem die Gegenreformation äußerst wichtig war. Die oberösterreichischen Stände verweigerten ihm aber die Huldigung, weil sie ohne ihre Mitwirkung zustande gekommen war. Ferdinand II war Anhänger des Absolutismus und ihm waren die Stände sowie so ein Dorn im Auge. [11] Die protestantischen Stände zogen die Macht an sich und verhandelten auch mit benachbarten protestantischen Fürsten. Der Konflikt verstärkte sich durch die Absetzung König Ferdinands durch die böhmischen Stände. Ferdinand II fand einen Verbündeten Maximilian I von Bayern, dem er die Verpfändung österreichische Gebiete versprach. 1620 schlugen bayrische Truppen den Aufstand in Oberösterreich nieder. Das Land blieb bis 1628 in bayrischer Verwaltung. Die Macht der Stände wurde dadurch gebrochen und der katholische Absolutismus setzte sich durch. Zahlreiche Klostergründungen wurden durchgeführt, so auch in Traunkirchen, wo die Jesuiten Einzug hielten. Es kam zur Ausweisung aller protestantischer Prediger und Schulmeister aus dem Land. Bis Ostern 1626 sollten alle Untertanen in Oberösterreich zum katholischen Glauben übergetreten sein. Die Gegenreformation zeigte, obwohl Zwang und Gewalt ausgeübt wurde, - man denke nur an das Frankenburger Würfelspiel -nur mäßigen Erfolg, löste allerdings den großen Bauernkrieg von 1626 aus. Ferdinand II sah vor allem im Protestantismus die Ursache der Unruhen und nicht in den sozialen Fragen. Kaiser Ferdinand II ordnete an, dass alle Bewohner der Städte binnen eines Monats katholisch werden müssen oder auswandern. Das ging auf den Augsburger Religionsfrieden zurück, wo das Recht auf Auswanderung festgeschrieben ist. Dabei waren allerdings zehn Prozent des Vermögens als Abgabe zu entrichten. Ein Teil des Adels konvertierte, aber viele Bauern wanderten in fränkische und schwäbische Gebiete (Ulm) aus.[12] Während des Dreißigjährigen Krieges blieb die Welle der Abwanderung konstant, nach dem Ende ging die Regierung daran, die Reste völlig zu beseitigen. Die Abwanderung aus Oberösterreich war stark, aus dem Mühlviertel wanderten praktisch alle Protestanten ab, aus dem restlichen Gebiet gab es auch welche, die zu bleiben versuchten. [13] Die Abwanderung nach Franken war auch dadurch begründet, dass Protestanten schon früher nach Nürnberg oder Regensburg wegen einer Hochzeit oder eines Abendmahls gereist waren. Außerdem konnten sie in Franken Grund erwerben. Gerade Franken hatte einen hohen Blutzoll im Dreißigjährigen Krieg.

Gustav REINGRABNER, Protestanten in Österreich. Geschichte und Dokumentation, Wien / Köln / Graz 1981, 145.
Dieses Bild zeigt die Siedlungsgebiete der ausgewanderten Protestanten in Franken. Der Sieg des katholischen Absolutismus bewirkte auch eine Kontrolle der Bevölkerung durch den Staat und die Pfarrer. Die Verfolgung ging auch unter Karl VI und Maria Theresia weiter. Der Protestantismus war nie ganz ausgerottet, er ging nur in den Untergrund.
- Quote paper
- Dietmar Schneidergruber (Author), 2020, Protestanten in Oberösterreich und im Salzkammergut, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1590628