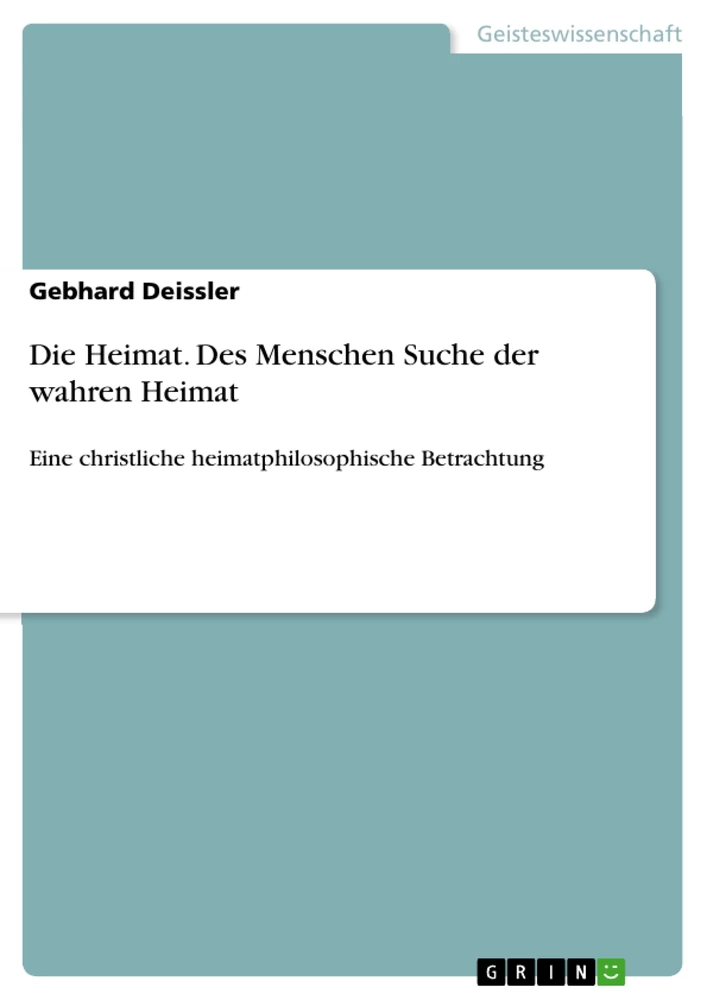Diese Reflektion über die Heimat thematisiert die mehr oder weniger bewußte Suche zahlreicher Menschen nach einer äußeren, wie auch einer inneren Heimat. Eine wichtige Erkenntnis ist, daß wir eigentlich keine Heimat haben, sondern daß wir sie vielmehr selbst
sind, so sehr sind wir mit ihr verwoben, sowohl mit der materiellen, als auch der kulturellen und der geistigen. Eine Heimat haben, einen Namen haben und „Macht“ in Bezug auf die Einflußnahme auf die Umwelt haben sind als die drei Säulen des Glücks des Menschen bezeichnet worden.
Im Zeitalter der Globalisierung und vielfältiger Einflüsse, die die überkommenen Selbstverständlichkeiten in Bezug auf unsere körperlich-geistige Heimat, ja selbst unsere wahre Identität in Frage stellen, ist es erforderlich, den für das Wohlergehen des Menschen bedeutsamen Heimatbegriff neu zu überdenken und auf diesem Wege eine Sensibilisierung für ein Heimatbewußtsein einzuleiten, das uns verankern kann, um in dem Kreuzfeuer der heutigen Vielfalt der innerlichen und äußerlichen Herausforderungen besser bestehen zu
können und unsere Gestaltungsmacht in Bezug auf die Realisierung unserer Identität sowie auf die Umwelt Welt in vollem Umfang wahrzunehmen.
Über ein erweitertes und vertieftes Verständnis des Heimatbegriffs wird erforscht, wie die Integration verschiedener Heimaten unter christlichem Blickwinkel in die Realität umgesetzt werden kann. Interkulturelle Forschung und christliche Tradition können den Weg in die planetare Heimat des dritte Jahrtausends weisen, in der die Berufung des Menschen zu Würde und Wesen seiner individuellen Persönlichkeit gewahrt bleibt.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Der globale Wanderer
- Kapitel 2: Wie entsteht Heimat?
- Kapitel 3: Wie schafft man Heimat?
- Kapitel 4: Heimat und Weg
- Kapitel 5: Heimat und Ziel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Werk befasst sich mit der Suche des Menschen nach einer äußeren und inneren Heimat in einer Welt, die von Globalisierung und vielfältigen Einflüssen geprägt ist. Es wird argumentiert, dass wir keine Heimat haben, sondern vielmehr selbst Heimat sind. Der Text beleuchtet die Bedeutung des Heimatbegriffs für das menschliche Wohlergehen und die Herausforderungen, die aus der Globalisierung entstehen.
- Das Wesen und die Bedeutung von Heimat
- Die Herausforderungen der Globalisierung für das Heimatverständnis
- Die Rolle der kulturellen und geistigen Dimensionen von Heimat
- Die Integration verschiedener Heimaten unter christlichem Blickwinkel
- Die Bedeutung von Heimat für die individuelle und gesellschaftliche Identität
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Der globale Wanderer: Dieses Kapitel beleuchtet die Erfahrungen des Menschen als „globaler Wanderer“ in einer zunehmend vernetzten Welt und die Auswirkungen auf sein Heimatverständnis.
- Kapitel 2: Wie entsteht Heimat?: Hier werden die Faktoren untersucht, die zur Entstehung von Heimat beitragen, und die Bedeutung von kulturellen, sozialen und persönlichen Einflüssen wird hervorgehoben.
- Kapitel 3: Wie schafft man Heimat?: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Möglichkeiten und Herausforderungen der Gestaltung von Heimat, sowohl auf individueller als auch gesellschaftlicher Ebene.
- Kapitel 4: Heimat und Weg: Dieses Kapitel untersucht die Beziehung zwischen Heimat und dem Weg des Menschen, insbesondere im Kontext der Globalisierung und der vielfältigen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.
Schlüsselwörter
Heimat, Globalisierung, Identität, Kultur, Spiritualität, christlicher Blickwinkel, Integration, Interkulturelle Forschung, Planete Heimat, individuelles Wohlbefinden, Gestaltungsmacht, Selbstverständnis, Tradition, dritte Jahrtausend.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage zum Begriff „Heimat“ in diesem Text?
Die zentrale Erkenntnis ist, dass wir Heimat nicht nur „haben“, sondern selbst Heimat „sind“, da wir untrennbar mit materiellen, kulturellen und geistigen Dimensionen verwoben sind.
Welche drei Säulen werden als Grundlage für das menschliche Glück genannt?
Das Glück des Menschen basiert laut Text auf drei Säulen: eine Heimat haben, einen Namen haben und „Macht“ (Einflussnahme) in Bezug auf die Umwelt besitzen.
Wie beeinflusst die Globalisierung das Heimatbewusstsein?
Die Globalisierung stellt überkommene Selbstverständlichkeiten und die wahre Identität in Frage, weshalb ein vertieftes Heimatbewusstsein als Anker für die heutigen Herausforderungen nötig ist.
Welche Rolle spielt der christliche Blickwinkel in der Arbeit?
Es wird erforscht, wie verschiedene „Heimaten“ unter christlichem Blickwinkel integriert werden können, um die Würde der individuellen Persönlichkeit zu wahren.
Was versteht der Autor unter der „planetaren Heimat“?
Damit ist ein erweitertes Verständnis von Heimat im dritten Jahrtausend gemeint, das interkulturelle Forschung und Tradition verbindet.
- Citar trabajo
- D.E.A./UNIV. PARIS I Gebhard Deissler (Autor), 2010, Die Heimat. Des Menschen Suche der wahren Heimat, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159080