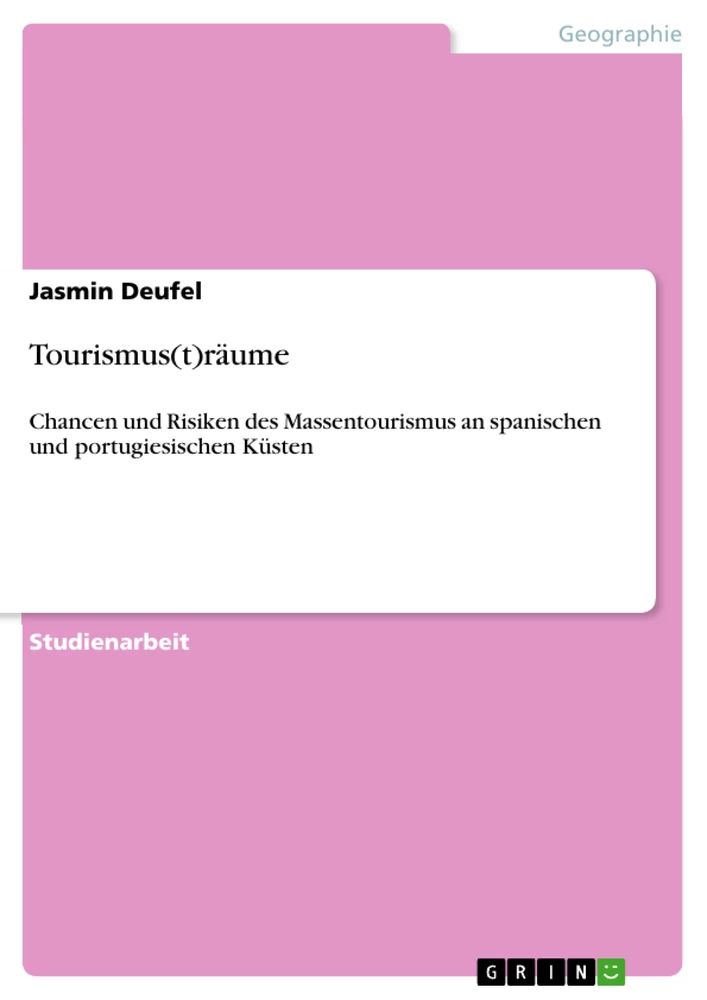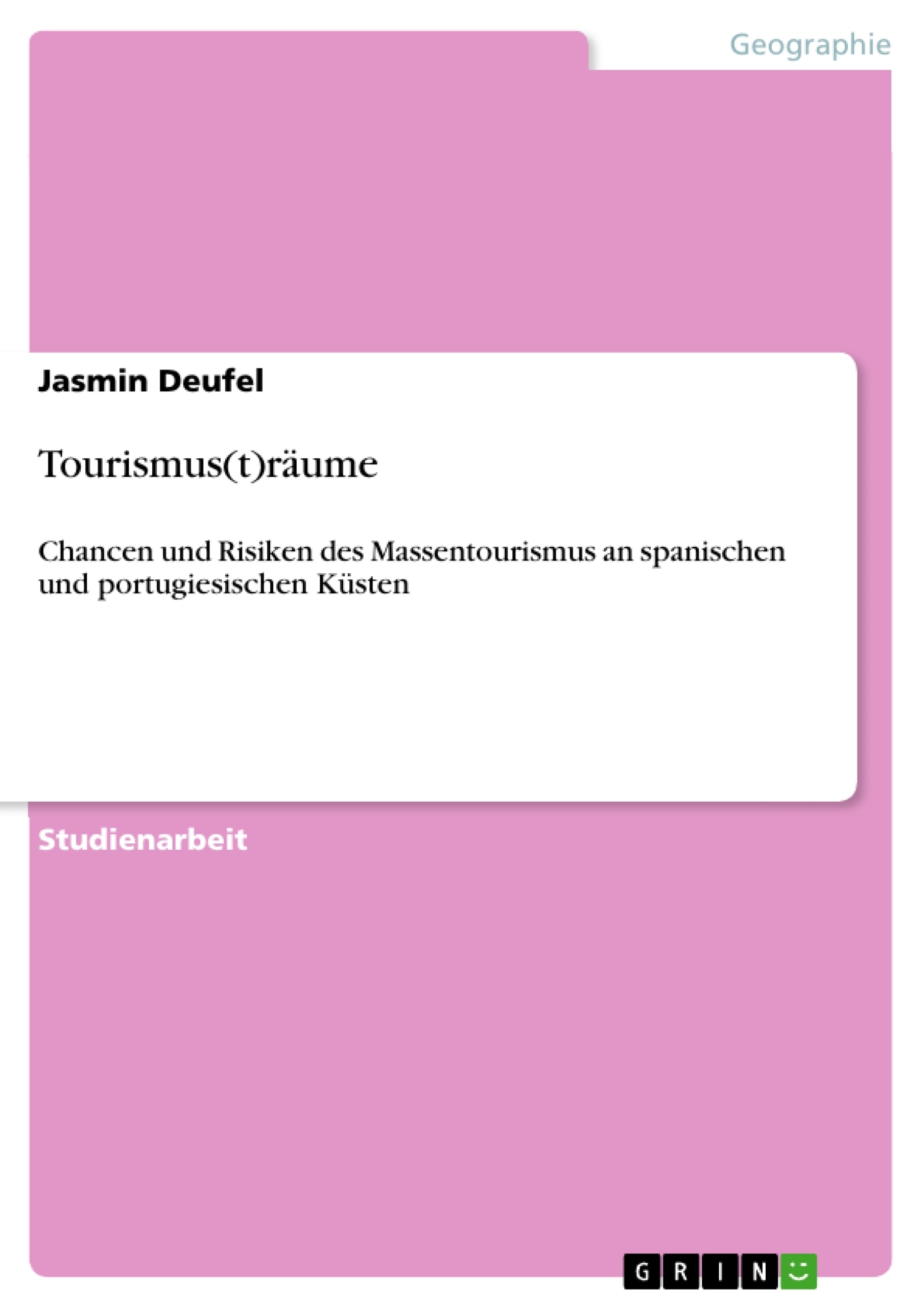Tourismusträume. Einströmende Touristenmassen, die Geld ins Land bringen, steigenden Wohlstand und Arbeit fördern, sich mit dem zufrieden geben, was für die Einheimischen ganz alltäglich ist – Sol y playa. Solange die positiven Aspekte des Massentourismus überwiegen, wird nicht an eine nachhaltige Entwicklung gedacht – ohne Rücksicht auf Verluste. Was hier ein wenig überspitzt dargestellt wird, ging solange gut, bis der gesellschaftliche Wandel und somit die veränderten Wertevorstellungen sich auf das Reiseverhalten ausübten. Es wird weiterhin zahlreiche Touristen geben, die mit den Pauschalreisen ihre Bedürfnisse gestillt sehen, aber es existieren immer mehr Reisende, die ihren Urlaub nach ihren persönlichen Vorlieben gestalten möchten.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dem Massentourismus in Spanien. Portugals Entwicklung zur Tourismusdestination begann erst einige Jahre später und ist dazu nicht so sehr ausgeprägt wie in Spanien. Zuerst wird auf die Entwicklung des Massentourismus in den beiden Ländern mit Hilfe des Lebenszyklusmodells von Fremdenverkehrsorten nach Richard W. Butler eingegangen. Anschließend werden die Risiken und Chancen erörtert und mit einem kurzen Ausblick auf die zukünftigen Entwicklungen abgerundet.
Tourismusträume – nachhaltiger Tourismus mit Vorteilen sowohl für die einheimische Bevölkerung und deren Umwelt, sowie für die Touristen durch ein besonderes Urlaubserlebnis – können wahr werden, aber nur durch eine Neuorientierung der Tourismusräume.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was versteht man unter Massentourismus?
- Historische Entwicklung des Massentourismus an Spaniens und Portugals Küsten anhand des Lebenszyklusmodells von Fremdenverkehrsorten nach Butler
- Spanien
- Portugal
- Risiken und Probleme des Massentourismus in Spanien und Portugal
- Unkontrollierter Bauboom
- Umweltverschmutzung
- Wassermangel
- Sozioökonomische Nachteile und Probleme
- Konjunkturelle und saisonale Schwankungen
- Konkurrenz
- Angebotsstruktur
- Chancen des Massentourismus
- Reduzierung der Saisongebundenheit
- Wirtschaftliche Vorteile
- Diversifizierung und Segmentierung des Angebotes
- Verbesserung der Qualität des Angebotes und der Dienstleistungen
- Zusammenfassung und Ausblick auf künftige Entwicklungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Massentourismus an den Küsten Spaniens und Portugals. Ziel ist es, die historische Entwicklung, die damit verbundenen Risiken und Chancen sowie mögliche zukünftige Entwicklungen zu analysieren. Der Fokus liegt dabei auf Spanien, da dessen touristische Entwicklung ausgeprägter ist als die Portugals.
- Historische Entwicklung des Massentourismus anhand des Lebenszyklusmodells nach Butler
- Risiken des Massentourismus (Umweltbelastung, sozioökonomische Probleme)
- Chancen des Massentourismus (wirtschaftliche Vorteile, Diversifizierung)
- Nachhaltigkeit im Tourismus
- Zukünftige Entwicklungen des Tourismus in Spanien und Portugal
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert die ambivalenten Auswirkungen des Massentourismus: positive Aspekte wie Wohlstandsgewinn stehen im Gegensatz zu den negativen Folgen für Umwelt und lokale Kulturen. Der gesellschaftliche Wandel und veränderte Wertevorstellungen beeinflussen das Reiseverhalten zunehmend. Die Arbeit konzentriert sich auf den Massentourismus in Spanien, mit einem Vergleich zu Portugal. Das Lebenszyklusmodell nach Butler dient als analytisches Werkzeug, gefolgt von einer Erörterung von Risiken und Chancen sowie einem Ausblick.
2. Was versteht man unter Massentourismus?: Dieses Kapitel definiert Massentourismus als organisierte, preisgünstige Reisen, die eine große Anzahl von Touristen an stark entwickelte Orte führen. Es beschreibt die typischen Assoziationen mit Massentourismus wie überfüllte Strände und Verdrängung lokaler Kulturen.
3. Historische Entwicklung des Massentourismus an Spaniens und Portugals Küsten anhand des Lebenszyklusmodells von Fremdenverkehrsorten nach Butler: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des Massentourismus in Spanien und Portugal mithilfe des Lebenszyklusmodells von Butler. Für Spanien werden die Phasen der Erkundung (18. bis Ende 19. Jahrhundert), Erschließung (ab 1880), und die Unterbrechung durch den Bürgerkrieg dargestellt. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Tourismus in Spanien, wobei die Entwicklung in Portugal nur kurz erwähnt wird. Die Darstellung anhand des Modells verdeutlicht die verschiedenen Phasen der touristischen Entwicklung.
4. Risiken und Probleme des Massentourismus in Spanien und Portugal: Dieses Kapitel beleuchtet die negativen Auswirkungen des Massentourismus, darunter unkontrollierter Bauboom, Umweltverschmutzung, Wassermangel, sozioökonomische Probleme, saisonale Schwankungen, Konkurrenz und eine unausgewogene Angebotsstruktur. Es werden konkrete Beispiele und die damit verbundenen Herausforderungen für die Regionen diskutiert.
5. Chancen des Massentourismus: Im Gegensatz zum vorherigen Kapitel werden hier die positiven Aspekte des Massentourismus erörtert. Dazu gehören die Reduzierung der Saisonabhängigkeit, wirtschaftliche Vorteile, die Möglichkeit der Diversifizierung und Segmentierung des Angebots, und die Verbesserung der Qualität von Angebot und Dienstleistungen. Es wird aufgezeigt, wie diese Chancen genutzt werden können, um eine nachhaltigere Entwicklung zu fördern.
Schlüsselwörter
Massentourismus, Spanien, Portugal, Lebenszyklusmodell Butler, Nachhaltigkeit, Risiken, Chancen, Umweltbelastung, sozioökonomische Folgen, Tourismusentwicklung, Saisonabhängigkeit, regionale Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Massentourismus an den Küsten Spaniens und Portugals
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Massentourismus an den Küsten Spaniens und Portugals. Sie untersucht die historische Entwicklung, die damit verbundenen Risiken und Chancen sowie mögliche zukünftige Entwicklungen. Der Schwerpunkt liegt auf Spanien aufgrund seiner ausgeprägteren touristischen Entwicklung im Vergleich zu Portugal.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet das Lebenszyklusmodell von Butler zur Analyse der historischen Entwicklung des Massentourismus in Spanien und Portugal. Dieses Modell dient als analytisches Werkzeug zur Veranschaulichung der verschiedenen Phasen der touristischen Entwicklung.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen im Detail: die historische Entwicklung des Massentourismus anhand des Lebenszyklusmodells nach Butler; die Risiken des Massentourismus (Umweltbelastung, sozioökonomische Probleme); die Chancen des Massentourismus (wirtschaftliche Vorteile, Diversifizierung); Nachhaltigkeit im Tourismus; und zukünftige Entwicklungen des Tourismus in Spanien und Portugal.
Wie wird der Massentourismus definiert?
Massentourismus wird definiert als organisierte, preisgünstige Reisen, die eine große Anzahl von Touristen an stark entwickelte Orte führen. Typische Assoziationen sind überfüllte Strände und die Verdrängung lokaler Kulturen.
Welche Risiken des Massentourismus werden diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet negative Auswirkungen wie unkontrollierten Bauboom, Umweltverschmutzung, Wassermangel, sozioökonomische Probleme, saisonale Schwankungen, Konkurrenz und eine unausgewogene Angebotsstruktur. Konkrete Beispiele und Herausforderungen für die Regionen werden diskutiert.
Welche Chancen bietet der Massentourismus?
Die Arbeit erörtert positive Aspekte wie die Reduzierung der Saisonabhängigkeit, wirtschaftliche Vorteile, die Möglichkeit der Diversifizierung und Segmentierung des Angebots sowie die Verbesserung der Qualität von Angebot und Dienstleistungen. Es wird aufgezeigt, wie diese Chancen für eine nachhaltigere Entwicklung genutzt werden können.
Wie wird die historische Entwicklung des Massentourismus dargestellt?
Die historische Entwicklung wird anhand des Lebenszyklusmodells von Butler dargestellt. Für Spanien werden die Phasen der Erkundung (18. bis Ende 19. Jahrhundert), Erschließung (ab 1880) und die Unterbrechung durch den Bürgerkrieg beschrieben. Die Entwicklung in Portugal wird nur kurz erwähnt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Massentourismus, Spanien, Portugal, Lebenszyklusmodell Butler, Nachhaltigkeit, Risiken, Chancen, Umweltbelastung, sozioökonomische Folgen, Tourismusentwicklung, Saisonabhängigkeit, regionale Entwicklung.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung jedes Kapitels: Einleitung, Definition von Massentourismus, historische Entwicklung anhand des Butler-Modells, Risiken und Probleme des Massentourismus, Chancen des Massentourismus und schließlich eine Zusammenfassung und einen Ausblick.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die historische Entwicklung des Massentourismus an den Küsten Spaniens und Portugals zu untersuchen und die damit verbundenen Risiken und Chancen sowie mögliche zukünftige Entwicklungen zu analysieren.
- Quote paper
- Jasmin Deufel (Author), 2010, Tourismus(t)räume , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159168