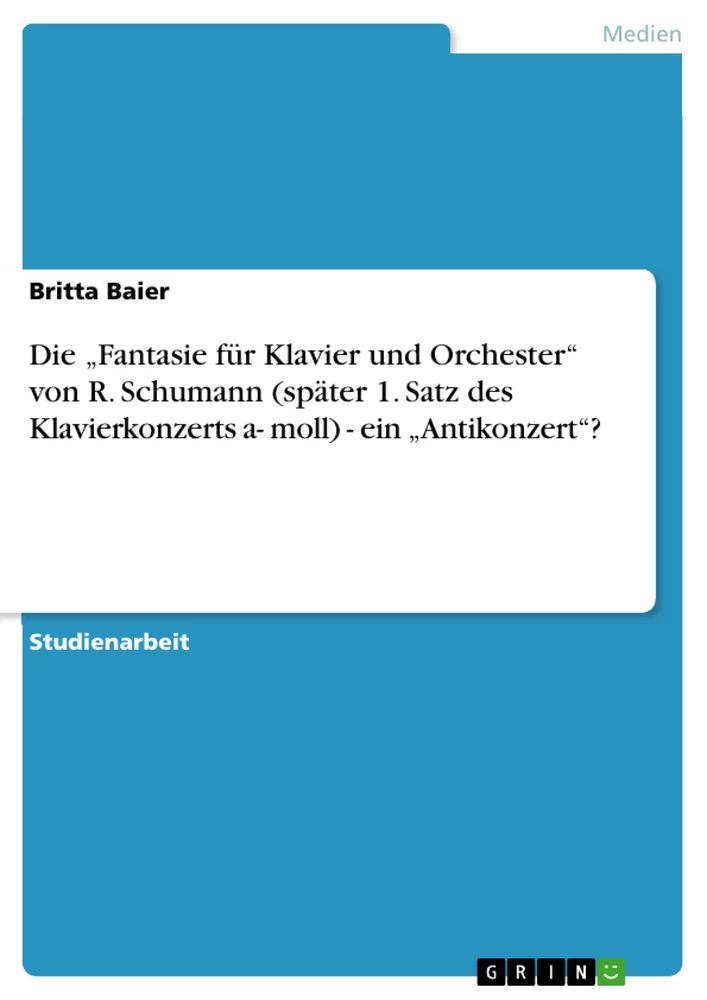Der Dualismus zieht sich als Kerngedanke in musikalischen Werken über Jahrhunderte durch die Musikgeschichte. Vor allem seit die Sonatenform ab der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts als Standartform für das Konzert galt, wurde der „Wettstreit“ (ital. „Concerto“) zwischen Solo und Orchesterpart sowie zwischen den auftretenden Themen die Antriebskraft der meisten Kompositionen bis ins frühe 19. Jahrhundert. Doch in dieser Zeit beginnt sich speziell in der Klaviermusik etwas Grundsätzliches an dieser Dominanz des Themendualismus zu verändern. August Gerstmeier weist in diesem Zusammenhang zu Beginn seiner Monographie über Schumanns Klavierkonzert op. 54 auf eine verwunderliche Statistik hin: die vier Komponisten Schumann, Chopin, Liszt und Schubert, die alle die „Führungsrolle der Klaviermusik“ zu Beginn des 19. Jahrhunderts mitbegründeten, schrieben äußerst wenige sinfonische Werke für ,ihr‘ Instrument. Schumann vollendete außer dem Klavierkonzert op. 54 noch zwei weitere Klavierwerke mit Orchester, Chopin und Liszt schufen jeweils zwei Klavierkonzerte, Schubert kein einziges. Dass diese Komponisten in viel geringerem Maße Klavierkonzerte komponierten als ihre Vorgänger, die Vertreter der Wiener Klassik, es getan hatten, lässt darauf schließen, dass sie die konventionelle Form des Konzertes als nicht mehr angemessen für ihre musikalische Intension ansahen. Gerstmeier nennt als Gründe für diese Tendenz zum einen die Entwicklung des Klaviers, und zum anderen das romantische Ideal in der Musik, welche beide eine neue Auseinandersetzung mit dem klassischen Sonatensatz forderten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung: Entwicklung der Klaviermusik im 19. Jahrhundert
- II. Hauptteil
- 2.1. Entstehungsgeschichte des Werkes
- 2.2. Analyse des ersten Satzes im Klavierkonzert
- 2.3. Vergleich des ersten und dritten Satzes
- 2.3.1. Formaler Aufbau
- 2.3.2. Zusammenspiel von Orchester und Soloinstrument
- 2.3.3. Faktur des Klaviersatzes
- 2.3.4. Allgemeiner Charakter der Sätze
- III. Fazit und persönliche Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Sonatenform im Werk Robert Schumanns, insbesondere im Kontext seines Klavierkonzerts a-moll op. 54. Die Zielsetzung besteht darin, die Entstehungsgeschichte des Werkes zu beleuchten, den ersten Satz detailliert zu analysieren und diesen mit dem dritten Satz zu vergleichen, um Schumanns innovative Herangehensweise an die traditionelle Konzertform zu verstehen.
- Entwicklung der Klaviermusik im 19. Jahrhundert und der Wandel der Sonatenform
- Entstehungsgeschichte und kompositorische Entwicklung von Schumanns Klavierkonzert a-moll
- Analyse des ersten Satzes des Klavierkonzerts und dessen Besonderheiten
- Vergleich des ersten und dritten Satzes hinsichtlich Aufbau, Instrumentierung und Charakter
- Schumanns neue Interpretation des romantischen Klavierkonzerts als „Antikonzert“
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Entwicklung der Klaviermusik im 19. Jahrhundert: Die Einleitung beleuchtet den Wandel in der Klaviermusik des 19. Jahrhunderts. Sie beschreibt den traditionellen Themendualismus im Konzert, der durch die Entwicklung des Klaviers und das romantische Ideal der Verbindung und des Allumfassenden in Frage gestellt wurde. Komponisten wie Schumann, Chopin und Liszt bevorzugten weniger die konventionelle Konzertform, da diese ihren musikalischen Intentionen nicht mehr angemessen erschien. Schumanns Aussage über die Unabhängigkeit des Klaviers und die Notwendigkeit einer neuen Verbindung mit dem Orchester verdeutlicht dieses Anliegen. Die Einleitung führt somit zum Verständnis der Problemstellung und zum Kontext von Schumanns innovativem Ansatz in seinem Klavierkonzert.
2.1. Entstehungsgeschichte des Werkes: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung von Schumanns Klavierkonzert a-moll, das aus einer ursprünglich eigenständigen „Fantasie für Klavier und Orchester“ hervorging. Die eruptive Kompositionsweise Schumanns, dokumentiert in seinem Haushaltsbuch, wird hervorgehoben. Die schnelle Entstehung des Werks und die verschiedenen Titel, die Schumann dem Werk gab, zeigen seine spontane und dynamische Arbeitsweise. Das Kapitel beleuchtet auch den Grund für die spätere Ergänzung der Fantasie zu einem vollständigen Konzert, unter anderem aus merkantilen Erwägungen, sowie Claras Schumanns Kritik an der ursprünglichen „Fantasie“ und ihre Freude über die Vervollständigung zum Konzert. Die Uraufführung und der Druck des Werkes werden ebenfalls erwähnt.
Schlüsselwörter
Robert Schumann, Klavierkonzert a-moll op. 54, Sonatenform, Romantische Musik, Klaviermusik, Orchester, „Antikonzert“, Liedperiodik, Themendualismus, Kompositionstechnik, Instrumentierung, Formgeschichte
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse von Robert Schumanns Klavierkonzert a-moll op. 54
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Robert Schumanns Klavierkonzert a-moll op. 54, fokussiert auf die Sonatenform und Schumanns innovative Herangehensweise an die traditionelle Konzertform. Die Analyse umfasst die Entstehungsgeschichte, detaillierte Betrachtung des ersten Satzes und einen Vergleich mit dem dritten Satz.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Entwicklung der Klaviermusik im 19. Jahrhundert und den Wandel der Sonatenform; die Entstehungsgeschichte und kompositorische Entwicklung von Schumanns Klavierkonzert a-moll; eine detaillierte Analyse des ersten Satzes und dessen Besonderheiten; einen Vergleich des ersten und dritten Satzes hinsichtlich Aufbau, Instrumentierung und Charakter; und Schumanns neue Interpretation des romantischen Klavierkonzerts als „Antikonzert“.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in Einleitung, Hauptteil und Fazit gegliedert. Der Hauptteil analysiert die Entstehungsgeschichte des Werkes, den ersten Satz detailliert und vergleicht ihn mit dem dritten Satz unter verschiedenen Aspekten (formaler Aufbau, Zusammenspiel von Orchester und Soloinstrument, Klaviersatz, allgemeiner Charakter). Die Einleitung beleuchtet den Kontext der Entwicklung der Klaviermusik im 19. Jahrhundert. Das Dokument enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung beschreibt den Wandel in der Klaviermusik des 19. Jahrhunderts, den traditionellen Themendualismus im Konzert und dessen Infragestellung durch die Entwicklung des Klaviers und das romantische Ideal. Sie zeigt, warum Komponisten wie Schumann von der konventionellen Konzertform abwichen und Schumanns Ansatz zur neuen Verbindung von Klavier und Orchester erläutert wird.
Was beinhaltet die Analyse der Entstehungsgeschichte?
Die Entstehungsgeschichte beschreibt die Entwicklung des Klavierkonzerts aus einer „Fantasie für Klavier und Orchester“, Schumanns eruptive Kompositionsweise, die schnelle Entstehung des Werks, verschiedene Titel, die Schumann dem Werk gab, Claras Schumanns Kritik und die spätere Ergänzung zur vollständigen Konzertfassung, die Uraufführung und den Druck des Werkes.
Wie werden der erste und dritte Satz verglichen?
Der Vergleich des ersten und dritten Satzes umfasst den formalen Aufbau, das Zusammenspiel von Orchester und Soloinstrument, die Faktur des Klaviersatzes und den allgemeinen Charakter der Sätze. Dieser Vergleich dient dazu, Schumanns innovative Herangehensweise an die traditionelle Konzertform zu verdeutlichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Robert Schumann, Klavierkonzert a-moll op. 54, Sonatenform, Romantische Musik, Klaviermusik, Orchester, „Antikonzert“, Liedperiodik, Themendualismus, Kompositionstechnik, Instrumentierung, Formgeschichte.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument ist für akademische Zwecke gedacht, zur Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise. Es dient der Untersuchung der Sonatenform in Schumanns Werk und seinem innovativen Ansatz im Kontext des romantischen Klavierkonzerts.
- Quote paper
- Britta Baier (Author), 2010, Die „Fantasie für Klavier und Orchester“ von R. Schumann (später 1. Satz des Klavierkonzerts a- moll) - ein „Antikonzert“?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159200