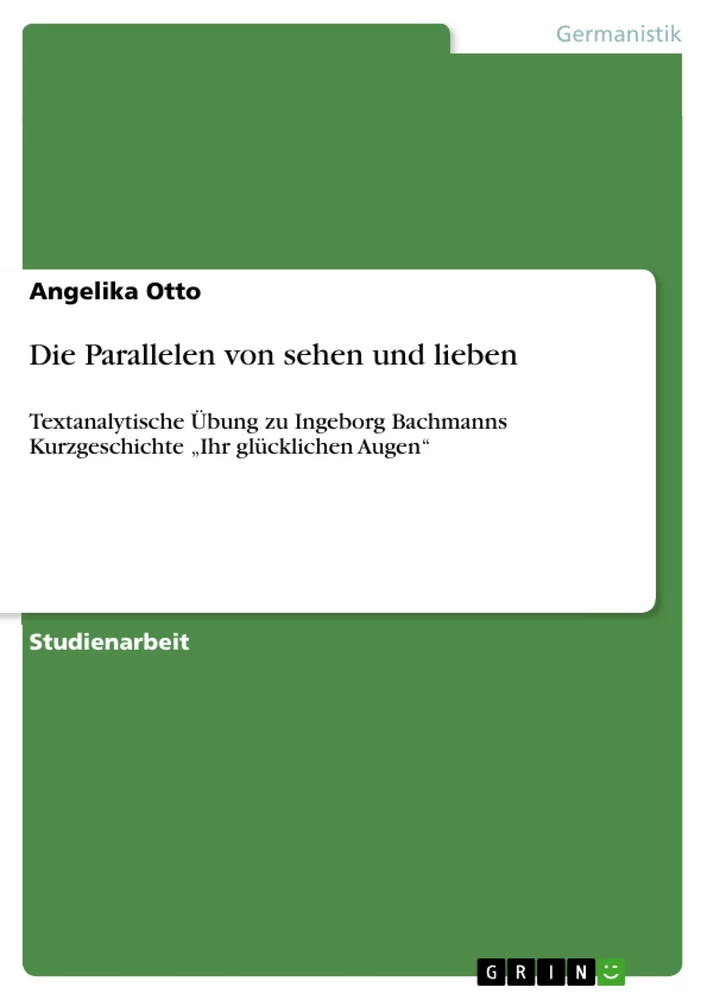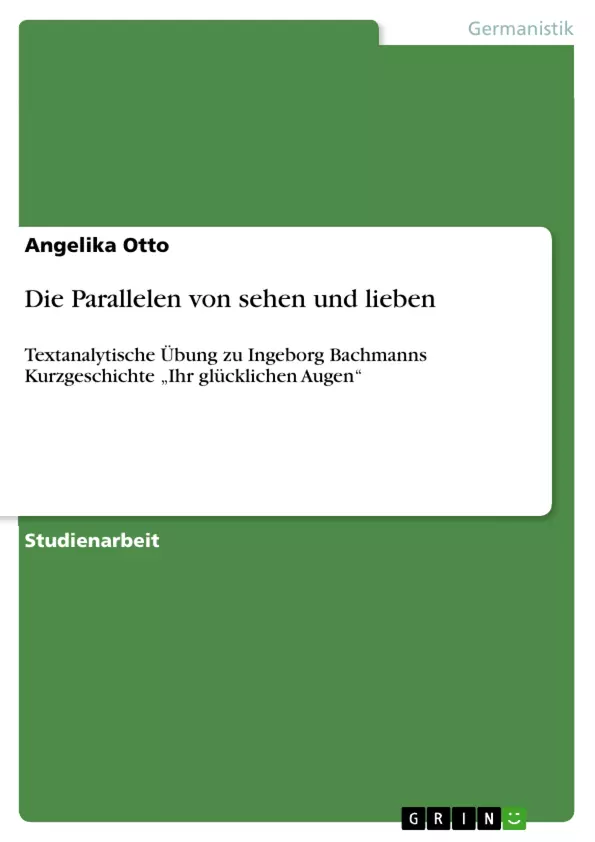In meiner Hausarbeit zu Ingeborg Bachmanns Kurzgeschichte „Ihr glücklichen Augen“ habe ich anhand meiner selbstgewählten Themenstellung „Die Parallelen von sehen und lieben“ die Textanalyse im Sinne von Martinez und Scheffel erarbeitet. Dabei habe ich mich während der gesamten Arbeit auf „Einführung in die Erzähltheorie“ bezogen.
Gegliedert habe ich meine Arbeit in vier Hauptteile, die jeweils Unterpunkte beinhalten.
Dabei gehe ich zunächst auf den Aufbau ein, der einen Überblick über die Struktur der Erzählung geben soll.
Der nächste Teil ist der Zeit gewidmet, in welcher Reihenfolge, über welchen Zeitraum und in welchen Frequenzen erzählt wird.
Im dritten Punkt soll der Modus der Geschichte dargestellt werden: Die Distanz, die durch den Erzählstil bestimmt wird, und die Fokalisierung, d.h. welchen Blickwinkel der Erzähler der Geschichte einnimmt.
Der letzte Punkt ist die Stimme. Dieses Kapitel handelt vom Zeitpunkt, dem Ort, der Stellung und der Sprechsituation des Erzählten.
Im Resumée habe ich die Ergebnisse meiner Arbeit zusammengefasst und mich noch mal besonders mit dem Sekundärtext „Ingeborg Bachmanns Ihr glücklichen Augen. Eine Fallstudie zum Interpretationsverfahren“ von Robert Pichl auseinandergesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau
- Titel und Widmung
- Szenen
- Zeit
- Ordnung
- Dauer
- Frequenzen
- Modus
- Distanz
- Fokalisierung
- Stimme
- Resumée
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert Ingeborg Bachmanns Kurzgeschichte „Ihr glücklichen Augen“ unter dem Gesichtspunkt „Die Parallelen von sehen und lieben“. Dabei wird die Textanalyse im Sinne von Martinez und Scheffel verwendet, wobei sich die Arbeit auf „Einführung in die Erzähltheorie“¹ bezieht.
- Analyse des Aufbaus der Erzählung
- Untersuchung der Zeitstruktur, einschließlich Ordnung, Dauer und Frequenz
- Darstellung des Modus der Geschichte, einschließlich Distanz und Fokalisierung
- Erörterung der Stimme in der Geschichte, insbesondere Zeitpunkt, Ort, Stellung und Sprechsituation
- Beziehung zwischen Sehen und Lieben in der Erzählung und deren Einfluss auf die Handlung und die Figuren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Arbeit und stellt die wichtigsten Themen dar. Der Abschnitt „Aufbau“ analysiert den Titel und die Widmung der Geschichte, die intertextuelle Bezüge auf Goethes Faust II und Georg Groddecks Theorie vom doppelten Charakter des Sehvorgangs aufweisen. Der Abschnitt beleuchtet auch die Struktur der Erzählung, wobei besonders auf die kurzen und teilweise zusammenhanglosen Szenen eingegangen wird. Der Abschnitt „Zeit“ untersucht die Reihenfolge, den Zeitraum und die Frequenz der Erzählung. Dabei werden die verschiedenen Zeitebenen der Geschichte und die Rolle der Zeit in der Handlung analysiert. Im Abschnitt „Modus“ wird die Distanz des Erzählers, die durch den Erzählstil bestimmt wird, und die Fokalisierung, d.h. der Blickwinkel des Erzählers, untersucht. Der Abschnitt „Stimme“ behandelt den Zeitpunkt, den Ort, die Stellung und die Sprechsituation des Erzählten. Der Resumée fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und setzt sich mit Robert Pichls Analyse „Ingeborg Bachmanns Ihr glücklichen Augen. Eine Fallstudie zum Interpretationsverfahren“ auseinander.
Schlüsselwörter
Ingeborg Bachmann, „Ihr glücklichen Augen“, Textanalyse, Erzähltheorie, Martinez und Scheffel, Sehen, Lieben, Parallelen, Psychosomatik, Georg Groddeck, intertextuelle Bezüge, Struktur, Zeit, Modus, Stimme.
¹ Matias Martinez / Michael Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie. München 1999.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Ingeborg Bachmanns Kurzgeschichte „Ihr glücklichen Augen“?
Die Geschichte thematisiert die psychosomatischen Aspekte des Sehens und deren Verbindung zur Liebe. Die Arbeit analysiert die Parallelen zwischen diesen beiden menschlichen Erfahrungen.
Welche erzähltheoretischen Begriffe werden in der Analyse verwendet?
Die Analyse nutzt Konzepte von Martinez und Scheffel, wie Zeit (Ordnung, Dauer, Frequenz), Modus (Distanz, Fokalisierung) und Stimme (Sprechsituation).
Welche Bedeutung hat der Titel „Ihr glücklichen Augen“?
Der Titel enthält intertextuelle Bezüge zu Goethes Faust II und verweist auf die Theorie des doppelten Charakters des Sehvorgangs nach Georg Groddeck.
Wie ist die Zeitstruktur der Erzählung aufgebaut?
Die Arbeit untersucht die Reihenfolge der Ereignisse, den erzählten Zeitraum und die Häufigkeit (Frequenz), mit der bestimmte Motive oder Szenen wiederkehren.
Was ist das Ergebnis der Untersuchung zum Thema „Sehen und Lieben“?
Die Arbeit zeigt auf, wie Bachmann das (Nicht-)Sehen-Wollen als Metapher für die Schwierigkeiten und die Selektivität in der Liebe nutzt.
- Arbeit zitieren
- Angelika Otto (Autor:in), 2006, Die Parallelen von sehen und lieben, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159230