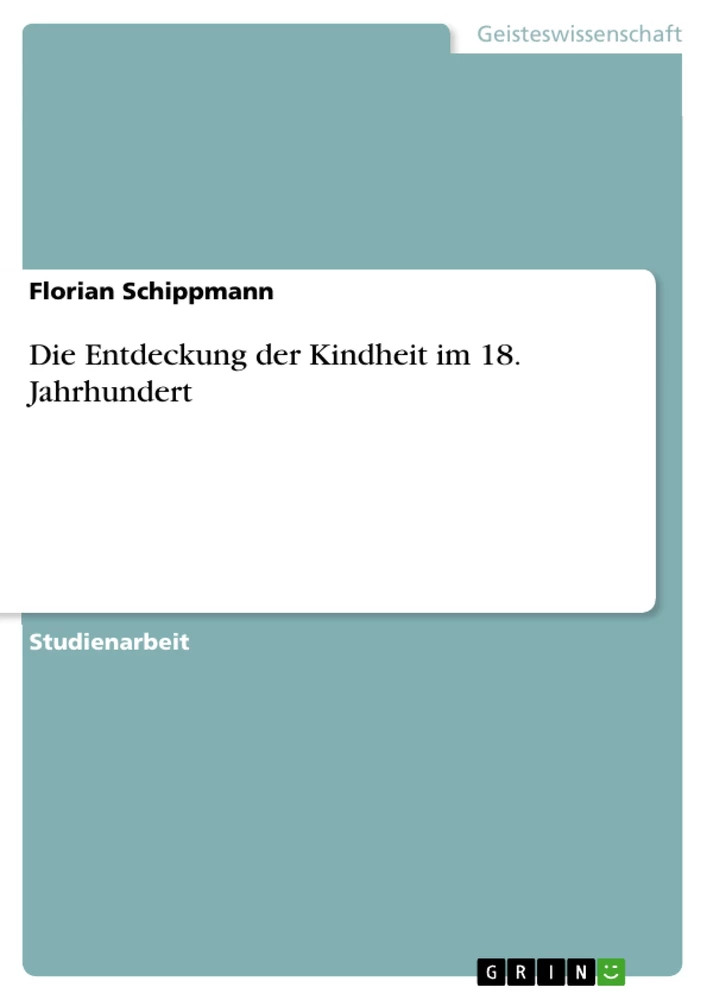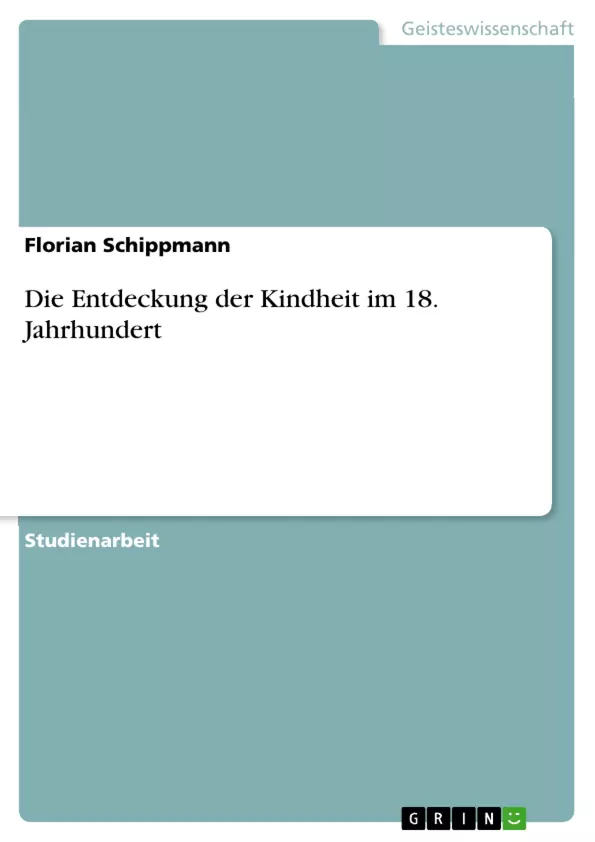In der vorliegenden Arbeit wird der Formulierung „Entdeckung der Kindheit im 18. Jahrhundert“ auf den Grund gegangen. Das erzwingt eine Auseinandersetzung mit der Position der meinungsführenden Gesellschaftsschicht zu der Zeit, des Bürgertums. Stellvertretend für die bürgerliche Meinung bezüglich Kindheit und Erziehung wurde dafür Jean-Jacques Rousseaus Roman Émile ou De l'éducation aus dem Jahre 1762 bearbeitet, da er sehr schnell zum damaligen Paradigma des modernen Kindheitsbewusstseins werden sollte.
Im Anschluss an die Analyse von Rousseaus einflussreichen Ansichten findet sich eine Darstellung dreier Kindheitstheorien. Mit Philippe Ariès’ bis heute bedeutsamer Abhandlung über die Entdeckung der Kindheit, von Lloyd deMauses historischem Entwicklungsmodell und Neil Postmans Ansatz einer technologischen Revolution werden drei höchst unterschiedliche Lehrmeinungen vorgestellt. Das abschließende Kapitel trägt zwei Absichten mit sich: Erstens soll kurz auf die angeführten drei Theorien in einer Weise eingegangen werden, wie dies vorher aus einer argumentativen Logik heraus nicht möglich war. Zweitens baut dieses Kapitel auch abseits der vorgestellten Erklärungen eine eigene Beweisführung auf, die der eingangs gestellten Aufgabe, der Formulierung „Entdeckung der Kindheit im 18. Jahrhundert“ auf den Grund zu gehen, ein Ergebnis entgegenstellen soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Jean-Jacques Rousseau und die Kindheit
- Sein Einfluss auf die Wahrnehmung von Kindheit
- Sein Menschenbild
- Seine Verständnis von Kindheit und Erziehung
- Drei Erklärungsansätze zur Entdeckung der Kindheit im 18. Jahrhundert
- Sozialer Ansatz
- Psychogenetischer Ansatz
- Technologischer Ansatz
- Kritik und Zusammenfassung
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die "Entdeckung der Kindheit im 18. Jahrhundert" und befasst sich mit der Frage, wann man begann, sich die spezielle Kultur von Kindern bewusst zu machen. Hierfür wird die Position des Bürgertums und Jean-Jacques Rousseaus einflussreiches Werk "Émile ou De l'éducation" als ein zentrales Paradigma des modernen Kindheitsbewusstseins analysiert.
- Die Entwicklung des Kindheitsverständnisses im 18. Jahrhundert
- Der Einfluss von Jean-Jacques Rousseau auf die Pädagogik
- Verschiedene Theorien zur Entdeckung der Kindheit
- Die Rolle des Bürgertums im Wandel des Kindheitsbildes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der "Entdeckung der Kindheit im 18. Jahrhundert" ein und skizziert den historischen Kontext sowie den Fokus der Arbeit.
Kapitel 1 analysiert Jean-Jacques Rousseaus Einfluss auf die Wahrnehmung von Kindheit. Es beleuchtet sein Menschenbild, seine Theorien zur Erziehung und die Auswirkungen seiner Werke auf das Kindheitsverständnis.
Kapitel 2 präsentiert drei unterschiedliche Erklärungsansätze für die Entdeckung der Kindheit im 18. Jahrhundert: den sozialen Ansatz, den psychogenetischen Ansatz und den technologischen Ansatz.
Schlüsselwörter
Kindheitskultur, Entdeckung der Kindheit, Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l'éducation, Bürgertum, Pädagogik, Sozialer Ansatz, Psychogenetischer Ansatz, Technologischer Ansatz, Naturzustand, Individualität, Erziehung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die „Entdeckung der Kindheit“ im 18. Jahrhundert?
Es beschreibt den historischen Wandel, in dem Kinder erstmals als eigenständige Wesen mit spezifischen Bedürfnissen statt als „kleine Erwachsene“ wahrgenommen wurden.
Welchen Einfluss hatte Jean-Jacques Rousseau auf dieses Bild?
Mit seinem Roman „Émile“ begründete Rousseau ein neues pädagogisches Paradigma, das die natürliche Entwicklung des Kindes in den Mittelpunkt stellte.
Was besagt die Theorie von Philippe Ariès?
Ariès argumentiert in seiner geschichtswissenschaftlichen Abhandlung, dass das moderne Kindheitsbewusstsein eng mit der Entstehung der bürgerlichen Familie verknüpft ist.
Wie erklärt Neil Postman das „Verschwinden der Kindheit“?
Postman nutzt einen technologischen Ansatz und sieht die Kindheit als Ergebnis der Schriftkultur; durch moderne Medien (wie das Fernsehen) würden die Grenzen zwischen Kind und Erwachsenem wieder verschwimmen.
Welche Rolle spielte das Bürgertum bei diesem Wandel?
Das Bürgertum war die meinungsführende Schicht, die neue Erziehungsideale und einen geschützten Raum für die kindliche Entwicklung forderte und etablierte.
- Quote paper
- Florian Schippmann (Author), 2008, Die Entdeckung der Kindheit im 18. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159260