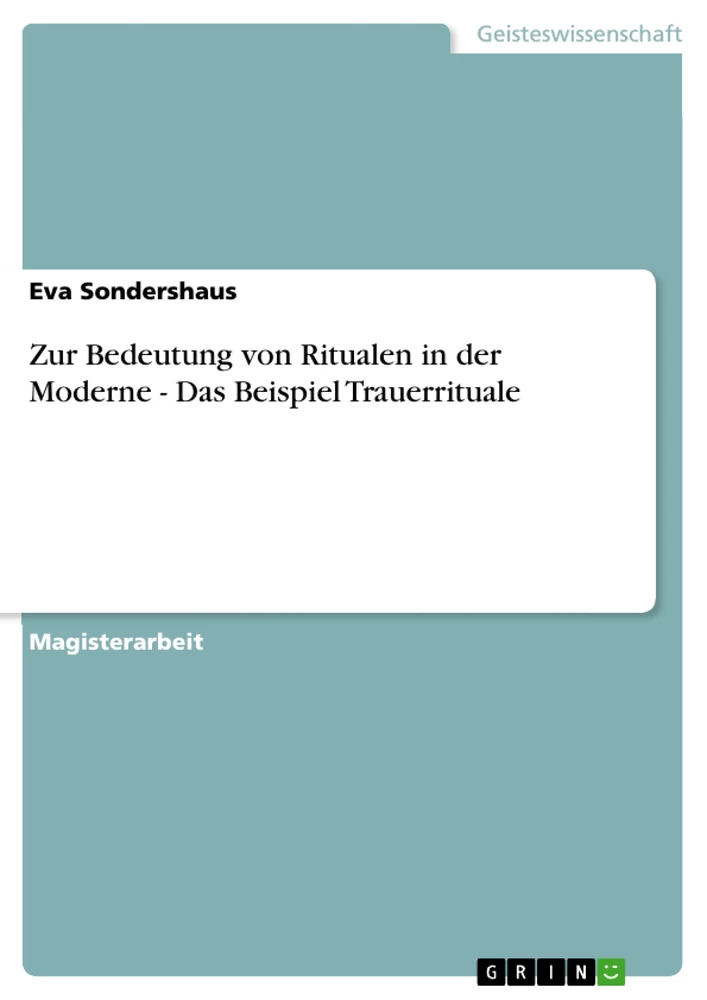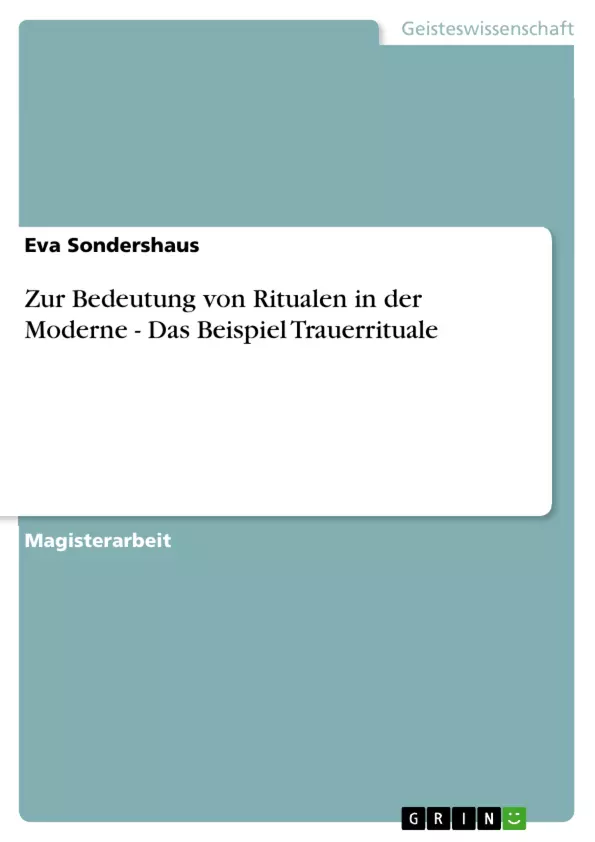Die Sozialwissenschaften, deren Gegenstand das Beobachten und Messen von ErLEBTEN und GeLEBTEN ist, finden generell nur schwer Zugang zu dem Themengebiet Tod als Bestandteil der gesellschaftlichen Strukturen. Das Hauptproblem liegt in der Natur der Objekte der Sozialwissenschaften – den Mitgliedern einer zu beobachtenden und zu deutenden Gesellschaft. Der Tod ist für Sozialwissenschaftler auf zweierlei Arten nicht greifbar: Zunächst einmal ist das Ereignis des Todes eines Individuums und die damit verbundenen Vorstellungen so individuell wie der Mensch der stirbt selbst und damit für den Wissenschaftler zwar beobacht- aber nicht messbar.(...)Zum anderen entreißt der Tod den Sozialwissenschaftlern ihre Forschungsobjekte, indem sie sterben und sich damit aus dem Einflussbereich der messenden und beobachteten Wissenschaftler verabschieden.(...) Insofern ist der Tod auf zweierlei und sehr endgültige Arten der natürliche Feind der Sozialwissenschaftler.Trotz oder gerade deswegen sind die Soziologen dazu übergegangen, alle greifbaren Randerscheinungen zu untersuchen und zu quantifizieren. (...) Am Tod werden die prinzipielle Kontingenz und der konstruktive Charakter der Wirklichkeit offensichtlich und damit stellt er die größte Bedrohung für die Gewissheit der Alltagswelt da, (...) Wenn es also nicht gelingt, den Tod integrativ in der Gesellschaft zu legitimieren und somit die sichere Gewissheit der Wirklichkeit zu bewahren, wird der Tod nach Berger und Luckmann sogar ein soziales Problem. (...)Wie kann diese Integration durchgeführt werden? An dieser Stelle legitimieren sich Rituale und deren Symbole, die diesen Grenzerfahrungen und –situationen einen Platz innerhalb des Bezugssystems Gesellschaft zuweisen „die verschiedene Sinnprovinzen integrieren und die institutionale Ordnung als symbolische Totalität überhöhen“ (a.a.O.: 102). Die Grenzsituationen werden mit Sinn versehen, damit der Mensch die Wirklichkeit der Alltagswelt nicht als zweifelhaft und ungesichert (unsicher) empfindet. Diese integrative Legitimation des Todes enthält dabei zwei Aspekte: (...)kognitive und weltanschauliche Verläufe und ein Aspekt auf die praktischen Dimensionen in der gelebten Gesellschaft. Letztere zeigen sich in den Riten, die eine Gesellschaft bezüglich des Todes und der Trauer entwickelt. (...)Die Frage, inwieweit Trauerrituale in der heutigen Zeit noch als Hilfe zur Trauerbewältigung für die Hinterbliebenen gelten, wird beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Erläuterungen zum Gegenstand der Arbeit
- 1.1 Zum Umgang mit dem Tod als gesellschaftliches Fakt
- 1.2 Struktur und Leistung dieser Arbeit
- 2 Theoretische Vorüberlegungen
- 2.1 Der status quo im modernen Deutschland
- 2.2 Der Begriff der Säkularisierung
- 2.2.1 Definitorischer Bezugsrahmen
- 2.2.2 Säkularisierung als gesellschaftliche Dynamik
- 2.3 Der Begriff der Individualisierung
- 3 Das Konstrukt Ritual als Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschung
- 3.1 Einführung in die Begrifflichkeiten
- 3.1.1 Geschichte der Forschung
- 3.1.2 Definitionen
- 3.2 Die verstehende Soziologie als wissenschaftstheoretischer Bezugsrahmen für das Konstrukt Ritual
- 3.2.1 Das Lebensweltverständnis am Bespiel der Konzeption von A.Schütz
- 3.2.2 Funktionen/Aufgaben der Rituale in der Gesellschaft
- 3.2.3 Konstitution der Rituale im Alltag
- 3.2.3.1 Funktionsvarianten der Rituale in der sozialen Wirklichkeit
- 3.2.3.2 Alltagsdimensionen des Rituals
- 3.3 Funktion und Darstellung von Trauerritualen im gesellschaftlichen Alltag
- 3.3.1 Einleitung
- 3.3.2 Traueruniversalien
- 3.3.2.1 nach Worden
- 3.3.2.2 nach Firth
- 4 Begräbnis- und Trauerrituale im Spiegel der Zeit
- 4.1 Begräbnis und Trauerrituale im Mittelalter
- 4.1.1 Einführende Erläuterungen zur Herangehensweise an historisches Textmaterial - zum Zusammenhang von Kommunikation und Ritualen im Mittelalter
- 4.1.2 Präsenz des Todes in der Gesellschaft
- 4.1.3 Elemente des momento morii
- 4.1.3.1 Bestimmung des Seelenheiles schon im Diesseits
- 4.1.3.2 Das Testament
- 4.1.3.3 Der Sterberitus
- 4.1.3.4 Bestattungsorte
- 4.1.4 Eine Darstellung des gesellschaftlicher Wandel am Beispiel der Friedhöfe
- 4.1.5 Wandel bei den Gräbern
- 4.2 Begräbnis- und Trauerrituale in der Moderne
- 4.2.1 Darstellung des modernen Begräbnisritus
- 4.2.2 Entwurzelung durch Todesverdrängung?
- 4.2.2.1 Gesellschaftliche Fakten, die für die Verdrängungsthese sprechen
- 4.2.2.2 Kritik an der Verdrängungsthese
- 5 Bearbeitung der thanatologischen Literatur
- 5.1 Vorangehende Überlegungen
- 5.1.1 Definitorische Grundlage
- 5.1.2 Vorgehensweise
- 5.1.2.1 Textbearbeitung
- 5.2 Die Bedeutung der Zeit für die Durchführung von Trauerritualen
- 5.2.1 Leben nach dem Tod eines Partners - Bewältigungsrituale
- 5.2.1.1 Death Narratives
- 5.2.1.2 Erschaffung virtueller Welten, imaginärer Persönlichkeiten
- 5.2.2 Resümee
- 5.3 Die Bedeutung der Sprache oder das Thematisieren als Ritual am Beispiel verwaister Eltern
- 5.3.1 Kommunikation als Grundlage des innerfamiliären Zusammenlebens
- 5.3.2 In medias res: Die Rolle der Kommunikation bei Trauer- und Sterberitualen
- 5.3.2.1 C. Ellis
- 5.3.2.2 G. Riches und P. Dawson
- 5.3.2.3 T. Walter
- 5.3.2.4 M. Stroebe – Kritik an Walter
- 5.3.2.5 I. Burkitt
- 5.3.2.6 A. Giddens
- 5.3.2.7 K. Talbot
- 5.3.3 Geschlechtsspezifisches Kommunikationsverhalten in der Trauerarbeit am Beispiel des Todes eines Kindes
- 5.4 Bedeutung von Trauerritualen im kulturspezifischen Kontext
- 5.4.1 Die Auswirkung der Gesellschaftsform auf die Aspekte des Trauerns
- 5.4.2 Trauer in der Migration – Der Verlust der Lebenswelt
- 5.4.3 Ansätze eines interkulturellen Trauermodells
- 5.4.4 Zusammenfassung
- 6 Die Arbeit abschließende Überlegungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Bedeutung von Ritualen in der modernen Gesellschaft, insbesondere im Kontext von Trauerprozessen. Ziel ist es, die gesellschaftliche Funktion von Ritualen zu beleuchten und deren Wandel im Laufe der Zeit zu analysieren. Die Arbeit fragt nach der Bedeutung ritualisierter Trauerhandlungen für die Trauernden in der heutigen Zeit.
- Der Wandel des Umgangs mit dem Tod in verschiedenen Gesellschaften
- Die Rolle von Institutionen (z.B. Kirche) bei der Gestaltung von Trauerritualen
- Der Einfluss von Säkularisierung und Individualisierung auf Trauerrituale
- Die Bedeutung von Kommunikation und Sprache im Trauerprozess
- Interkulturelle Aspekte des Trauerns
Zusammenfassung der Kapitel
1 Erläuterungen zum Gegenstand der Arbeit: Dieses einführende Kapitel legt die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise der Arbeit dar. Es begründet die Wahl von Trauerritualen als Fallbeispiel für die Untersuchung der gesellschaftskonstituierenden Funktion von Ritualen und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Umgang mit dem Tod als gesellschaftliches Phänomen wird kurz angerissen.
2 Theoretische Vorüberlegungen: Dieses Kapitel behandelt zentrale theoretische Konzepte, die für das Verständnis der Arbeit essentiell sind. Es beleuchtet den Status Quo des Umgangs mit Tod und Trauer im modernen Deutschland und analysiert die Begriffe Säkularisierung und Individualisierung und deren Einfluss auf die Entwicklung von Ritualen. Der Fokus liegt auf der gesellschaftlichen Dynamik dieser Prozesse.
3 Das Konstrukt Ritual als Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschung: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Einführung in den sozialwissenschaftlichen Ritualbegriff. Es präsentiert einen historischen Abriss der Ritualforschung, verschiedene Definitionen des Begriffs "Ritual" und diskutiert die verstehende Soziologie als methodischen Ansatz. Der Fokus liegt auf der Funktion und Darstellung von Trauerritualen im gesellschaftlichen Alltag, inklusive einer Betrachtung von Traueruniversalien nach Worden und Firth.
4 Begräbnis- und Trauerrituale im Spiegel der Zeit: Dieses Kapitel vergleicht Trauerrituale im Mittelalter und in der Moderne. Es analysiert die Präsenz des Todes im Mittelalter, die Rolle des "momento mori", und beschreibt die Bestattungsrituale dieser Epoche. Anschließend wird der moderne Begräbnisritus dargestellt und die Debatte um die These der Todesverdrängung in der modernen Gesellschaft diskutiert.
5 Bearbeitung der thanatologischen Literatur: Das Kapitel analysiert verschiedene Studien zur Bedeutung von Zeit und Sprache im Trauerprozess. Es werden die Bewältigungsstrategien nach dem Verlust eines Partners untersucht sowie die Rolle der Kommunikation in der Trauerarbeit, insbesondere bei verwaisten Eltern. Der Einfluss von Geschlecht und Kultur auf den Trauerprozess wird ebenfalls behandelt. Es werden verschiedene Ansätze eines interkulturellen Trauermodells besprochen.
Schlüsselwörter
Rituale, Trauerrituale, Tod, Trauer, Säkularisierung, Individualisierung, Moderne, Mittelalter, Gesellschaft, Kommunikation, Thanatologie, Interkulturalität, soziale Funktion von Ritualen, gesellschaftlicher Wandel.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Bedeutung von Ritualen im Kontext von Trauerprozessen
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Bedeutung von Ritualen in der modernen Gesellschaft, insbesondere im Kontext von Trauerprozessen. Sie analysiert den gesellschaftlichen Wandel im Umgang mit dem Tod und die Funktion von Trauerritualen für Trauernde.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Wandel des Umgangs mit dem Tod, der Rolle von Institutionen (z.B. Kirche), dem Einfluss von Säkularisierung und Individualisierung, der Bedeutung von Kommunikation und Sprache im Trauerprozess sowie interkulturellen Aspekten des Trauerns.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Kapitel 1 bietet eine Einleitung und Forschungsmethodik. Kapitel 2 behandelt theoretische Konzepte wie Säkularisierung und Individualisierung. Kapitel 3 definiert den sozialwissenschaftlichen Ritualbegriff und analysiert Trauerrituale. Kapitel 4 vergleicht Trauerrituale im Mittelalter und in der Moderne. Kapitel 5 analysiert thanatologische Literatur bezüglich Zeit und Sprache im Trauerprozess, einschließlich interkultureller Aspekte. Kapitel 6 schließt die Arbeit ab.
Wie wird der Ritualbegriff in der Arbeit definiert und verwendet?
Die Arbeit liefert eine umfassende Einführung in den sozialwissenschaftlichen Ritualbegriff. Es werden verschiedene Definitionen vorgestellt, und die verstehende Soziologie dient als methodischer Ansatz. Die Analyse fokussiert die Funktion und Darstellung von Trauerritualen im gesellschaftlichen Alltag.
Wie werden mittelalterliche und moderne Trauerrituale verglichen?
Die Arbeit analysiert die Präsenz des Todes im Mittelalter (momento mori, Sterberitus, Bestattungsorte), vergleicht dies mit dem modernen Begräbnisritus und diskutiert die These der Todesverdrängung in der modernen Gesellschaft.
Welche Rolle spielen Kommunikation und Sprache im Trauerprozess?
Kapitel 5 untersucht die Bedeutung von Kommunikation und Sprache im Trauerprozess, insbesondere bei verwaisten Eltern. Es werden verschiedene Studien analysiert und der Einfluss von Geschlecht und Kultur auf das Kommunikationsverhalten in der Trauerarbeit betrachtet.
Wie werden interkulturelle Aspekte des Trauerns behandelt?
Die Arbeit analysiert den Einfluss von Kultur und Gesellschaftsform auf Trauerritualen und den Trauerprozess, insbesondere im Kontext von Migration. Es werden Ansätze eines interkulturellen Trauermodells diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rituale, Trauerrituale, Tod, Trauer, Säkularisierung, Individualisierung, Moderne, Mittelalter, Gesellschaft, Kommunikation, Thanatologie, Interkulturalität, soziale Funktion von Ritualen, gesellschaftlicher Wandel.
Welche methodische Vorgehensweise wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine sozialwissenschaftliche Perspektive mit der verstehenden Soziologie als methodischem Ansatz. Sie analysiert thanatologische Literatur und vergleicht historische und moderne Trauerrituale.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit ist die Bedeutung von ritualisierten Trauerhandlungen für die Trauernden in der heutigen Zeit, und wie sich diese im Wandel der Gesellschaft und im Kontext von Säkularisierung und Individualisierung verändert haben.
- Quote paper
- Eva Sondershaus (Author), 2008, Zur Bedeutung von Ritualen in der Moderne - Das Beispiel Trauerrituale, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159267