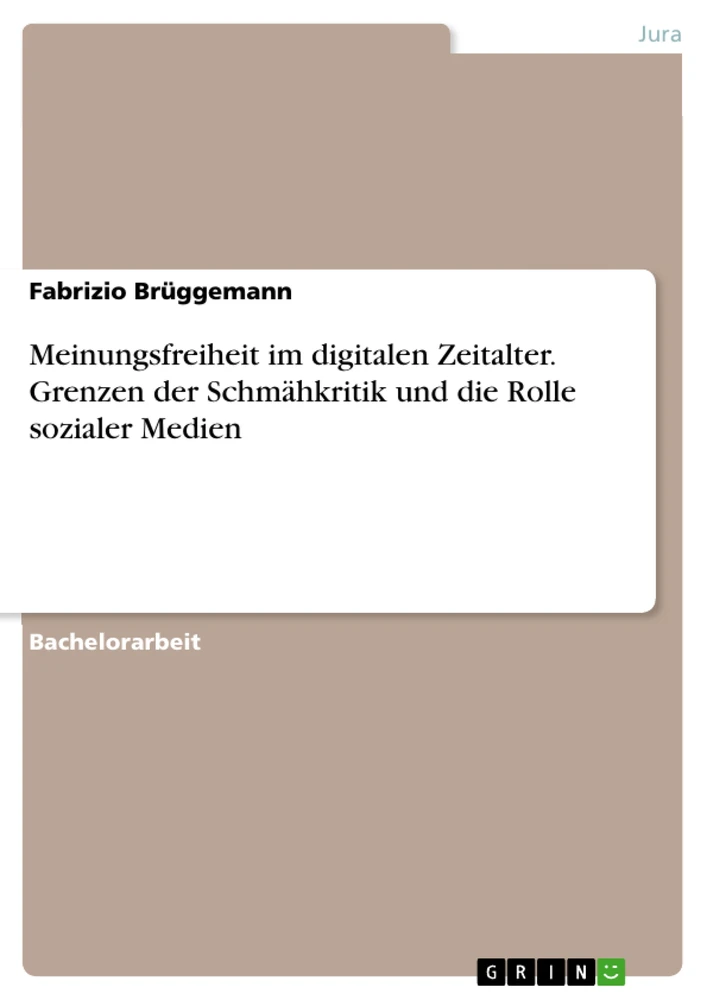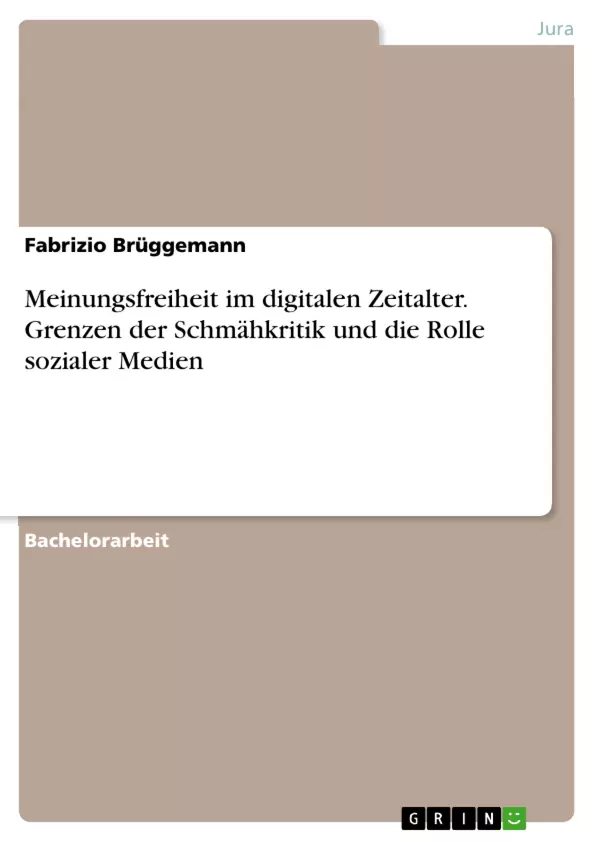Diese Arbeit untersucht die rechtlichen Grenzen der Schmähkritik (Sk) zwischen Meinungsfreiheit (Mf) und Persönlichkeitsrecht im digitalen Raum.
Um diese Fragen zu beantworten, werden zunächst die rechtlichen Grundlagen erläutert. Im Folgenden schließt sich eine ausführliche Erläuterung der Sk, Ihrer Abgrenzung zu Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung, sowie ihrer Behandlung durch die Rechtsprechung an. Der Fall Renate Künast wird dabei exemplarisch herangezogen. Schließlich wird die Rolle sozialer Medien und ihrer Betreiber in der Regulierung der Sk analysiert. Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen dazu beitragen, ein klares Verständnis für die Herausforderungen der Mf im digitalen Zeitalter zu entwickeln, und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Grundlagen zum Konflikt zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht
- I. Meinungsfreiheit im nationalen Recht
- II. Meinungsfreiheit im europäischen und internationalen Recht
- III. Schranken der Meinungsfreiheit
- IV. Abgrenzung Meinungsfreiheit vs. allgemeines Persönlichkeitsrecht
- C. Schmähkritik und ihre rechtlichen Grenzen
- I. Definition der Schmähkritik
- II. Rechtsprechung
- III. Erkenntnisse des Kapitels
- D. Soziale Medien als rechtliche Herausforderungen
- I. Plattformen als Akteure zwischen Meinungsfreiheit und Regulierung
- II. Rechtliche Rahmenbedingungen für soziale Netzwerke
- III. Verantwortung der Plattformbetreiber im DSA
- IV. Rechtsprechung
- V. Erkenntnisse des Kapitels
- E. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Meinungsfreiheit im digitalen Zeitalter, insbesondere die Grenzen der Schmähkritik und die Rolle sozialer Medien. Ziel ist es, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu analysieren und die Herausforderungen für die Meinungsfreiheit im Kontext von Online-Plattformen zu beleuchten.
- Meinungsfreiheit im nationalen und internationalen Recht
- Definition und Abgrenzung der Schmähkritik
- Relevanz der Rechtsprechung zu Schmähkritikfällen
- Rechtliche Rahmenbedingungen sozialer Medien
- Verantwortung von Plattformbetreibern
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Meinungsfreiheit im digitalen Zeitalter ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie benennt die zentrale Forschungsfrage und die methodischen Vorgehensweisen.
B. Grundlagen zum Konflikt zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht: Dieses Kapitel legt die rechtlichen Grundlagen für die Untersuchung dar. Es beleuchtet die Meinungsfreiheit im nationalen, europäischen und internationalen Recht, analysiert die Schranken der Meinungsfreiheit und befasst sich eingehend mit dem Spannungsverhältnis zwischen Meinungsfreiheit und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, insbesondere im Kontext des Internets. Es werden verschiedene Rechtsauffassungen und -auslegungen gegenübergestellt und kritisch bewertet.
C. Schmähkritik und ihre rechtlichen Grenzen: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Schmähkritik und grenzt ihn von Meinungsfreiheit, Beleidigung, üblen Nachrede und Verleumdung ab. Es analysiert die einschlägige Rechtsprechung, insbesondere anhand der Urteile zu Alice Weidel und Renate Künast, um die Kriterien für die juristische Bewertung von Schmähkritik zu ermitteln und zu diskutieren. Die Kapitelzusammenfassung präsentiert eine umfassende Analyse dieser Urteile und deren Bedeutung für die Abgrenzung von zulässiger Kritik und unzulässiger Schmähkritik.
D. Soziale Medien als rechtliche Herausforderungen: Dieses Kapitel untersucht die Rolle sozialer Medien im Kontext der Meinungsfreiheit. Es analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere das NetzDG und den DSA, und beleuchtet die Verantwortung der Plattformbetreiber für die Inhalte auf ihren Plattformen. Die Diskussion der Rechtsprechung zu diesem Thema, einschließlich einer detaillierten Analyse eines Beispielfalls, ergänzt die theoretischen Überlegungen und verdeutlicht die praktischen Herausforderungen. Die Bedeutung von "Overblocking" und "Underblocking" wird im Detail erläutert.
Schlüsselwörter
Meinungsfreiheit, Schmähkritik, digitales Zeitalter, soziale Medien, Persönlichkeitsrecht, NetzDG, DSA, Rechtsprechung, Plattformverantwortung, EMRK, grundgesetzliche Rechte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Meinungsfreiheit im digitalen Zeitalter, insbesondere die Grenzen der Schmähkritik und die Rolle sozialer Medien.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel ist es, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu analysieren und die Herausforderungen für die Meinungsfreiheit im Kontext von Online-Plattformen zu beleuchten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen Meinungsfreiheit im nationalen und internationalen Recht, Definition und Abgrenzung der Schmähkritik, Relevanz der Rechtsprechung zu Schmähkritikfällen, rechtliche Rahmenbedingungen sozialer Medien und die Verantwortung von Plattformbetreibern.
Was beinhaltet die Einleitung (Kapitel A)?
Die Einleitung führt in das Thema der Meinungsfreiheit im digitalen Zeitalter ein, skizziert den Aufbau der Arbeit, benennt die zentrale Forschungsfrage und die methodischen Vorgehensweisen.
Was wird im Kapitel "Grundlagen zum Konflikt zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht" (Kapitel B) behandelt?
Dieses Kapitel legt die rechtlichen Grundlagen dar, beleuchtet die Meinungsfreiheit im nationalen, europäischen und internationalen Recht, analysiert die Schranken der Meinungsfreiheit und befasst sich mit dem Spannungsverhältnis zwischen Meinungsfreiheit und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht.
Wie wird Schmähkritik in der Arbeit definiert und abgegrenzt (Kapitel C)?
Das Kapitel definiert den Begriff der Schmähkritik und grenzt ihn von Meinungsfreiheit, Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung ab. Es analysiert die einschlägige Rechtsprechung, insbesondere anhand der Urteile zu Alice Weidel und Renate Künast.
Welche Rolle spielen soziale Medien im Kontext der Meinungsfreiheit (Kapitel D)?
Dieses Kapitel untersucht die Rolle sozialer Medien im Kontext der Meinungsfreiheit, analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen (insbesondere das NetzDG und den DSA) und beleuchtet die Verantwortung der Plattformbetreiber für die Inhalte auf ihren Plattformen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Bachelorarbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind Meinungsfreiheit, Schmähkritik, digitales Zeitalter, soziale Medien, Persönlichkeitsrecht, NetzDG, DSA, Rechtsprechung, Plattformverantwortung, EMRK und grundgesetzliche Rechte.
Was ist die Bedeutung von "Overblocking" und "Underblocking" im Kontext sozialer Medien?
"Overblocking" und "Underblocking" sind Begriffe, die im Kapitel zu sozialen Medien (D) erläutert werden und sich auf die Praxis der Plattformbetreiber beziehen, Inhalte zu stark oder zu wenig zu regulieren.
- Quote paper
- Fabrizio Brüggemann (Author), 2025, Meinungsfreiheit im digitalen Zeitalter. Grenzen der Schmähkritik und die Rolle sozialer Medien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1593098