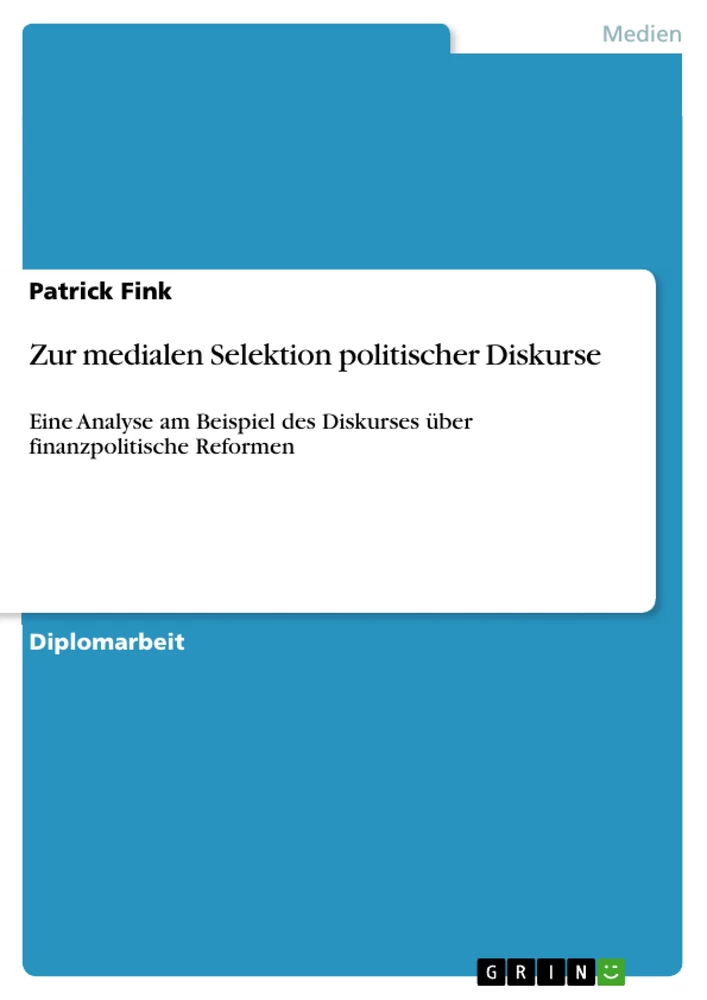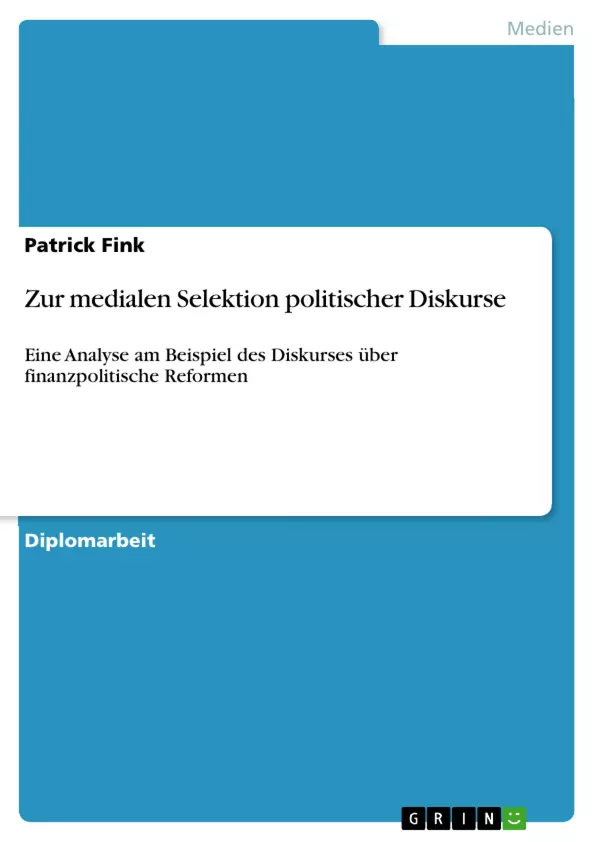Die vorliegende Arbeit will Anregungen zur Verbesserung des Zusammenwirkens von Massenmedien und politischen Entscheidungsprozessen geben – der Fokus liegt also auf der Makroebene gesellschaftlicher Prozesse.
Auch wenn der Begriff der Verbesserung hier zunächst allgemein gehalten ist, führt er zum Problem der Norm und damit in das Spannungsverhältnis von analytischer Medientheorie und normativer Gesellschaftstheorie. Woran können Verbesserungen oder Verschlechterungen festgemacht sowie ihre Intensivität gemessen werden?
Das Problem wird nicht darin gesehen, dass gesellschaftlicher Wandel nicht in eine bestimmte, vom Autor bevorzugte Richtung stattfindet, sondern dass ein solcher nicht diskutiert wird und nicht einmal diskutiert werden kann. Die Möglichkeit der Stellung einer bestimmten Forderung hängt von einem Grundkonsens ab, der in der jeweiligen historisch-spezifischen Situation nicht hinterfragt werden kann. Dies soll am Beispiel der Kapitalismusdebatte gezeigt werden, in deren Verlauf der Grundkonsens des liberalistischen Kapitalismus erst von realpolitischen Ereignissen erschüttert werden konnte.
Mit vielen Kommentatoren der Qualitätszeitungen ist zu behaupten, dass die Finanzkrise eine realpolitisches Ereignis ist, dessen Auswirkungen den Grundkonsens Liberalismus und Deregulierung modifizieren wird, der spätestens seit Ende des Systemkonflikts 1989/90 die Wirtschaftspolitik der Welt dominierte und somit auf Grund des Primats der Wirtschaftspolitik die Lebenssituation von Millionen von Menschen in vielfältiger Weise beeinflusste. Somit kann die Analyse dieser Debatten herausarbeiten, inwiefern gesellschaftliche Probleme rechtzeitig erkannt und tragfähige Lösungsvorschläge angeboten worden sind.
Hier interessiert besonders der für die Massenmedien essentielle Operationsmodus der Selektion. Dabei liegt das primäre Erkenntnisinteresse dieser Arbeit nicht im Warum oder im Wer der Selektion, nicht zentral im Wie der Selektion, sondern in den Konsequenzen der Selektion. Welche Charakteristika weißt die von den Massenmedien gezeichnete Realität auf?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Produktive Ausschließung – die Herleitung der Fragestellung
- 2.1 Warum Foucault?
- 2.2 Die methodischen Grundschritte
- 2.3 Diskurse und Subjekte
- 2.4 Diskursive und dispositive Einschränkungen
- III. Die heutigen Strukturen – die Analyse der Elemente der Fragestellung
- 3.1 Zur Komplementarität der Perspektiven Foucaults und Luhmanns
- 3.2 Die Grundprinzipien der Demokratie
- 3.3 Faktoren gesellschaftlichen Wandels
- 3.4 Die Medien in der Demokratie - Öffentlichkeit
- 3.5 Akteure und Prozesse der Politischen Kommunikation
- 3.6 Aktuelle Entwicklungen
- IV. Bestimmung der Norm
- 4.1 Überblick über die Funktionen des Mediensystems
- 4.2 Deliberale Öffentlichkeitstheorie
- 4.3 Ein Modell zur Messung demokratischer Medienperformanz
- V. Verzerrung
- 5.1 Nachrichtenwerttheorie
- 5.2 Der Framing-Ansatz
- VI. Empirische Analyse
- 6.1 Die Kapitalismusdebatte
- 6.2 Erläuterung der gewählten Methodik
- 6.3 Präsentation und Diskussion der Ergebnisse
- 6.4 Erkenntnisse zu Framing-Prozessen in der Kapitalismusdebatte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Selektion politischer Diskurse in Massenmedien auf die gesellschaftliche Entwicklung. Sie analysiert, inwieweit die bestehenden Strukturen und Routinen in den Medien die frühzeitige Erkennung und adäquate Behandlung gesellschaftlicher Probleme behindern. Der Fokus liegt auf der Makroebene und untersucht, wie Medien die Chancen der politischen Partizipation beeinflussen.
- Der Einfluss von Massenmedien auf die politische Meinungsbildung
- Die Rolle von Selektionsprozessen in der medialen Darstellung politischer Diskurse
- Die Analyse von Machtstrukturen und deren Auswirkungen auf die öffentliche Kommunikation
- Die Bewertung der Medienperformanz im Hinblick auf demokratische Qualitätsstandards
- Empirische Untersuchung der Kapitalismusdebatte anhand des Framing-Ansatzes
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Arbeit untersucht den Einfluss der Massenmedien auf das Zusammenspiel von Politik und Gesellschaft, insbesondere die Frage, wie Medien die Erkennung und Bewältigung gesellschaftlicher Probleme beeinflussen. Sie kritisiert rein deskriptive Ansätze und betont die Notwendigkeit normativer Bewertungen für die Ableitung von Handlungsempfehlungen. Der Fokus liegt auf der Makroebene und der Verbesserung des Zusammenwirkens von Medien und Politik, wobei das Problem der Norm und das Spannungsverhältnis von analytischer Medientheorie und normativer Gesellschaftstheorie zentral sind.
II. Produktive Ausschließung – die Herleitung der Fragestellung: Dieses Kapitel erläutert die Relevanz von Michel Foucaults Diskurstheorie für die Analyse medialer Selektion. Es werden Foucaults Erkenntnisse zur Macht, Praktiken und Selektionsmechanismen vorgestellt und deren methodische Anwendung zur Untersuchung der Verbindungen zwischen der Selektion von Aussagen und der Veränderbarkeit gesellschaftlichen Handelns dargelegt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Konsequenzen der Selektion, insbesondere auf die Beeinflussung der Chancen derer, die öffentliche Diskussionen mitbestimmen wollen.
III. Die heutigen Strukturen – die Analyse der Elemente der Fragestellung: Dieses Kapitel nutzt die Systemtheorie Luhmanns zur Analyse des Zusammenwirkens von Massenmedien und politischen Institutionen. Es wird die Komplementarität der Perspektiven Foucaults und Luhmanns im Hinblick auf die Flexibilisierung gesellschaftlicher Strukturen untersucht. Die Grundprinzipien der Demokratie, Faktoren gesellschaftlichen Wandels, die Rolle der Medien in der Öffentlichkeit und die Akteure der politischen Kommunikation werden beleuchtet, um die theoretischen Grundlagen für die Analyse der Selektion zu legen.
IV. Bestimmung der Norm: Dieses Kapitel leitet aus den vorherigen Kapiteln allgemeine Funktionszuschreibungen an die Massenmedien ab und verknüpft diese mit der deliberalen Öffentlichkeitstheorie Habermas. Es präsentiert ein Modell zur Messung demokratischer Medienperformanz nach Voltmer, das die Kriterien Vielfalt, Objektivität, Kritik und Strukturierung umfasst. Der Fokus liegt auf der Operationalisierung dieser Kriterien für die empirische Analyse.
V. Verzerrung: Dieses Kapitel diskutiert die Mechanismen der Verzerrung in der medialen Berichterstattung, indem es die Nachrichtenwerttheorie und die Theorie der Schweigespirale einbezieht. Es werden die Nachrichtenfaktoren und deren Einfluss auf die Selektion von Ereignissen erläutert und anschließend der Framing-Ansatz als integratives Konzept zur Erklärung von Verzerrungen vorgestellt. Der Fokus liegt auf der Integration verschiedener Ansätze zur Selektions- und Verzerrungsforschung.
VI. Empirische Analyse: Dieses Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung der These, dass die Arbeitsroutinen des Mediensystems die gesellschaftliche Entwicklung behindern. Es analysiert die Kapitalismusdebatte anhand zweier Ausschnitte: die Debatte um Private-Equity-Gesellschaften und Hedgefonds und die Debatte um die Finanzmarktkrise. Die Methodik, die auf einer quantitativen Inhaltsanalyse auf Frame-Elemente basiert, wird detailliert erläutert und die Ergebnisse werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Mediale Selektion, Politische Diskurse, Finanzpolitische Reformen, Diskurstheorie (Foucault), Systemtheorie (Luhmann), Deliberative Öffentlichkeitstheorie (Habermas), Framing-Ansatz, Nachrichtenwerttheorie, Schweigespirale, Medienperformanz, Kapitalismusdebatte, Agenda-Setting, Konsonanz, Homogenität, Vielfalt, Objektivität, Kritik, Strukturierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Auswirkungen medialer Selektion auf die gesellschaftliche Entwicklung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie die Selektion politischer Diskurse in Massenmedien die gesellschaftliche Entwicklung beeinflusst. Im Fokus steht, inwiefern bestehende Medienstrukturen und -routinen die frühzeitige Erkennung und Bearbeitung gesellschaftlicher Probleme behindern und wie Medien die politische Partizipation beeinflussen.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit kombiniert die Diskurstheorie Foucaults (fokussiert auf Macht, Praktiken und Selektionsmechanismen) mit der Systemtheorie Luhmanns (zur Analyse des Zusammenwirkens von Medien und politischen Institutionen). Zusätzlich werden die deliberative Öffentlichkeitstheorie Habermas, die Nachrichtenwerttheorie, die Schweigespirale und der Framing-Ansatz herangezogen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit beinhaltet eine theoretische Analyse der genannten Ansätze sowie eine empirische Untersuchung. Die empirische Analyse konzentriert sich auf die Kapitalismusdebatte (Private-Equity, Hedgefonds, Finanzmarktkrise) und verwendet eine quantitative Inhaltsanalyse auf Frame-Elemente.
Welche zentralen Fragen werden behandelt?
Zentrale Fragen sind: Wie beeinflussen Massenmedien die politische Meinungsbildung? Welche Rolle spielen Selektionsprozesse in der medialen Darstellung politischer Diskurse? Wie wirken sich Machtstrukturen auf die öffentliche Kommunikation aus? Wie lässt sich die Medienperformanz im Hinblick auf demokratische Qualitätsstandards bewerten?
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist ihr Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung (Problemdefinition, Forschungsansatz), Herleitung der Fragestellung (Foucaults Diskurstheorie), Analyse der Strukturen (Luhmanns Systemtheorie und deren Verhältnis zu Foucaults Theorie), Bestimmung der Norm (deliberative Öffentlichkeitstheorie, Kriterien für Medienperformanz), Verzerrung (Nachrichtenwerttheorie, Framing), und die empirische Analyse (Kapitalismusdebatte, Methodik, Ergebnisse).
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Mediale Selektion, Politische Diskurse, Finanzpolitische Reformen, Diskurstheorie (Foucault), Systemtheorie (Luhmann), Deliberative Öffentlichkeitstheorie (Habermas), Framing-Ansatz, Nachrichtenwerttheorie, Schweigespirale, Medienperformanz, Kapitalismusdebatte, Agenda-Setting, Konsonanz, Homogenität, Vielfalt, Objektivität, Kritik, Strukturierung.
Was ist das zentrale Ergebnis der empirischen Analyse?
Die empirische Analyse untersucht, ob die Arbeitsroutinen des Mediensystems die gesellschaftliche Entwicklung behindern, indem sie die Kapitalismusdebatte anhand ausgewählter Debatten analysiert. Die Ergebnisse werden detailliert im Kapitel VI präsentiert und diskutiert.
Welche normative Aussage macht die Arbeit?
Die Arbeit kritisiert rein deskriptive Ansätze und betont die Notwendigkeit normativer Bewertungen für die Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Verbesserung des Zusammenwirkens von Medien und Politik. Sie entwickelt ein Modell zur Messung demokratischer Medienperformanz.
- Quote paper
- Patrick Fink (Author), 2009, Zur medialen Selektion politischer Diskurse , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159333