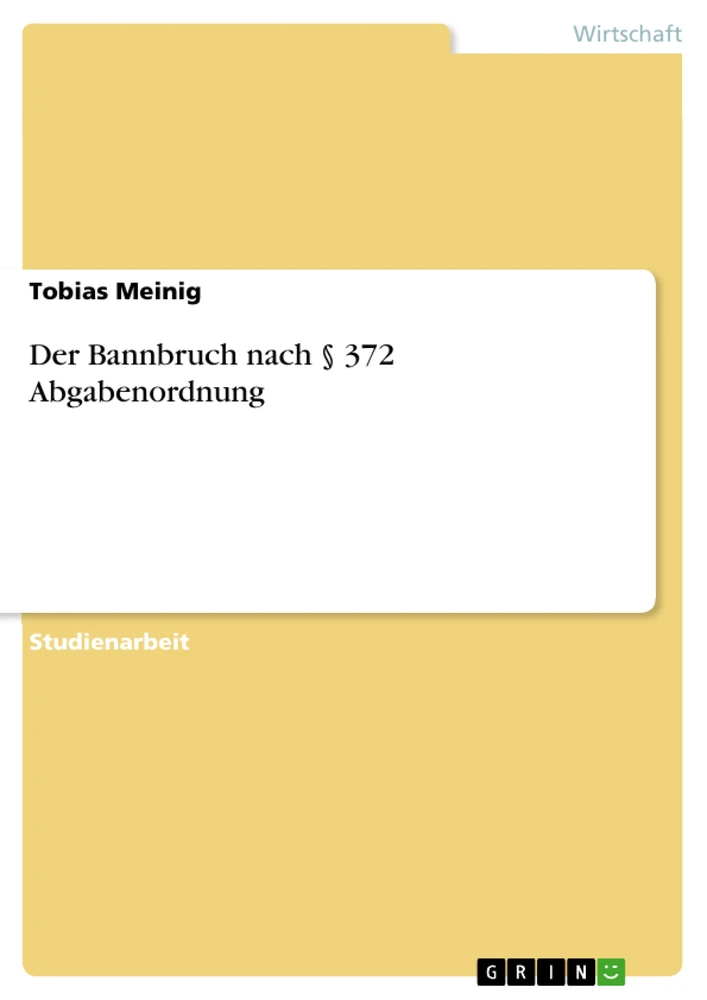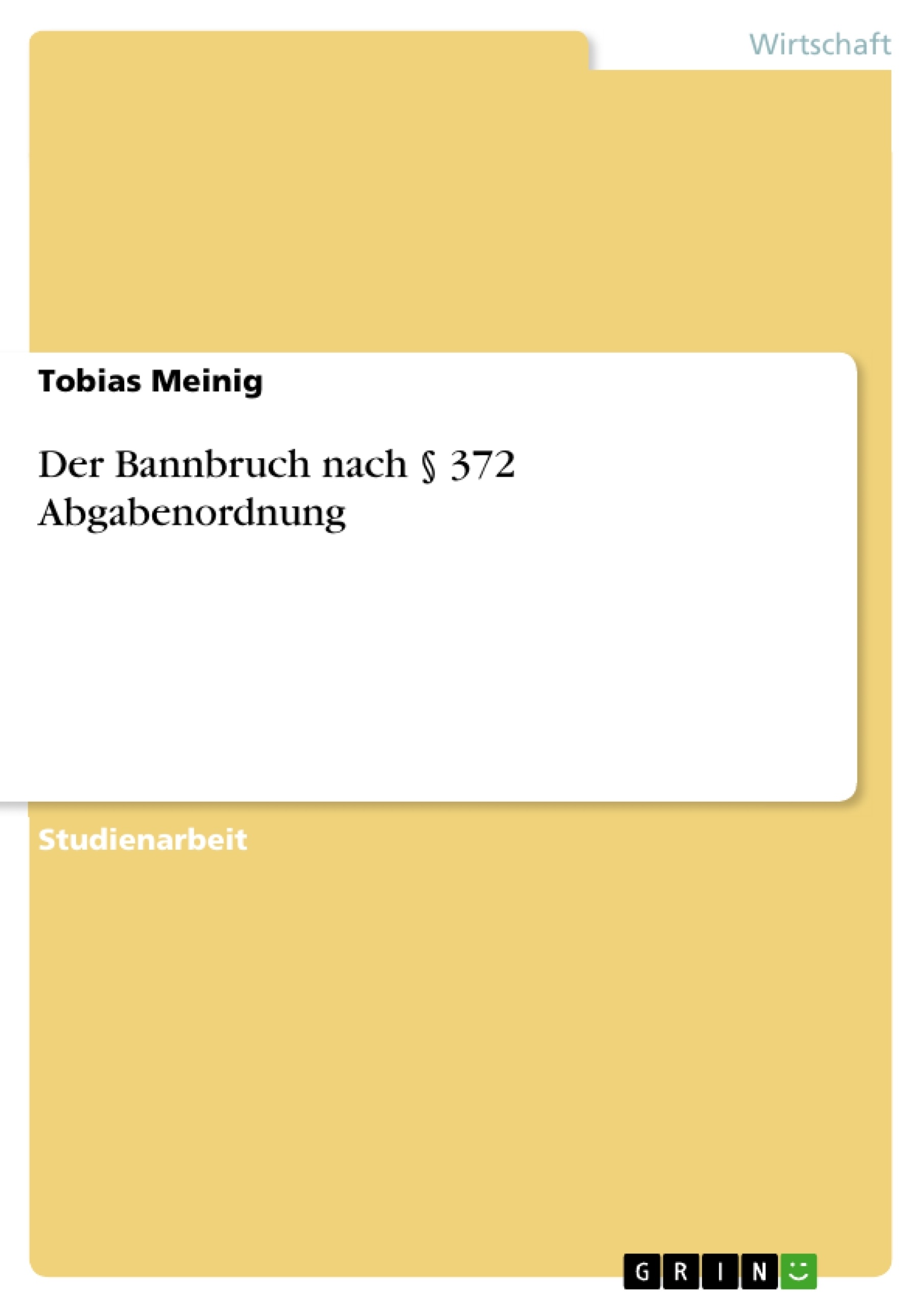Als Folge des 30-jährigen Krieges war das ehemalige einheitliche deutsche Zollgebiet in ca. 1.240 Einzelgebiete zerfallen. Im 17./18. Jahrhundert wuchs neben den Finanzzöllen die Bedeutung der Zölle als sogenannte Schutzzölle vor ausländischer Konkurrenz. Mit Hilfe der Erhebung von Einfuhrzöllen auf möglicherweise billigere ausländische Waren blieb die Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Waren gewahrt. Das nunmehr existierende Grenzzollsystem zwischen den deutschen Staaten führte jedoch zu einer starken Behinderung des Wirtschaftsverkehrs. Dieses System wurde schrittweise zum 1. Januar 1834 durch den Deutschen Zollverein zugunsten gemeinsamer Außenzölle abgebaut .
Dieses Prinzip hat bis zur Gegenwart an Aktualität nichts eingebüßt. Auch heute gilt es, mit der Erhebung und Sicherung von Einfuhrabgaben in Form der Einfuhrumsatzsteuer gleiche umsatzsteuerliche Wettbewerbsbedingungen für die im Inland hergestellten Gegenstände zu sichern.
Das als Reichsgesetz ausgestaltete einheitliche deutsche Vereinszollgesetz (VZollG) vom 1. Juli 1869 definiert die beiden Zollvergehen Konterbande, also die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Gegenständen die einem Verbringungsverbot unterliegen sowie die Zolldefraudation, d. h. die Hinterziehung von Zöllen als die hauptsächlichsten Zollvergehen .
Der Straftatbestand des Bannbruchs wurde schlussendlich aus den §§ 134, 136 Vereinszollgesetz vom 1. Juli 1869 (BGBL. des Norddeutschen Bundes, S. 317) gemäß Art. I Nr. 15 G vom 4. Juli 1939 (RGBL. I 1181) als § 401a in die Reichsabgabenordnung (RAO) übernommen . Die Reichsabgabenordnung (RAO) wiederum wurde mit Inkrafttreten der Abgabenordnung (AO) zum 1. Januar 1977 abgelöst.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung.
- B. Historische Betrachtung.
- C. Qualifizierung als Steuerstraftat...
- I. Voraussetzungen der Straftat.
- II. Bannbruch als Steuerstraftat und Blankettnorm
- III. Subsidiaritätsklausel des Bannbruchs ........
- D. Anwendungsbereich..
- I. Strafverfolgungszuständigkeit der Zollbehörden..
- II. Verstoß gegen Monopolgesetze..
- III. Bannbruch als Strafschärfung für § 373 AO und Vortat zu § 374 AO...
- E. Vollendeter Bannbruch nach § 372 AO.
- I. Objektiver Tatbestand..
- II. Subjektiver Tatbestand
- III. Rechtswidrigkeit..
- IV. Schuld
- F. Versuch und Vorbereitung
- I. Täterschaft und Teilnahme .
- 1. Täterschaft..
- 2. Teilnahme
- G. Rücktritt
- H. Strafausschließungsgründe...
- I. Selbstanzeige
- II. Verfolgungsverjährung
- J. Schlussbetrachtung........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Seminararbeit ist eine tiefgreifende Analyse des Themas Bannbruch nach § 372 Abgabenordnung (AO), die über den Umfang der Vorlesungen Steuerstraf- und Steuerbußgeldrecht hinausgeht. Die Arbeit beleuchtet den Bannbruch im historischen Kontext, qualifiziert ihn als Steuerstraftatbestand und erklärt seine Bedeutung im heutigen Kontext. Darüber hinaus werden die Tatbestandsvoraussetzungen im Rahmen eines dreistufigen Deliktaufbaus untersucht und Ausführung zu Beteiligung und Stadien einer Straftat erörtert.
- Historische Entwicklung des Bannbruchs
- Qualifizierung des Bannbruchs als Steuerstraftat
- Anwendungsbereich und Zweck des Bannbruchs
- Tatbestandsvoraussetzungen des Bannbruchs
- Beteiligung und Stadien einer Straftat
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Betrachtung des Bannbruchs im historischen Kontext, um seine Entwicklung und Bedeutung zu verstehen. Anschließend wird der Bannbruch als Steuerstraftatbestand qualifiziert und die Begriffe Blankettnorm und Subsidiarität erläutert. Der Autor erklärt den Anwendungsbereich des Bannbruchs und erläutert seine aktuelle Bedeutung im Kontext von Strafverfolgungszuständigkeit der Zollbehörden, Verstößen gegen Monopolgesetze und als Strafschärfung für § 373 AO und Vortat zu § 374 AO. Die folgenden Kapitel befassen sich mit den Tatbestandsvoraussetzungen des Bannbruchs, die im Rahmen eines dreistufigen Deliktaufbaus untersucht werden. Dabei werden der objektive und subjektive Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld erörtert. Abschließend werden die Stadien einer Straftat (Versuch und Vorbereitung) und die Tatbeteiligung (Täterschaft und Teilnahme) sowie Strafausschließungsgründe (Selbstanzeige und Verfolgungsverjährung) betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Themenfeld des Steuerstrafrechts und konzentriert sich insbesondere auf die Analyse des Bannbruchs nach § 372 Abgabenordnung (AO). Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Steuerstraftat, Blankettnorm, Subsidiarität, Strafverfolgungszuständigkeit, Monopolgesetze, Verbringungsverbote, Tatbestandsvoraussetzungen, objektiver Tatbestand, subjektiver Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld, Versuch, Vorbereitung, Täterschaft, Teilnahme, Strafausschließungsgründe, Selbstanzeige, Verfolgungsverjährung.
- Quote paper
- Dipl. oec Tobias Meinig (Author), 2009, Der Bannbruch nach § 372 Abgabenordnung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159377