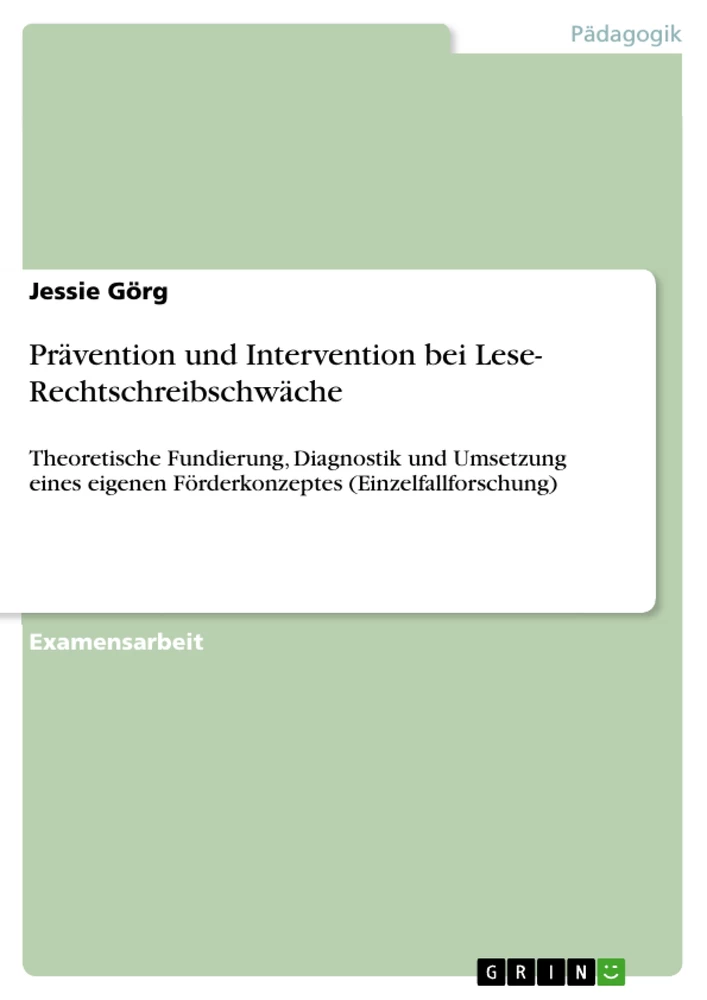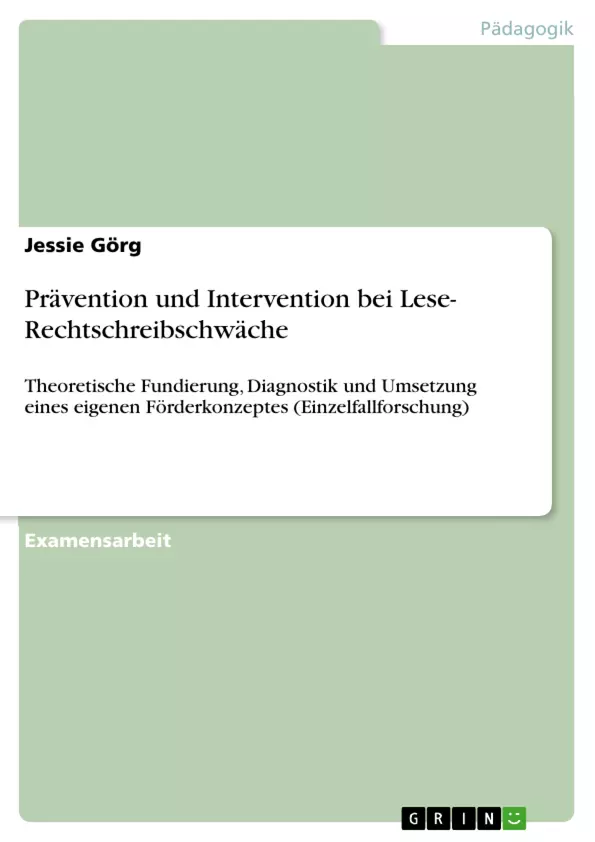In der heutigen, von Schriftlichkeit geprägten Kultur, sind Lese- und Rechtschreibkompetenzen ein wesentlicher Grundstein um den Erwartungen der Bildungsnormen zu entsprechen, Zugang zu Informationen in den verschiedenen Medien zu erhalten und sich adäquat mitteilen zu können. Wichtig sind diese Kompetenzen praktisch zur gesamten gesellschaftlichen Teilhabe. Daher verwundert es nicht, dass der Lese- Rechtschreibunterricht als einer der wichtigsten Bildungsaufträge der Grundschule angesehen wird. Welche Probleme dieser Auftrag möglicherweise mit sich bringt und wie man durch gezielte Lernimpulse eine effektive Hilfestellung bei deren Bewältigung liefern kann, damit beschäftigt sich die vorliegende Arbeit.
Ausgehend von einer Beschreibung des "idealtypischen" Lese- Rechtschreiberwerbs, werden mögliche Stolpersteine sowie die Problematik der Lese- Rechtschreibschwäche (Klassifikation, Störungsbild, Begleiterscheinungen, Epidemiologie, Erklärungsansätze, Diagnostik und Intervention) beschrieben.
Es folgt der empirische Forschungsteil (Einzelfallforschung) mit einer ausführlichen Schülerbeschreibung, der durchgeführten Diagnostik und abgeleiteten Förderplanung. Die durchgeführten Fördereinheiten werden detailliert beschrieben und im Anschluss evaluiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Lernen in der flexiblen Schuleingangsphase
- 2.1. Das Konzept der flexiblen Schuleingangsphase in Nordrhein-Westfalen
- 2.2. Kritische Betrachtung des Konzepts
- 2.3. Umsetzung der flexiblen Schuleingangsphase an der Gemeinschaftsgrundschule Freiligrathstrasse, Köln
- 3. Schritte auf dem Weg zum kompetenten Lesen und Rechtschreiben
- 3.1. Beschreibung der beim Lesen und Schreiben beteiligten Prozesse
- 3.2. Vorläuferfertigkeiten für den erfolgreichen Lese-Rechtschreiberwerb
- 3.3. Schriftspracherwerb (Lesen)
- 3.4. Schriftspracherwerb (Rechtschreiben)
- 3.5. Der Erstlese-/Erstschreibunterricht in der Schule
- 4. Problematik der Lese- Rechtschreibstörung
- 4.1. Begriffserklärung
- 4.2. Klassifikation der Lese- Rechtschreibstörung nach ICD- 10 und DSM-IV
- 4.3. Störungsbilder der Lese- Rechtschreibschwäche
- 4.3.1. Störungsbild des Lesens
- 4.3.2. Störungsbild des Rechtschreibens
- 4.4. Begleiterscheinungen
- 4.5. Epidemiologie
- 4.6. Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung
- 5. Diagnostik umschriebener Lese- Rechtschreibschwäche
- 6. Intervention
- 6.1. Wann besteht Förderbedarf
- 6.2. Ziele einer Intervention
- 6.3. Überblick über bestehende Interventionsverfahren
- 6.3.1. Interventionsverfahren im vorschulischen Bereich
- 6.3.2. Interventionsverfahren im Schulalter
- 7. Bedeutung der Einzelfallforschung für eine derartige Förderung
- 8. Beschreibung des Schülers Max (AV) auf Grundlage von Verhaltensbeobachtungen sowie Anamnesegesprächen mit der Klassenlehrerin und den Eltern
- 9. Diagnosestellung
- 9.1. Beschreibung und Auswertung der durchgeführten Tests zu den Lesefertigkeiten des Schülers
- 9.1.1. Beschreibung und Auswertung des durchgeführten Tests „Buchstabenfangen“
- 9.1.2. Beschreibung und Auswertung des Tests „Lesestufen – Dani hat Geburtstag“
- 9.2. Beschreibung und Auswertung des durchgeführten Tests zu den Schreibfertigkeiten des Schülers - die „Hamburger Schreibprobe“
- 9.3. Beschreibung und Auswertung des durchgeführten Tests zur kognitiven Leistungsfähigkeit des Schülers- Grundintelligenztest Skala 1 (CFT 1)
- 9.4. Zusammenfassende Beschreibung der abhängigen Variablen im Bereich des Lesens und Schreibens
- 9.4.1. Lesen
- 9.4.2. Schreiben
- 10. Erklärungsansätze für die Schwächen des Schülers in den Bereichen Lesen und Schreiben
- 11. Konkretisierung und Planung der Fördermaßnahmen
- 11.1. Arbeitshypothesen für die Förderung des Schülers
- 11.2. Erstellung eines Förderplans
- 11.3. Begründete Auswahl und Beschreibung des Fördermaterials
- 11.3.1. Grundsätzlich Ansprüche an alle verwendeten Fördermaterialien
- 11.3.2. „ABC lernen mit Gedichten, Bildern und Arbeitsblättern“
- 11.3.3. Schreibübungen mit dem Karteikasten
- 11.3.4. Erarbeitung von Ableitungshilfen
- 11.3.5. Arbeitsblätter mit Selbstkontrolle
- 11.3.6. Übungen zur Motorik
- 11.3.7. Weitere Übungen
- 11.4. Kontingenzmanagement
- 12. Dokumentation der durchgeführten Fördereinheiten
- 12.1. Übersicht über die Förderdokumentation
- 12.2. Beschreibung der Einheiten
- 13. Evaluation des Fördererfolgs
- 13.1. Eigene Beobachtungen
- 13.1.1. Bezüglich des Lern- und Arbeitsverhaltens
- 13.1.2. Bezüglich der Motorik
- 13.1.3. Bezüglich der Leseleistungen des Schülers
- 13.1.4. Bezüglich der Rechtschreibleistungen des Schülers
- 13.2. Auswertung des Retests HSP 1+
- 13.3. Beobachtungen der Klassenlehrerin
- 14. Abschließende Beurteilung der formulierten Arbeitshypothesen
- 15. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Prävention und Intervention bei einem Schüler mit Lese-Rechtschreibschwäche in der flexiblen Schuleingangsphase. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der spezifischen Bedürfnisse des Schülers und der Entwicklung eines individuellen Förderplans.
- Das Konzept der flexiblen Schuleingangsphase in Nordrhein-Westfalen
- Die Diagnostik von Lese-Rechtschreibschwäche
- Individuelle Fördermaßnahmen für Schüler mit Lese-Rechtschreibschwäche
- Die Bedeutung der Einzelfallforschung
- Die Evaluation des Fördererfolgs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Hausarbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext und die Relevanz der Thematik einleitet. Anschließend wird das Konzept der flexiblen Schuleingangsphase in Nordrhein-Westfalen erläutert, sowohl in Bezug auf seine Stärken als auch auf seine Schwächen. Im dritten Kapitel werden die grundlegenden Prozesse des Lesens und Schreibens beschrieben, sowie die Vorläuferfertigkeiten, die für einen erfolgreichen Lese-Rechtschreiberwerb notwendig sind. Kapitel 4 behandelt die Problematik der Lese-Rechtschreibstörung, einschließlich Definition, Klassifikation, Störungsbilder, Begleiterscheinungen, Epidemiologie und Entstehung. In Kapitel 5 wird die Diagnostik umschriebener Lese-Rechtschreibschwäche näher beleuchtet. Kapitel 6 befasst sich mit der Intervention und beschreibt verschiedene Interventionsverfahren im vorschulischen und schulischen Bereich.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit behandelt die Themenschwerpunkte Prävention und Intervention bei einem Schüler mit Lese-Rechtschreibschwäche in der flexiblen Schuleingangsphase. Wichtige Schlüsselwörter sind Lese-Rechtschreibstörung, Diagnostik, Intervention, Förderplan, Einzelfallforschung, Evaluation, flexible Schuleingangsphase, Vorläuferfertigkeiten, Schriftspracherwerb.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die flexible Schuleingangsphase in Nordrhein-Westfalen?
Es ist ein Konzept, das Kindern ermöglicht, die ersten beiden Schuljahre je nach Lerntempo in einem, zwei oder drei Jahren zu absolvieren.
Wie wird eine Lese-Rechtschreibstörung (LRS) klassifiziert?
Die Arbeit bezieht sich auf die Klassifikationen nach ICD-10 und DSM-IV, um Störungsbilder und Begleiterscheinungen wissenschaftlich einzuordnen.
Welche Vorläuferfertigkeiten sind wichtig für den Leseerwerb?
Dazu gehören unter anderem die phonologische Bewusstheit, die auditive Wahrnehmung und grundlegende kognitive Fähigkeiten.
Welche diagnostischen Tests werden in der Fallstudie genutzt?
Eingesetzt wurden unter anderem die „Hamburger Schreibprobe“ (HSP), der Test „Lesestufen“ und der Grundintelligenztest (CFT 1).
Was umfasst ein individueller Förderplan bei LRS?
Der Plan beinhaltet spezifische Materialien wie Schreibübungen mit dem Karteikasten, Ableitungshilfen, Übungen zur Motorik und Kontingenzmanagement.
Wie wird der Erfolg der Fördermaßnahmen evaluiert?
Die Evaluation erfolgt durch eigene Verhaltensbeobachtungen, Rückmeldungen der Klassenlehrerin sowie durch standardisierte Retests (z.B. HSP).
- Arbeit zitieren
- Jessie Görg (Autor:in), 2008, Prävention und Intervention bei Lese- Rechtschreibschwäche, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159412