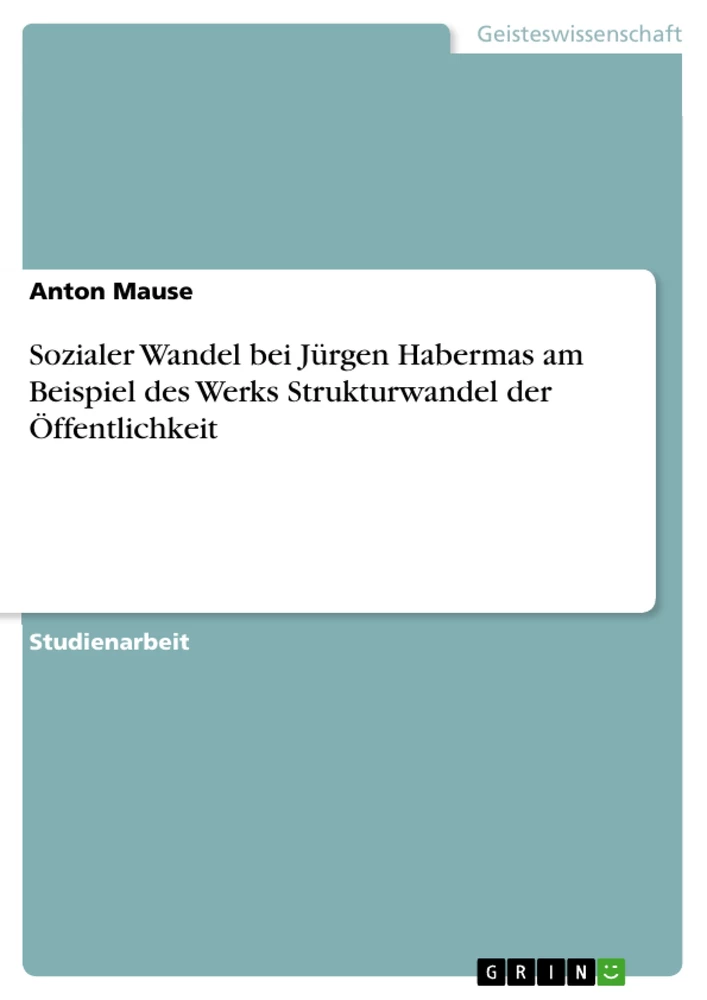Im Folgenden soll das Thema Sozialer Wandel nach Habermas diskutiert werden, am Beispiel des Werkes „Strukturwandel der Öffentlichkeit“. Es wird Hauptsächlich des Werkes „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ von Jürgen Habermas zu Grunde gelegt. Es wird die Auflage von 1990 verwendet, bei der Habermas ein neues Vorwort hinzugefügt hat. Aufgrund der großen Fülle von Sekundärliteratur von Befürwortern und Gegnern des Werkes „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ wird diese nicht mitbetrachtet. Die Arbeit gliedert sich in 5 Teile. Nach dem Vorwort wird in Punkt 2 auf den Begriff der Öffentlichkeit eingegangen. Der Begriff wird wie bei Habermas historisch hergeleitet. In Punkt 2.1 wird der Idealtypus der bürgerlichen Öffentlichkeit vorgestellt. Strukturwandel der Öffentlichkeit nach Habermas wird in Punkt 3 der Arbeit erläutert, im Anschluss wird in Punkt 4 auf die Revisionen im Vorwort der Auflage von 1990 eingegangen. Es wird nur auf die Revisionen eingegangen, die für die Fragestellung der Arbeit Bedeutung haben. Im letzten Teil der Arbeit wird sozialer Wandel definiert und es wird am Beispiel der Einführung des Mindestlohnes im Pflegebereich sozialer Wandel mit der Theorie „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ erklärt. Außer Acht gelassen wird die negative Einschätzung von Habermas, dass es eine Aufhebung der bürgerlichen Öffentlichkeit gibt. Vielmehr werden die Vorbemerkungen aus dem Vorwort von 1990 zugrunde gelegt, indem Habermas seine pessimistischen Schlussfolgerungen zum Teil neu bewertet. Zum besseren Verständnis einige Daten zur Biographie Habermas: Jürgen Habermas wurde am 18.06.1929 geboren. Im Jahr 1961 habilitierte Habermas mit der Schrift „Strukturwandel der Öffentlichkeit“. In den Jahren 1964 - 1971 hatte er eine Professur für Philosophie und Soziologie an der Universität Frankfurt/Main inne, bevor er 1971 – 1983 Direktor des Max-Planck-Instituts war. In den Jahren 1983 – 1994 kehrte er als Professor für Philosophie nach Frankfurt/Main mit dem Schwerpunkt Sozial- und Geschichtsphilosophie zurück.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einordnung des Begriffs Öffentlichkeit
- Idealtypus der Bürgerlichen Öffentlichkeit
- Strukturwandel der Öffentlichkeit
- Politischer Funktionswandel
- Revision im Vorwort 1990
- Sozialer Wandel
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema des Sozialen Wandels im Kontext der Theorie Jürgen Habermas', insbesondere am Beispiel seines Werkes "Strukturwandel der Öffentlichkeit". Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert, analysiert den Strukturwandel der Öffentlichkeit und beleuchtet die Revisionen, die Habermas in seinem Vorwort von 1990 vorgenommen hat. Des Weiteren wird der Begriff des Sozialen Wandels definiert und am Beispiel des Mindestlohnes im Pflegebereich erläutert.
- Die Entstehung und Entwicklung der bürgerlichen Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert
- Der Strukturwandel der Öffentlichkeit nach Habermas
- Die Revisionen im Vorwort von 1990
- Die Definition des Sozialen Wandels
- Die Anwendung der Theorie "Strukturwandel der Öffentlichkeit" auf den Sozialen Wandel
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und benennt das Hauptthema: Sozialer Wandel nach Habermas am Beispiel des Werkes "Strukturwandel der Öffentlichkeit". Es wird die verwendete Auflage des Werkes (1990) und der Fokus der Arbeit auf die Revisionen des Vorworts erwähnt. Der Aufbau der Arbeit wird in fünf Teile gegliedert.
Einordnung des Begriffs Öffentlichkeit
Dieses Kapitel untersucht den Begriff der Öffentlichkeit im allgemeinen Sprachgebrauch und in verschiedenen wissenschaftlichen Kontexten. Es wird die historische Entwicklung des Begriffs ab dem 18. Jahrhundert und die Unterscheidung zwischen Öffentlichkeit und Privatheit dargestellt.
Idealtypus der bürgerlichen Öffentlichkeit
Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung der bürgerlichen Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert, die Entwicklung von der Privatsphäre der Familie hin zu öffentlichen Versammlungen in Städten. Es werden die charakteristischen Merkmale der Versammlungen, die Entstehung von Zeitungen und Zeitschriften sowie die Entwicklung des politischen Bewusstseins der Bürger beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit sind: Öffentlichkeit, Strukturwandel, Bürgerliche Gesellschaft, Sozialer Wandel, Habermas, "Strukturwandel der Öffentlichkeit", Idealtypus, Politischer Funktionswandel, Revision, Mindestlohn im Pflegebereich.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ nach Habermas?
Es beschreibt den historischen Prozess der Entstehung der bürgerlichen Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert und deren späteren Funktionswandel in modernen Gesellschaften.
Was kennzeichnet den Idealtypus der bürgerlichen Öffentlichkeit?
Der Idealtypus umfasst die Trennung von Privatheit und Öffentlichkeit, rationale Debatten in Städten sowie die Rolle von Zeitungen bei der Bildung eines politischen Bewusstseins.
Welche Revisionen nahm Habermas 1990 vor?
In der Neuauflage bewertete Habermas seine ursprünglich pessimistischen Schlussfolgerungen zur Aufhebung der bürgerlichen Öffentlichkeit teilweise neu.
Wie wird sozialer Wandel in dieser Arbeit definiert?
Sozialer Wandel wird als Veränderung gesellschaftlicher Strukturen definiert und am praktischen Beispiel der Einführung des Mindestlohns im Pflegebereich erläutert.
Welche Rolle spielt die Unterscheidung zwischen Öffentlichkeit und Privatheit?
Diese Unterscheidung ist zentral für Habermas' Theorie, da sie den Raum definiert, in dem Bürger als Privatleute zusammenkommen, um öffentliche Angelegenheiten zu diskutieren.
- Quote paper
- Anton Mause (Author), 2010, Sozialer Wandel bei Jürgen Habermas am Beispiel des Werks Strukturwandel der Öffentlichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159416