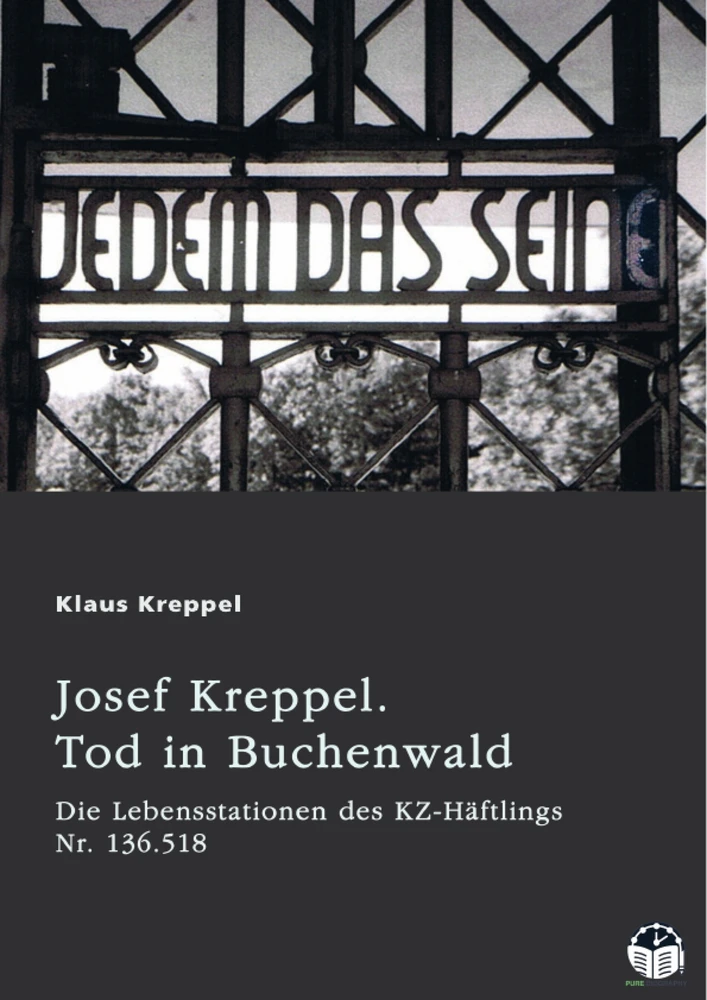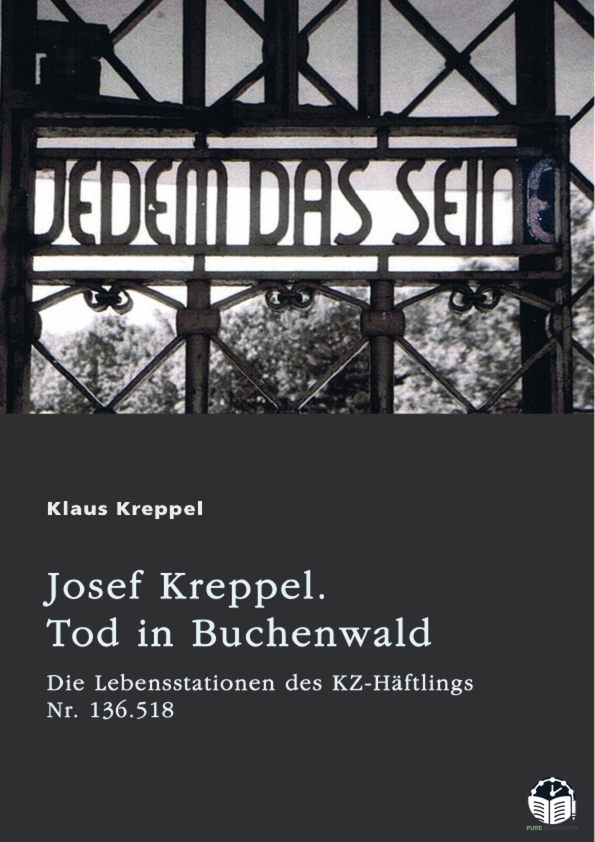Wenige Tage vor der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald, Ende März 1945, stirbt dort, geschwächt und entkräftet durch Gestapo-Misshandlungen und miserable hygienische Zustände, der Rechtsanwalt und Notar Josef Kreppel aus Usingen.
Kreppel hatte 1932/33 vorübergehend der NSDAP angehört, war aber wegen abweichenden Verhaltens aus der Partei ausgeschlossen worden. Seitdem übte er über Jahre hindurch scharfe Kritik an lokalen NSDAP-Funktionären, verweigerte den "Hitler-Gruß", zeigte sich in der Öffentlichkeit mit Kommunisten und kaufte beim jüdischen Fleischer ein. Auch die örtlichen Behörden verwickelte er in juristische und ideologische Streitigkeiten, die mit mehreren Disziplinarverfahren geahndet wurden.
Kreppel erhielt 1942 Berufsverbot, 1944 wurde er in Gestapo-Haft genommen und im März 1945 als "politischer Häftling" mit der Nummer 136.518 nach Buchenwald überführt, wo er innerhalb von zwei Wochen verstarb.
Klaus Kreppel, Dr. phil., Historiker und entfernter Verwandter, zeigt in einer biografischen Skizze auf, welches menschliche Schicksal sich hinter einem von 280.000 Gefangenen und 55.000 Toten des Konzentrationslagers in der Nähe von Weimar verbirgt.
Einleitung
Am 16. März 1945 – so dokumentiert diese Häftlings-Personal-Kartei – wurde der Usinger Rechtsanwalt und Notar Josef Kreppel, 63 Jahre alt, durch die Gestapo Frankfurt am Main als „politischer Häftling“ in das Konzentrationslager Weimar-Buchenwald eingeliefert.[1] Kreppel war ein Meter siebzig groß und bei seiner Ankunft von ziemlich „schwächlicher“ Gestalt. Am Tag der Aufnahme wog er mit Kleidung 56 kg. Während der Aufnahmeprozedur musste er in der Effektenkammer Folgendes abgeben und durch Unterschrift bestätigen: 1 Hut, 1 Mantel, 1 Rock, 1 Weste, 1 Hose, 1 Unterhemd, 1 Unterhose, 1 Paar Schuhe und 1 Paar Stiefel.[2] Seine Zivilkleidung musste Josef Kreppel durch eine gestreifte Uniform mit der Häftlingsnummer 136.518 austauschen. Zwei auf der Spitze stehende rote Stoffdreiecke waren an der Jacke und am Hosenbein befestigt. Dieser „rote Winkel“ kennzeichnete ihn als „Politischen“ und unterschied ihn von den übrigen Häftlingsgruppen des Konzentrationslagers. Zu den „Politischen“ gehörten ehemalige Mitglieder gegnerischer Parteien, v.a. Kommunisten, Sozialdemokraten und Zentrumsleute, aber auch politisch abweichende NSDAP-Mitglieder, desertierte Wehrmachtsangehörige und „Schwarzhörer, Meckerer und Leute, die auf rein persönliche Denunziation hin unter die Räder der Gestapo geraten waren“.[3] Zur letzten Gruppe dürfte Josef Kreppel gehört haben. Zugewiesen wurde er dem zweigeschossigen „Block 41“, den er mit über 600 Insassen, überwiegend russischen Kriegsgefangenen[4], teilte. Seit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 wurden Tausende russischer Kriegsgefangener in Buchenwald inhaftiert und zwischen 7.000 und 9.500 durch Massenerschießungen umgebracht. Etwa 800 Russen überlebten die Lagerhaft.[5]

Abb.1. Personalkarte Josef Kreppel Buchenwald 1945
Sechs Tage nach seiner Einlieferung, am 22. März 1945, klagte Josef Kreppel über „starke Leibschmerzen“ und „blutigen Durchfall“. Nachdem ein Lagerarzt „infektiösen Magen- und Darmkatarrh“ diagnostiziert hatte, wurde Kreppel in den „Krankenbau“ verlegt. Hier muss sich sein Zustand wegen der katastrophalen hygienischen Zustände innerhalb von sechs Tagen verschlimmert haben.[6] Am Mittwoch, dem 28. März 1945 um 9:45 Uhr, trat der Tod – offiziell durch „Herzschwäche bei infektiösem Magen-Darmkatarrh“[7] – ein. Josef Kreppel starb genau zwei Wochen vor der Befreiung des Lagers am 11. April 1945 durch eine „konzertierte Aktion“ von innen und von außen. Als sich die amerikanischen Truppen dem Lager näherten, entwaffneten aufständische Häftlinge die restlichen SS-Mannschaften und übergaben sie den Amerikanern.[8] Vier Wochen später, am 8. Mai 1945, hatte Nazi-Deutschland endgültig kapituliert.
1. Der vergessene Josef Kreppel
Josef Kreppel war unverheiratet und kinderlos geblieben, seine einzige Schwester bereits früh verstorben und auch seine Eltern waren schon längere Zeit tot. Auf der „Effekten-Karte“ des Lagers Buchenwald war lediglich ein Cousin mütterlicherseits, Josef Corten (1883-1961) aus St. Tönis bei Krefeld, als naher Angehöriger registriert.[9] Möglicherweise war er es, der sich im Jahre 1946 an das „Komitee ehemaliger politischer Gefangener“ mit Sitz in Hamburg wandte, da auch zwei Jahre nach Kreppels Verhaftung durch die Gestapo noch immer jegliche Nachricht über das Verbleiben des Vetters fehlte. Mit Sicherheit hat auch ein amerikanischer Vetter, Johannes (John) Corten (1877-1981) auf der Suche nach seinem vermissten Cousin Josef Kreppel bei den US-Besatzungsbehörden vorgesprochen.[10] Dokumentiert ist jedenfalls, dass der Suchdienst dieses Hamburger Komitees sich am 17. Oktober 1946 an die zuständigen deutschen und amerikanischen Behörden wandte, um Auskunft „über den weiteren Verbleib des Vermissten“ zu erhalten.[11]
Am 21. November 1944 sei Josef Kreppel durch die Gestapo Frankfurt/M „wegen staatsfeindlicher Äußerungen und Verdächtigung, mit den Männern des 20. Juli 1944 in Verbindung gestanden zu haben“, in das Polizeigefängnis Klapperfeld eingeliefert worden.[12] Das „Klapperfeld“ galt seit 1933 als berüchtigte Haftanstalt für politische Gegner des NS-Regimes und für Menschen, die aus rasse-ideologischen Gründen verfolgt wurden. Auf dieser Zwischenstation zu einem Konzentrationslager waren Folter, Drill, Verhöre, Schlafentzug und Essenreduzierung an der Tagesordnung. Josef Kreppel verbrachte hier nahezu vier Monate. Seine auf obiger Karteikarte registrierte „schwächliche Gestalt“ dürfte auf die unmenschlichen Haftbedingungen im „Klapperfeld“ zurückzuführen sein. Kurz vor dem Einmarsch der US-Armee in Frankfurt im März 1945 bereitete die Gestapo die Räumung des „Klapperfeldes“ vor.[13] Mit den übrigen Gestapo-Häftlingen wurde Josef Kreppel am 16. März nach Buchenwald überführt.
Die Daten der Einlieferung nach Buchenwald bestätigte zunächst das amerikanische „Bureau of Documents and Tracing“, ohne jedoch Hinweise oder Kenntnisse von Josef Kreppels weiterem Schicksal gefunden zu haben. Das exakte Todesdatum – in der Häftlings-Kartei ist der 28. März 1945 registriert – war den Behörden zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Anfang 1948 wurde Josef Kreppel auf Antrag des Verwandten Ferdinand Corten[14] aus Moers für tot erklärt.[15] Das mutmaßliche Todesdatum – es war noch immer nicht korrekt – wurde vom Amtsgericht Usingen auf den 5. März 1945 festgelegt.[16] Auch dieser Behörde hatte noch immer nicht die Häftlingskartei vorgelegen. Ab 1946 waren alle noch verbliebenen Akten des Konzentrationslagers Buchenwald zwar beim „International Tracing Service“ (ITS) in Bad Arolsen deponiert worden, aber erst im Jahre 1952 konnte der ITS Auskunft über Kreppels genaues Todesdatum, nämlich den 28. März 1945, geben. Die Verzögerung lässt sich dadurch erklären, dass im ITS etwa 30 Millionen Dokumente von mehr als 17 Millionen ziviler Opfer der NS-Herrschaft deponiert, archiviert und allmählich für Suchdienste und wissenschaftliche Forschungen freigegeben wurden.
Zwischenzeitlich interessierten sich auch die Justizbehörden im Rahmen der Entnazifizierungs-Verfahren für die „Causa Kreppel“. Der „Erste Öffentliche Kläger“ bei der Spruchkammer Frankfurt am Main ersuchte im Jahre 1950 das dortige Oberlandesgericht um „kurzfristige Überlassung der Personalakte über den Rechtsanwalt und Notar Kreppel aus Usingen“.[17] Spruchkammern wurden auf der Basis des „Befreiungsgesetzes“[18], das 1946 vom „Länderrat“ in der US-Zone verabschiedet worden war, mit unbescholtenen deutschen Laien und einem zum Richteramt befähigten „Öffentlichen Kläger“ eingerichtet, um alle volljährigen Bewohner der US-Zone, etwa 13 Millionen, zu entnazifizieren. Sie wurden bei diesem Verfahren in vier Tätergruppen (1. Hauptschuldige, 2. Belastete, 3. Minderbelastete, 4. Mitläufer) und eine Entlasteten-Gruppe eingeteilt. Die Akte des KZ-Opfers Kreppel wurde offensichtlich für das Entnazifizierungsverfahren eines oder mehrerer Personen benötigt, die an der Denunziation oder Inhaftierung Kreppels beteiligt waren, im Beamtendeutsch: „um die eventuelle Schuld an seiner [d.h. Kreppels] Verbringung in ein Konzentrationslager“ zu klären.[19]

Anderthalb Jahre nach Anforderung durch die Frankfurter Spruchkammer war die Personalakte (P.A.) Kreppel an die dortige Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden. Ihre Rückgabe verzögerte sich, da „die Ermittlungen außerordentlich schwierig“ seien, […] „mit Rücksicht darauf, dass die P.A. Schriftstücke enthalte, in denen persönliche Spannungen zum Ausdruck kommen, die wiederum Hinweise für die Ermittlungen ergeben […]“.[20] Offenbar sollte ein Personenkreis aus der Partei-, Staats- oder Justizbürokratie, die am politischen Kriminalisierungsprozess Josef Kreppels beteiligt waren, „entlastet“ werden, indem man die Schuld an Kreppels späterer Inhaftierung im Frankfurter Gestapo-Gefängnis und im KZ-Buchenwald in der Lebensführung oder in einer konkreten Straftat des Opfers selbst suchte – ungeachtet der Erkenntnis, dass die nationalsozialistischen Willkürakte der Verhaftung und möglichen Misshandlungen nichts mit einem rechtsstaatlich legitimen Freiheitsentzug gemein hatten, der richterlich angeordnet, zeitlich befristet und durch Rechtsmittel anfechtbar sein musste. Über das oder die konkreten Verfahren der Frankfurter Spruchkammer und ihre Entscheide liegen dem Verfasser dieses Textes bisher keine Dokumente vor.[21] Die „Causa Kreppel“ war erst nach einem weiteren Jahr abgeschlossen. Die Personalakte wurde mit dem Vermerk „Aufbewahren bis 1983“ „weggelegt“.
Josef Kreppel geriet in Vergessenheit. Erst 70 Jahre später hat der Verfasser Josef Kreppels Namen im Totenbuch von Buchenwald entdeckt,[22] gleich neben den Namen der jüdischen Opfer Jonas Kreppel[23] und Leibisch Kreppel.[24] Nachdem deren Todesumstände näher erforscht worden waren[25], lag es nahe, auch das Schicksal Josef Kreppels für die Familiengeschichte aufzuarbeiten. Er entstammte einer alteingesessenen Schultheißenfamilie aus Erbach bei Camberg, deren Verzweigungen noch heute im „Goldenen Grund“ leben und der auch der Verfasser dieser Studie entstammt.
1.1. Auf der Suche nach Josef Kreppel
Wer war Josef Kreppel; was war der wirkliche Grund und Anlass seiner Inhaftierung in das Frankfurter Gestapogefängnis und für den anschließenden Transfer in das Konzentrationslager Buchenwald noch in den letzten Kriegswochen; was für ein menschliches Schicksal verbirgt sich hinter der Häftlingsnummer 136.518?
Zu Antworten auf diese Fragen ging der Verfasser auf die Suche nach verschollenen Informationen und Quellen.
Im Totenbuch von Buchenwald waren inzwischen das Geburts- und Todesdatum, der Geburtsort und die Häftlingsnummer von Josef Kreppel verzeichnet. Dem Hinweis auf seinen Herkunftsort, Viersen, ging der Verfasser nach. Dort wurde in einer „Virtuellen Gedenkstätte“ für die Opfer der NS-Zeit (Stand 30.5.2022) sein Tod in Buchenwald mit seinem vermeintlichen „jüdischen Glauben“ in Verbindung gebracht.[26] Demnach wäre er möglicherweise dem jüdischen Zweig der europäischen Kreppel-Familie zuzuordnen gewesen. Doch Josef Kreppels niederrheinischer Geburtsort war durch familiengeschichtliche Forschungen der katholischen nassauischen Kreppel schon lange ein Begriff. Dorthin war bereits Ende des 19. Jahrhunderts der Bauhandwerker Sebastian Kreppel (*1889) aus der Linie Niklas Kreppel „abgewandert“.[27] Limburg an der Lahn und Bad Camberg im Taunus mit seinen heutigen Ortsteilen Erbach und Oberselters sind die historischen Ursprungssorte der „nassauischen“ Familie Kreppel. Über eine mittelalterliche Heer- und Handelsstraße, die der heutigen Bundesstraße 8 entspricht, war der nassauische Zweig mit dem „fränkischen“ Kreppel-Zweig verbunden, die beide zusammen ihren Familiennamen vom vermutlichen Ursprungsort Kreppling bei Nürnberg herleiten. Vom Dorf Kreppling ausgehend gründeten vermutlich fränkische Kolonisten einst den schlesischen Kreppelhof bei Landeshut. Kreppelhof gilt auch als mutmaßlicher Herkunftsort der jüdischen Kreppel-Familie, die sich weiter östlich in Galizien niederließ.[28]
Über das Kreisarchiv Viersen erhielt der Verfasser dieser Studie Auszüge aus dem Personenstandsregister. Matthias Josef Kreppel – so der volle Name – war demnach nicht jüdischer Herkunft, sondern katholisch getauft.[29] Er entstammte auch nicht der mir bekannten Handwerkerfamilie aus Oberselters. Josefs Vater, ebenfalls Joseph mit Vornamen, war zwar „Hauptlehrer“ in Viersen – allerdings entstammte er auch einer Familie aus dem „Goldenen Grund“ und war 1851 in Erbach bei Camberg als Sohn eines „Ackerers“ (aus dem Zweig Hans Hilgart)[30] geboren und offensichtlich der Liebe zu seiner späteren Ehefrau Gertrud Krienen, geboren 1856 in St. Toenis, ins Rheinland verzogen.
Der nachträgliche Vermerk in Matthias Josef Kreppels Geburtsurkunde, dass er vom Amtsgericht Usingen im Jahre 1947 für tot erklärt und sein amtliches Todesdatum auf den 5.3.1945 festgelegt wurde, und der Hinweis auf Informationen des „Arolsen-Archivs“ aus dem Jahre 1952 bestärkten den Verfasser in der Annahme, dass es sich bei dem 1881 geborenen Matthias Josef Kreppel um dieselbe Person handelt, die am 28.3.1945 im KZ Buchenwald umgekommen war. Die individuellen Häftlingsunterlagen aus Buchenwald sind im „International Center of Nazi Persecution – Arolsen Archives“ einsehbar.[31] Das in den dortigen Unterlagen angegebene Geburtsdatum „13. Mai 1881“ beruhte offensichtlich auf einem Hörfehler („dreizehn“ statt „dreißig“) während des überstürzten Aufnahmeverfahrens in das überfüllte Konzentrationslager im März 1945.[32] Zu diesem Zeitpunkt befanden sich etwa 80.000 Häftlinge im Lager, das im Jahre 1937 für ursprünglich 8.000 Häftlinge gegründet worden war. Josef Kreppel war einer von 240.000 männlichen Gefangenen, die im Laufe dieser acht Jahre in Buchenwald gefangen gehalten wurden, und einer von 56.000 Menschen, die dort ihr Leben verloren haben.[33]
Weitere Internetrecherchen führten den Verfasser zum Universitätsarchiv Freiburg[34] und zum Hessischen Hauptstaatsarchiv, das Kopien aus drei Personalakten aus der Zeit von 1903 bis 1952 freundlicher Weise zur Verfügung stellte.[35] Über weitere Internetrecherchen gelang es schließlich, den Kontakt zu den Nachkommen von Josef Kreppels Verwandten mütterlicherseits, der Familie Corten, herzustellen, die einige wichtige biografische Hinweise geben konnten.[36] Schließlich konnte der Verfasser über Veröffentlichungen von und über Dr. Horst Zimmermann und den Historischen Verein in Usingen erfahren, welchen Platz Josef Kreppel als Gegner des Nationalsozialismus im lokalen historischen Gedächtnis einnimmt.[37] Das gesamte bisher gefundene Datenmaterial bildet die Grundlage der folgenden biographischen Skizze.
1.2. Herkunft und Bildungsgang
Matthias Josef Kreppel wurde am 30. Mai 1881 in Viersen geboren. Er hatte noch eine jüngere Schwester, Maria, die am 17. Juni 1883 geboren wurde und bereits mit 23 Jahren, am 13. Juli 1906, verstarb. Der frühe Tod der Schwester muss Josef sehr belastet haben, ebenso eine schwere Erkrankung des Vaters, der großen Wert auf die gymnasiale Ausbildung des Sohnes und sein späteres berufliches Fortkommen legte. Dem Vater Joseph Kreppel (*1851) war der Weg zu sozialem Aufstieg einst über das katholische Lehrerseminar in Montabaur geebnet worden.[38]
Matthias Josefs erhaltene Lebensläufe beziehen sich ausschließlich auf seinen Bildungsgang. Seine sieben Oberschuljahre verteilten sich ab Eintritt in die Quarta im Jahre 1893 auf das Gymnasium Mönchen-Gladbach (1 ¾ Jahre), das Realgymnasium Viersen (3 ½ Jahre) und das humanistische Gymnasium zu Kempen (2 ¼ Jahre). Hier bestand Josef Kreppel Ostern 1900, also mit 19 Jahren, das Abitur. Sein Reifezeugnis zeigte überwiegend befriedigende (damals als „genügend“ qualifizierte) Leistungen in der Religionslehre, der deutschen Literatur und in den alten Sprachen Latein, Griechisch und Hebräisch und in den Fächern Mathematik und Physik. Die Fächer Geschichte und Erdkunde zeigten Lücken. Die Ergebnisse im Fach Französisch wurden mit „gut“ bewertet. Im Reifezeugnis war außerdem vermerkt, dass Josef Theologie zu studieren beabsichtigte.



Zum Sommersemester 1900 wurde Josef Kreppel an der Universität Bonn im Fach Rechtswissenschaften immatrikuliert. Im Sommersemester 1901 war er an der Universität Freiburg und im Wintersemester 1901/1902 an der Berliner Universität, ebenfalls an den juristischen Fakultäten, eingeschrieben, ehe er nach Bonn zurückkehrte, um sich nach weiteren zwei Semestern, im Mai 1903, beim Oberlandesgericht (OLG) Köln zur Ersten Juristischen Prüfung anzumelden. Diese wurde im Dezember 1903 mit dem Prädikat „glatt ausreichend“ bestanden. Nun begann ein zunächst vierjähriger juristischer Vorbereitungsdienst von Januar 1904 bis Januar 1908.
Josef Kreppel war inzwischen 22 Jahre alt. Als Referendar erhielt er keinen Unterhaltszuschuss von seinem Dienstherrn. Sein Vater, der Hauptlehrer Joseph Kreppel, musste sich schriftlich verpflichten, „seinen Sohn Josef während seiner Vorbereitungszeit, jedenfalls in den nächsten fünf Jahren, standesgemäßen Unterhalt“ zu gewähren.[39]


Zwischenzeitlich erhielt Josef Kreppel auch seinen Musterungsbescheid (vom 16. Mai 1905), nach dem er als Wehrpflichtiger bis zum 39. Lebensjahr „dem Landsturm ersten Aufgebots zum Dienst ohne Waffe überwiesen“[40] wurde. Die medizinischen oder psychologischen Gründe werden nicht genannt. Jedoch ist anzunehmen, dass Josef Kreppels später erwähnte Seh- und Hörschwäche[41] bereits in jungen Jahren ausgeprägt waren. Vom „Dienst ohne Waffe“ wurde er offensichtlich für die Dauer seines Vorbereitungsdienstes zurückgestellt. Denn in seiner Zulassung zur „Großen Staatsprüfung“ im März 1908 wird vermerkt, dass er „nicht gedient“ habe.[42]
Trotz befriedigender Vorzensuren fiel Josef Kreppel durch die Zweite Staatsprüfung und wurde für ein weiteres halbes Jahr zur besseren Vorbereitung auf die Wiederholungsprüfung dem OLG Düsseldorf zugewiesen.[43] Vor allem sollte er seine Fähigkeiten im juristischen Beweisverfahren durch „Referieren“ üben. Ein Gesuch vom 21.11.1908 um Zuweisung an das Amtsgericht seines neuen Wohnortes Köln wurde „mit Rücksicht auf die große Zahl der im dortigen Bezirke […] beschäftigen Referendare“[44] abschlägig beschieden. So musste er täglich nach Düsseldorf pendeln, um seinen Dienst zu verrichten. Die Wiederholungsprüfung im Jahre 1909, für die Josef Kreppel als „noch eben ausreichend vorbereitet“ galt, bestand er ebenfalls nicht. [45]
Kreppel stürzte offensichtlich in eine schwere persönliche Lebenskrise. Er war inzwischen 28 Jahre alt. Nach sieben Jahren Gymnasium, acht Semestern Jura und vier Jahren Referendariat, verlängert um ein Jahr, wurde ihm offiziell bescheinigt, dass er endgültig „vom höheren Justizdienst ausgeschlossen und aus dem Vorbereitungsdienst ausgeschieden“[46] sei. Josef Kreppel nahm sich zunächst eine „Auszeit“. Er wohnte bei seinen Eltern, die inzwischen nach Bad Ems an der Lahn verzogen waren, da der Vater aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand getreten war.[47] Offensichtlich suchte der Vater die Nähe zu den Emser Thermalquellen auf, die vor allem Linderung bei Atemwegserkrankungen versprachen.
Einige Zeit später hielt sich Josef Kreppel für mehrere Wochen in Berlin auf. Ein Arzt bescheinigte ihm inzwischen eine „psychische Depression“ und eine „ziemlich hochgradige Neurasthenie“[48], verursacht „durch schwere Schicksalsschläge in seiner Familie (Tod der einzigen Schwester und längere schwere Erkrankung des Vaters)“.[49] Mit Hilfe dieses ärztlichen Attestes wurde Josef Kreppel „ausnahmsweise noch einmal zur Wiederholung der Prüfung zugelassen[50], die er im August 1911 endgültig mit der Note ausreichend bestand.
Die erste biographische Phase bis zum Eintritt ins Berufsleben war geprägt durch zahlreiche Herausforderungen und Belastungen, die gegen Ende der Adoleszenz zu einem psychischen Zusammenbruch führten. Möglicherweise waren die Anforderungen des Elternhauses, geprägt durch den begrenzten sozialen Aufstieg des Vaters vom dörflichen Bauernsohn aus dem Goldenen Grund zum kleinstädtischen Hauptlehrer am Niederrhein, an den einzigen Sohn recht hoch. Andererseits muss die emotionale Bindung Josefs an die Eltern und an die Schwester besonders intensiv gewesen sein. Mehrfache Schul- und Ortswechsel verhinderten möglicherweise stabile Jugendfreundschaften. Josefs Leistungen wurden überwiegend als durchschnittlich qualifiziert. Die Absicht, Theologie zu studieren, im Abiturzeugnis noch vermerkt, hatte er kurzfristig zugunsten der Jurisprudenz aufgegeben. Auch in diesem Fach erbrachte Josef Kreppel lediglich „ausreichende“ Noten. Im Referendariat stieß er an die Grenzen seiner fachlichen und mentalen Belastbarkeit. Der psychische Zusammenbruch trat nach zweimaligem Nichtbestehen der Zweiten Staatsprüfung ein. Der dritte Versuch bescherte ihm den erhofften Erfolg und dürfte ihm vorübergehenden Auftrieb aus seinem seelischen Tief verschafft haben. Mit der Hypothek eines Überforderungssyndroms trat Josef Kreppel ins praktische Berufsleben ein.
- Quote paper
- Klaus Kreppel (Author), 2025, Josef Kreppel. Tod in Buchenwald, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1594430