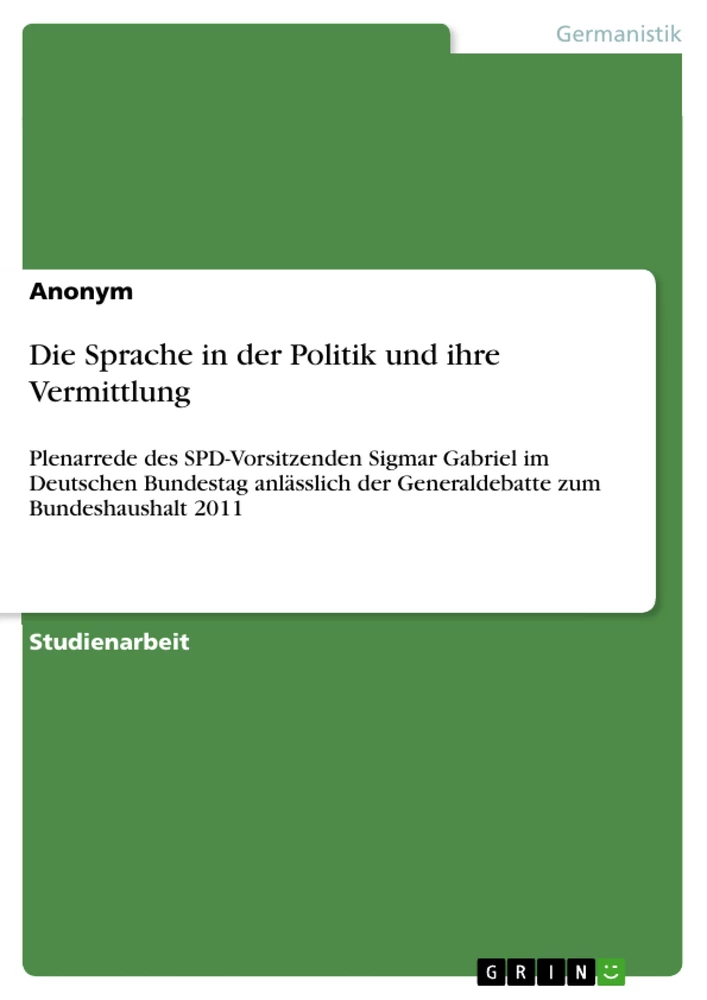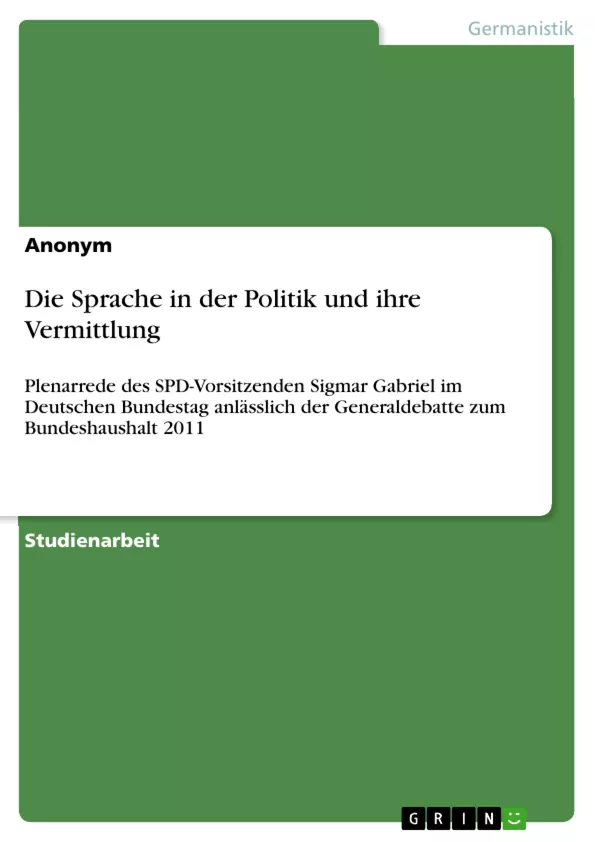Natürliche Sprachen wie das Deutsche sind keine homogenen, sondern heterogene Systeme, d.h. sie sind nicht einheitlich, sondern vielfältig gegliedert. So gibt es im Deutschen zwar eine als allgemein anerkannte Standardsprache, aber eben nicht die eine Sprache.
Der Fokus dieser Arbeit richtet sich dabei auf die Sprache in der Politik und ihre Vermittlung. Zu diesem Zweck wird die Plenarrede des SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel anlässlich der Generaldebatte zum Entwurf des Bundeshaushaltes 2011 am 15. September 2010 im Deutschen Bundestag sprachlich und sprachwissenschaftlich untersucht. Insbesondere sprachliche Mechanismen der Appellation und Persuasion werden dazu an ausgewählten Beispielen aus Gabriels Rede analysiert und erläutert.
Den Schluss dieser Arbeit bildet ein analysierendes Fazit, in dem auch auf die langläufige Kritik an der Sprache von Politikern eingegangen wird. Dabei wird deutlich, dass die Sprache in der Politik als eine inszenierte Form der Kommunikation zu verstehen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Thematische Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Zur Varietät der deutschen Sprache
- Standardsprache und funktionale Varietäten
- Inszenierung von Varietäten in der politischen Sprache
- Die Sprache in der Politik und ihre Vermittlung am Beispiel der Plenarrede Sigmar Gabriels anlässlich der Generaldebatte zum Bundeshaushalt 2011.
- Kontext und Bedeutung der Plenarrede
- Strategischer Sprachgebrauch in der Politik
- Sprachliche Mechanismen der Appellation und Integration
- Sprachliche Mechanismen der Persuasion
- Zusammenfassung: Sprache in der Politik als inszenierte Form der Kommunikation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die spezifischen Funktionen von Sprache in der Politik, insbesondere die Rolle von sprachlichen Mechanismen der Appellation und Persuasion in politischen Reden. Sie analysiert eine Plenarrede im Deutschen Bundestag, um zu verstehen, wie politische Akteure ihre Sprache gestalten und wie diese Sprache auf ihr Publikum wirkt.
- Die Bedeutung von Sprache als politisches Instrument
- Die Funktion von Sprachvarietäten in der politischen Kommunikation
- Die Analyse von rhetorischen Strategien in politischen Reden
- Die Wirkung von Sprache auf das Publikum im politischen Kontext
- Die Untersuchung der Beziehung zwischen Sprache und politischer Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer thematischen Einleitung, die die Vielfältigkeit der deutschen Sprache und die Rolle von Sprachvarietäten im politischen Kontext beleuchtet. Das zweite Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der politischen Sprachforschung und die Beziehung zwischen Sprache und Politik. Im dritten Kapitel werden die Standardsprache und funktionale Varietäten der deutschen Sprache näher betrachtet, mit besonderem Fokus auf die Sprache in der Politik. Das vierte Kapitel analysiert eine Plenarrede im Deutschen Bundestag, um die sprachlichen Mechanismen der Appellation und Persuasion zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen politische Sprache, Sprachvarietäten, Rhetorik, Appellation, Persuasion, politische Kommunikation, Analyse von Reden und Sprachforschung. Die Analyse der Plenarrede Sigmar Gabriels veranschaulicht die Anwendung dieser Konzepte im Kontext der deutschen Politik.
Häufig gestellte Fragen
Was wird in dieser Arbeit über politische Sprache untersucht?
Die Arbeit analysiert sprachliche Mechanismen wie Appellation und Persuasion am Beispiel einer Rede von Sigmar Gabriel im Deutschen Bundestag.
Welche Rede dient als Grundlage für die Analyse?
Es handelt sich um die Plenarrede des SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel zur Generaldebatte über den Bundeshaushalt 2011 vom 15. September 2010.
Was bedeutet "Sprache als inszenierte Form der Kommunikation"?
Es bedeutet, dass politische Sprache nicht rein informativ ist, sondern strategisch gestaltet wird, um bestimmte Wirkungen beim Publikum zu erzielen.
Was versteht man unter Persuasion in der Politik?
Persuasion bezeichnet den strategischen Einsatz von Sprache, um Zuhörer von einer bestimmten politischen Position zu überzeugen.
Welche Rolle spielen Sprachvarietäten?
Die Arbeit zeigt, dass die deutsche Sprache nicht einheitlich ist, sondern funktionale Varietäten besitzt, die in der Politik gezielt zur Abgrenzung oder Integration genutzt werden.
Was ist das Fazit der Untersuchung?
Dass politische Kommunikation oft eine Inszenierung ist, die rhetorische Strategien nutzt, um komplexe Sachverhalte appellativ zu vermitteln.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2010, Die Sprache in der Politik und ihre Vermittlung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159448