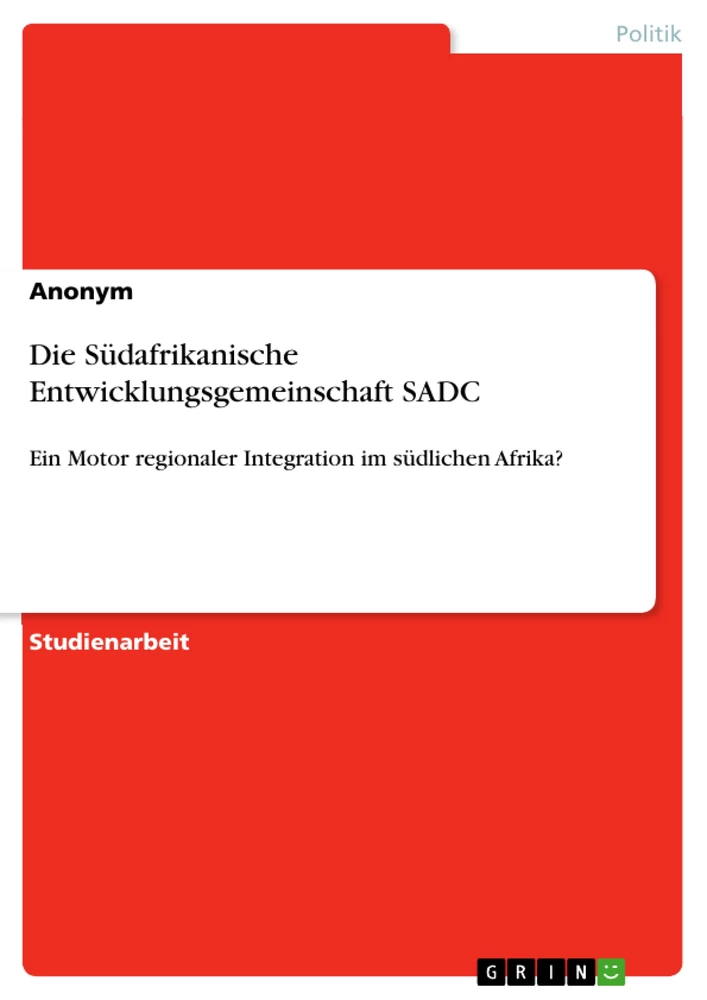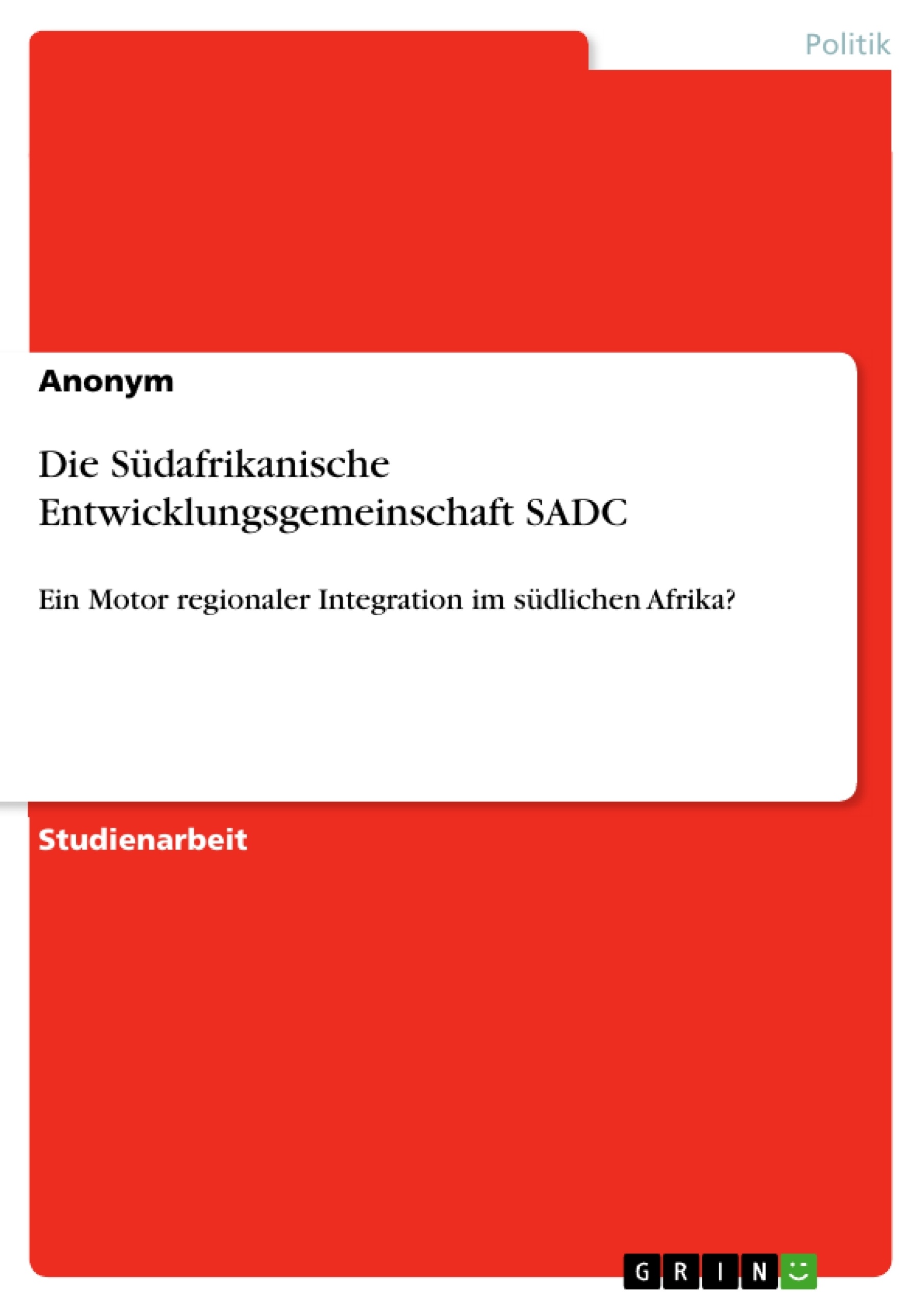Die Southern African Development Community (SADC) galt lange Zeit als erfolgreichstes regionales Integrations- und Kooperationsvorhaben im südlichen Afrika. Doch nach einer Phase erhöhter Aktivität in den neunziger Jahren gerieten die Integrationsbemühungen gegen Ende des Jahrzehnts ins Stocken. Auf ihrem Gipfeltreffen im Januar 2009 in Pretoria konnten sich die Staats- und Regierungschefs der SADC nicht auf weitere konkrete Schritte zur Umsetzung politischer und wirtschaftlicher Integration und die Lösung gegenwärtiger Herausforderungen im südlichen Afrika einigen.
Da die Kooperation trotz vielfacher politischer Bekenntnisse nur zögerlich vorankommt, bildet die Frage nach den gegenwärtigen Problemen und Integrationshemmnissen der Entwicklungsgemeinschaft den Schwerpunkt dieser Arbeit. Dabei kommt vor allem der wirtschaftlichen und politischen Dominanz Südafrikas, den überlappenden Mitgliedschaften vieler SADC-Staaten in anderen Integrationsbündnissen sowie den nur unzureichend ausgebildeten institutionellen und finanziellen Strukturen der SADC eine besondere Beachtung zu.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkungen
- Einleitung
- Theoretische Gesichtspunkte regionaler Kooperation und Integration
- Die Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft (SADC)
- Geschichtliche Entwicklung und Zielsetzungen
- Struktur und Prinzipien
- Gegenwärtige Problembereiche und Herausforderungen
- Heterogenität der Mitgliedsstaaten und Vormachtstellung Südafrikas
- Überlappende Mitgliedschaften in anderen Regionalorganisationen
- Mangelnde Institutionalisierung und fehlende Kapazitäten
- Die SADC als Motor regionaler Integration?
- Wohin steuert die SADC?
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert kritisch die Rolle der Südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft (SADC) als Integrations- und Entwicklungsgemeinschaft im südlichen Afrika. Dabei werden die Entwicklung, die Ziele und Prinzipien sowie die Struktur der SADC dargestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der gegenwärtigen Probleme und Integrationshemmnisse der Entwicklungsgemeinschaft. Die Arbeit konzentriert sich auf drei zentrale integrationshemmende Konfliktfelder: die Heterogenität der Mitgliedsstaaten und die damit zusammenhängende wirtschaftliche und politische Vormachtstellung Südafrikas, die überlappenden Mitgliedschaften in anderen Regionalorganisationen sowie die Problematik unzureichender Institutionalisierung und mangelnder finanzieller und personeller Ausstattung.
- Geschichtliche Entwicklung und Zielsetzungen der SADC
- Probleme und Integrationshemmnisse der SADC
- Die Rolle Südafrikas im Integrationsprozess
- Überlappende Mitgliedschaften in anderen Regionalorganisationen
- Institutionalisierung und Kapazitäten der SADC
Zusammenfassung der Kapitel
Vorbemerkungen
Das erste Kapitel stellt die SADC als regionales Integrationsvorhaben im südlichen Afrika vor und beleuchtet die Entwicklung der Integrationsbemühungen. Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und skizziert den Hintergrund der SADC als Integrationsgemeinschaft im südlichen Afrika. Das Kapitel geht auf die theoretischen Gesichtspunkte regionaler Kooperation und Integration ein und differenziert zwischen Kooperation und Integration.
Die Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft (SADC)
Das zweite Kapitel befasst sich mit der historischen Entwicklung und den Zielsetzungen der SADC. Es erläutert die Entstehung der Organisation aus der Southern African Development Coordination Conference (SADCC) und die Bedeutung des Endes der Apartheid in Südafrika für die Neugründung der Organisation. Das Kapitel beleuchtet die Struktur und die Prinzipien der SADC, die als intergouvernementale Organisation mit 15 Mitgliedstaaten im südlichen Afrika kooperiert.
Gegenwärtige Problembereiche und Herausforderungen
Das dritte Kapitel analysiert die gegenwärtigen Probleme und Herausforderungen der SADC. Es beleuchtet die Heterogenität der Mitgliedsstaaten, die wirtschaftliche und politische Vormachtstellung Südafrikas und die damit verbundenen Spannungen innerhalb der Organisation. Das Kapitel diskutiert die überlappenden Mitgliedschaften in anderen Regionalorganisationen und die daraus resultierende Koordinations- und Konkurrenzproblematik. Des Weiteren wird die Problematik unzureichender Institutionalisierung und mangelnder finanzieller und personeller Ausstattung der SADC betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem regionalen Integrationsprozess im südlichen Afrika, der Südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft (SADC), den Herausforderungen der Integration, der Heterogenität der Mitgliedsstaaten, der Vormachtstellung Südafrikas, der überlappenden Mitgliedschaften in anderen Regionalorganisationen und der Problematik der Institutionalisierung und Kapazitäten der SADC.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die SADC?
Die Southern African Development Community (SADC) ist eine regionale Organisation zur Förderung der wirtschaftlichen und politischen Integration im südlichen Afrika.
Warum stockt der Integrationsprozess der SADC?
Hauptgründe sind die wirtschaftliche Dominanz Südafrikas, überlappende Mitgliedschaften in anderen Bündnissen sowie unzureichende institutionelle und finanzielle Strukturen.
Welche Rolle spielt Südafrika innerhalb der Organisation?
Südafrika besitzt eine enorme wirtschaftliche und politische Vormachtstellung, was zu Spannungen und einer Heterogenität innerhalb der Mitgliedsstaaten führt.
Was ist das Problem der 'überlappenden Mitgliedschaften'?
Viele SADC-Staaten sind gleichzeitig Mitglieder in anderen Regionalorganisationen, was zu Koordinationsschwierigkeiten und konkurrierenden Verpflichtungen führt.
Wie hat sich die SADC historisch entwickelt?
Sie entstand aus der SADCC (Southern African Development Coordination Conference) und erlebte nach dem Ende der Apartheid eine Neuausrichtung hin zu tieferer Integration.
Ist die SADC ein effektiver Motor für regionale Entwicklung?
Die Arbeit analysiert kritisch, ob die SADC trotz politischer Bekenntnisse in der Lage ist, die gegenwärtigen Herausforderungen im südlichen Afrika erfolgreich zu lösen.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2009, Die Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft SADC, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159488