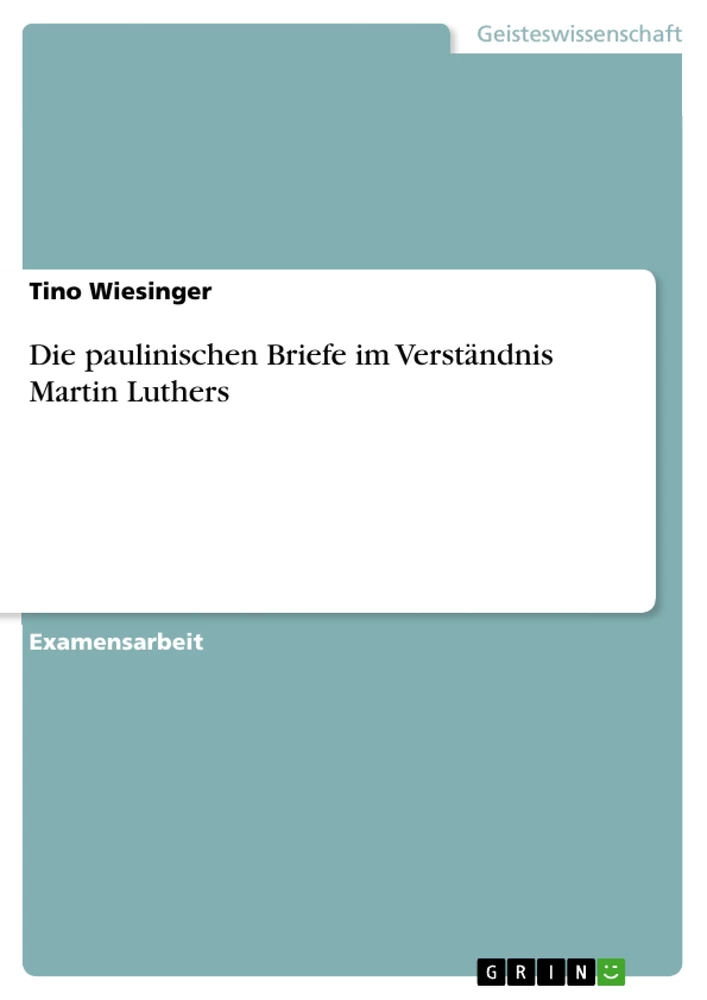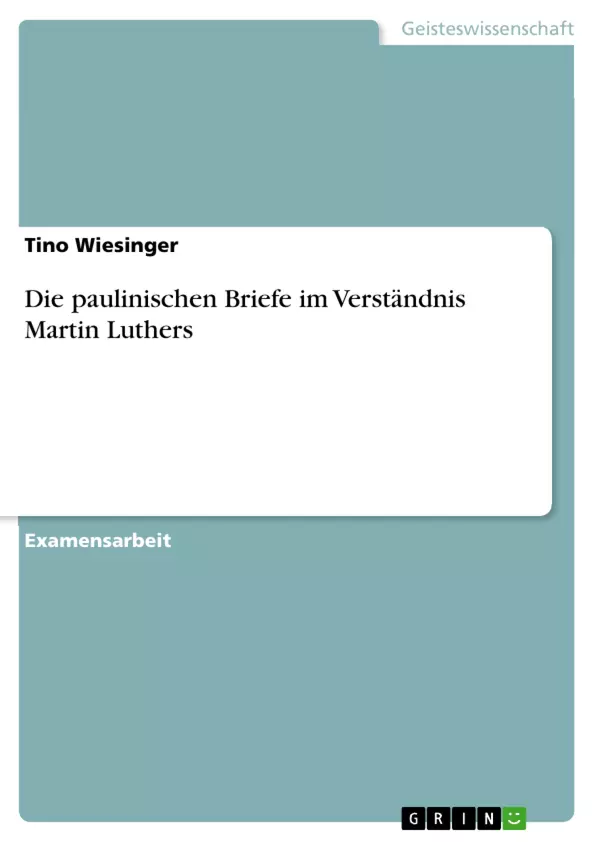„Sind ich Paulum verstanden hab, so hab ich keinen Doctor konnen achten“ (WA TR 1, Nr. 347). Dieses Bekenntnis Martin Luthers drückt aus, welch hohe Bedeutung die paulinische Lehre für Luther und seine Theologie gehabt haben muss. Man kann sogar noch weiter gehen und sagen, dass die gesamte evangelische Theologie, die ihren Ursprung insbesondere in der Lehre Luthers hat, aus Paulus erwachsen ist. „Als Ausleger des Paulus ist Luther (wider Willen) zum Reformator geworden, und er hat mit seiner Paulusexegese der gesamten Kirchen [sic] einen wegweisenden, bis heute weiterwirkenden Dienst getan.“ Wie aber stehen Paulus und Luther konkret miteinander in Verbindung? Wie hat Luther Paulus verstanden und welche theologischen Auffassungen hat Luther aus Paulus gewonnen? Inwiefern ist Luther als Ausleger der Heiligen Schrift vor allem auch Ausleger des Paulus? Diese Fragestellungen deuten an, dass hier sowohl der biblisch-exegetische als auch der reformatorisch-systematische Ansatz Luthers miteinander verwoben sind. Diese Problematik wurde bisher erstaunlich wenig thematisiert. Meist stehen gerade bei der Lutherinterpretation Exegese und Systematik „weithin ungeklärt nebeneinander“ , so wie dies bei der Abgrenzung der theologischen Disziplinen voneinander üblich ist. Während Luther seine Rechtfertigungslehre als Schriftauslegung vorgetragen hat, fällt diese Intertextualität in vielen Darstellungen der Theologie Luthers unberücksichtigt aus.
Diese Kluft will die vorliegende Arbeit weitestgehend überwinden und sowohl aus exegetischer und damit zusammenhängend auch systematischer Perspektive das paulinische Erbe bei Luther untersuchen. Dazu ist es nötig, sowohl die paulinische als auch die lutherische Theologie zu rekonstruieren und schließlich deren Schnittpunkte, aber auch deren Differenzen, darzulegen. Methodisch geschieht dies im Wesentlichen durch einen Textvergleich zwischen den Paulusbriefen und ihren Auslegungen durch Luther.
Martin Luthers Paulusauslegung findet sich in ganz verschiedenen Texten. Neben fortlaufenden Kommentaren zum Römer- und Galaterbrief stehen uns auch die Vorreden zu den Paulusbriefen in Luthers Bibelausgaben zur Verfügung. Zahlreiche Predigten über Texte aus den Paulusbriefen können bei der Rekonstruktion von Luthers Verständnis des Paulus ebenso herangezogen werden wie die von Luther im Blick auf Paulus verfassten Bekenntnisse, Lieder, Tischreden und Textauslegungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Fragestellungen und Konzeption der Arbeit.
- Problemanzeige
- Forschungsgeschichtlicher Hintergrund.
- Luther und Paulus......
- Luthers Zugang zu Paulus
- Der Paulinismus Luthers
- Luthers frühe Phase der Paulusauslegung (1513-1521).
- Die Paulusinterpretation als Element der Psalmenvorlesung (1513-1515)
- Sünde
- Gnade
- Gerechtigkeit.
- Gericht.........
- Kritische Reflexion.
- Die Römerbriefvorlesung (1515/16) .....
- Die Zielsetzung der Römerbriefvorlesung.........
- Das Anliegen des Paulus.
- Der Sündenbegriff ..
- Die Gerechtigkeit Gottes und die Rechtfertigung des Menschen.........
- Gottesliebe.
- Die Galaterbriefvorlesung (1516/17)...
- Der Einfluss der mystischen Demutstheologie.
- Gesetz und Evangelium.
- Gerechtigkeit als Tugend.....
- Die Errettung aus der gegenwärtigen Welt.
- Die Hebräerbriefvorlesung (1517/18)
- Empfänger und Verfasserschaft des Hebräerbriefes............
- Wort Gottes und Glaube.
- Christi Kampf mit dem Teufel.............
- Christus als heilswirksames Zeichen und Vorbild (sacramentum et exemplum).......
- Der Kommentar zum Galaterbrief (1519).
- Der Streit des Paulus mit Petrus in Antiochien (Gal 2, 11-21)............
- Glaube als Gesetzeserfüllung.
- Luthers Kritik am aristotelischen Menschenbild...\n.
- Die „Operationes in Psalmos“ (1519-1521) .......
- Luthers Gerechtigkeitsbegriff..\n.
- Das paulinische Verständnis von Gottesgerechtigkeit......
- ,,Von der Freiheit eines Christenmenschen“ (1520)......
- Christliche Freiheit und „fröhlicher Wechsel\" bei Luther\n.
- Das paulinische Verständnis von Freiheit
- Luthers eigenständige Paulusinterpretation seit 1522\n.....
- Die Vorreden zum Septembertestament und zum Römerbrief (1522)........
- Vorrede zum Neuen Testament........
- Vorrede zum Römerbrief.
- ,,De servo arbitrio“ (1525).........
- Die Galaterbriefvorlesung (1531/35).........
- Gesetz und Evangelium
- Luthers Zwei-Reiche-Lehre.
- Luthers Deutung seiner eigenen Situation\n.
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Beziehung zwischen Martin Luther und dem Apostel Paulus und untersucht, wie Luthers Interpretation des Paulus seine eigene Theologie beeinflusst hat. Sie analysiert, wie Luther Paulus verstanden hat und welche theologischen Auffassungen er daraus gewonnen hat. Die Arbeit betrachtet dabei sowohl die exegetische als auch die systematische Seite von Luthers Theologie.
- Die Rekonstruktion der paulinischen und lutherischen Theologie
- Die Untersuchung der Schnittpunkte und Differenzen zwischen Paulus und Luther
- Die Analyse von Luthers Auslegungen der Paulusbriefe, insbesondere Römer-, Galater- und Hebräerbrief
- Die Rolle der Rechtfertigungslehre im Zentrum von Luthers Theologie
- Die Bedeutung von Luthers Paulusverständnis für die Entwicklung der evangelischen Theologie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellungen der Arbeit dar und erläutert die Konzeption der Arbeit. Sie beleuchtet die Bedeutung von Paulus für Luther und die Reformationsgeschichte. Die Problemanzeige stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis von Exegese und Systematik in Luthers Theologie in den Vordergrund. Es wird die Notwendigkeit betont, die Paulusbriefe als Texte zu verstehen, die einer fortlaufenden Veränderung unterworfen sind. Der Abschnitt „Luther und Paulus" beleuchtet Luthers Zugang zu Paulus und die Auswirkungen des Paulinismus auf Luthers Theologie. Das Kapitel „Luthers frühe Phase der Paulusauslegung (1513-1521)" untersucht Luthers Paulusinterpretation im Kontext seiner Psalmen- und Römerbriefvorlesungen, einschließlich der Diskussionen über Sünde, Gnade, Gerechtigkeit und Gericht. Die Galaterbriefvorlesung wird im Kontext der mystischen Demutstheologie analysiert, wobei Luthers Verständnis von Gesetz und Evangelium und seine Definition von Gerechtigkeit im Vordergrund stehen. Der Hebräerbrief wird im Hinblick auf die Verfasserschaft, das Wort Gottes und den Glauben, den Kampf Christi mit dem Teufel sowie die heilswirksame Rolle Christi als Zeichen und Vorbild analysiert. Der Kommentar zum Galaterbrief von 1519 wird im Hinblick auf den Streit zwischen Paulus und Petrus in Antiochien, den Glauben als Gesetzeserfüllung und Luthers Kritik am aristotelischen Menschenbild untersucht. Schließlich wird Luthers eigenständige Paulusinterpretation seit 1522 untersucht, einschließlich der Vorreden zum Septembertestament und zum Römerbrief sowie der Werke „De servo arbitrio" und der Galaterbriefvorlesung von 1531/35.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Martin Luther, Paulus, Rechtfertigungslehre, Exegese, Systematik, Paulusinterpretation, Römerbrief, Galaterbrief, Hebräerbrief, Gesetz und Evangelium, Sünde, Gnade, Gerechtigkeit, Freiheit, Zwei-Reiche-Lehre.
- Citation du texte
- Tino Wiesinger (Auteur), 2009, Die paulinischen Briefe im Verständnis Martin Luthers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159512