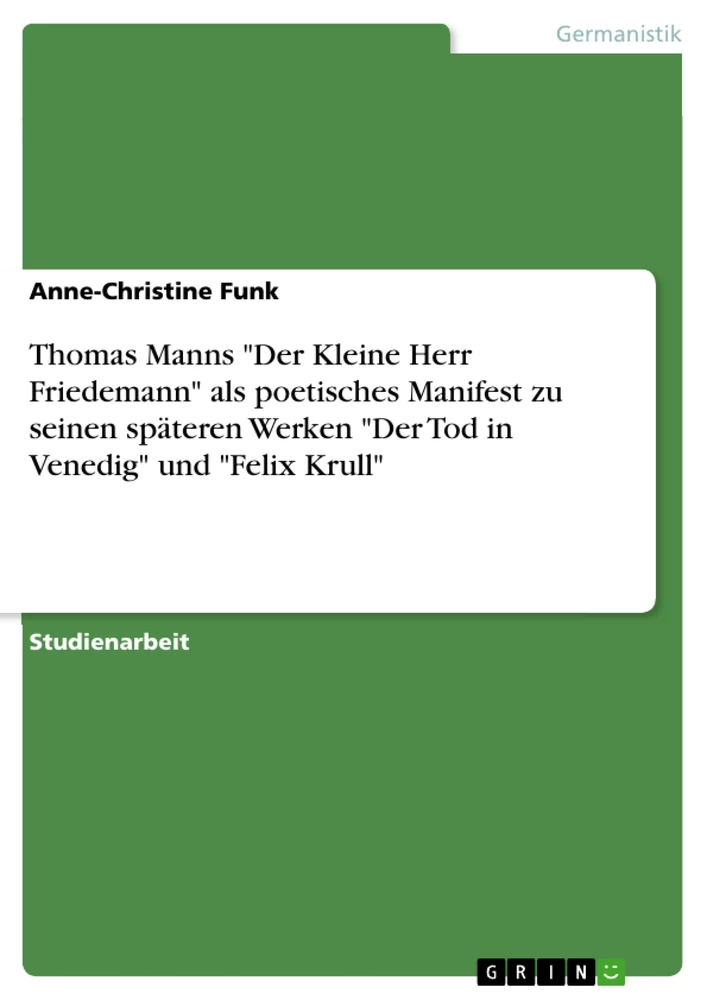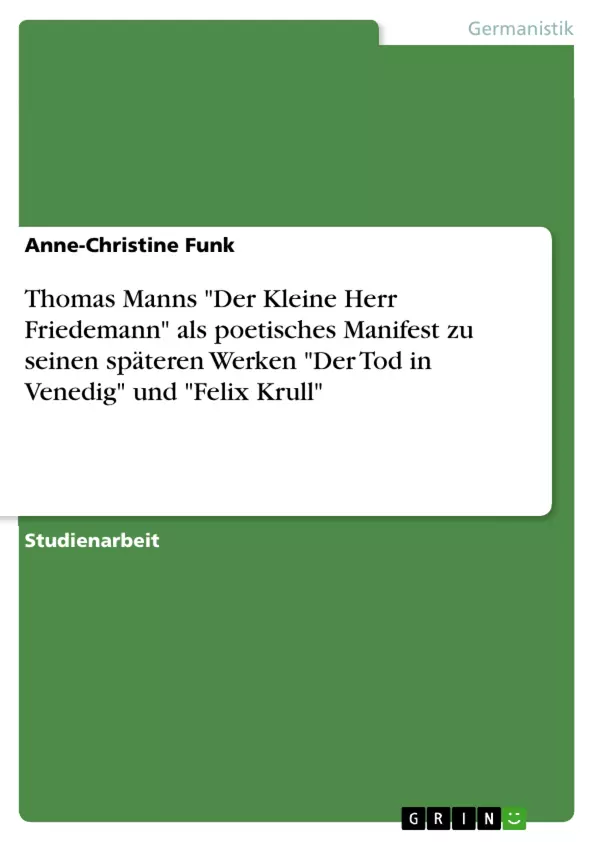Das Thema dieser Arbeit lautet: "In wiefern ist der "Kleine Herr Friedemann" ein poetisches
Manifest für Thomas Manns, für die spätere Novelle "Der Tod in Venedig" und für den Roman "Die
Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull". Insofern werden Parallelen zwischen den drei Werken gesucht
und einer Kontextualisierung der historischen Verhältnisse zu Thomas Manns Zeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biographie zu Thomas Mann
- Historischer Kontext : um 1900
- Historischer Kontext: die Nachkriegszeit
- Der Kleine Herr Friedemann
- Kurze Inhaltsangabe
- Die Kunstproblematik
- Thematik
- Symbolik
- Schopenhauer und Nietzsche über die Enttäuschung
- Schlussfolgerung zur Novelle
- Der Tod in Venedig
- Kurze Inhaltsangabe
- Gemeinsamkeiten mit dem \"Kleinen Herrn Friedemann\"
- Die Kunstproblematik
- Der Tod
- Mythologische Aspekte
- Philosophische Aspekte
- Schlussfolgerung
- Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull
- Kurze Inhaltsangabe
- Krull, eine Parodie ?
- Themen in Thomas Manns Hauptwerk
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der Novelle \"Der Kleine Herr Friedemann\" für das spätere Werk von Thomas Mann, insbesondere die Parallelen zu den Werken \"Der Tod in Venedig\" und \"Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull\". Die Analyse beleuchtet die Themen und Kunstproblematik in den drei Werken im Kontext der historischen Verhältnisse von Thomas Manns Zeit.
- Die Rolle der Kunst und ihre Auswirkungen auf die Lebensgestaltung
- Die Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswirklichkeit und der Suche nach Sinn
- Die Bedeutung von Kindheitserfahrungen und deren Einfluss auf das spätere Leben
- Die Ambivalenz von Sehnsucht und Enttäuschung in der menschlichen Existenz
- Die Analyse des historischen und gesellschaftlichen Kontextes von Thomas Manns Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Der Kleine Herr Friedemann
Die Novelle erzählt die tragische Geschichte des verkrüppelten Johannes Friedemann, der durch ein frühes Trauma geprägt ist und sich von der Welt zurückzieht. Seine Liebe zur Kunst und sein Versuch, sie als Ersatz für ein erfülltes Leben zu nutzen, scheitern schließlich, was zu seiner Selbstzerstörung führt.
Der Tod in Venedig
Das Kapitel widmet sich dem gleichnamigen Werk und betrachtet die Gemeinsamkeiten mit der Novelle \"Der Kleine Herr Friedemann\". Die Kunstproblematik, die Bedeutung des Todes und die mythischen und philosophischen Aspekte werden untersucht.
Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull
Dieser Abschnitt analysiert die Kurzfassung von Thomas Manns Hauptwerk, beleuchtet die Figur Krulls, die Frage nach einer möglichen Parodie und die wichtigsten Themen des Werkes.
Schlüsselwörter
Thomas Mann, Novelle, \"Der Kleine Herr Friedemann\", \"Der Tod in Venedig\", \"Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull\", Kunstproblematik, Enttäuschung, Lebensgestaltung, historische Verhältnisse, Biographie, Schopenhauer, Nietzsche, Mythologie, Philosophie, Symbolismus, Ironie, Psychoanalyse, Dekadenz, Verfall.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird 'Der kleine Herr Friedemann' als poetisches Manifest bezeichnet?
Weil die Novelle bereits grundlegende Themen wie die Kunstproblematik und die Ambivalenz von Sehnsucht und Enttäuschung enthält, die Thomas Mann in späteren Werken weiterentwickelt hat.
Welche Parallelen bestehen zu 'Der Tod in Venedig'?
Beide Werke behandeln die tragische Verknüpfung von Kunst, unterdrücktem Leben und dem schließlichen Verfall oder Tod der Hauptfiguren.
Wie wird Felix Krull in dieser Analyse eingeordnet?
Die Arbeit untersucht, ob Krull eine Parodie der in den früheren Werken behandelten Themen darstellt und wie die Hochstapelei mit der Kunstproblematik verknüpft ist.
Welchen Einfluss hatten Schopenhauer und Nietzsche auf das Werk?
Die philosophischen Ansichten dieser Denker über Enttäuschung und die menschliche Existenz prägten Thomas Manns Darstellung seiner Charaktere maßgeblich.
Was ist das Schicksal von Johannes Friedemann?
Friedemann, durch ein Kindheitstrauma körperlich verkrüppelt, versucht sein Leben durch die Kunst zu ersetzen, scheitert jedoch an einer unerwiderten Liebe und wählt die Selbstzerstörung.
In welchem historischen Kontext entstanden diese Werke?
Die Analyse kontextualisiert die Werke sowohl im Zeitraum um 1900 als auch in der Nachkriegszeit, um gesellschaftliche Veränderungen und deren Spiegelung im Text aufzuzeigen.
- Citar trabajo
- Anne-Christine Funk (Autor), 2008, Thomas Manns "Der Kleine Herr Friedemann" als poetisches Manifest zu seinen späteren Werken "Der Tod in Venedig" und "Felix Krull", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159538