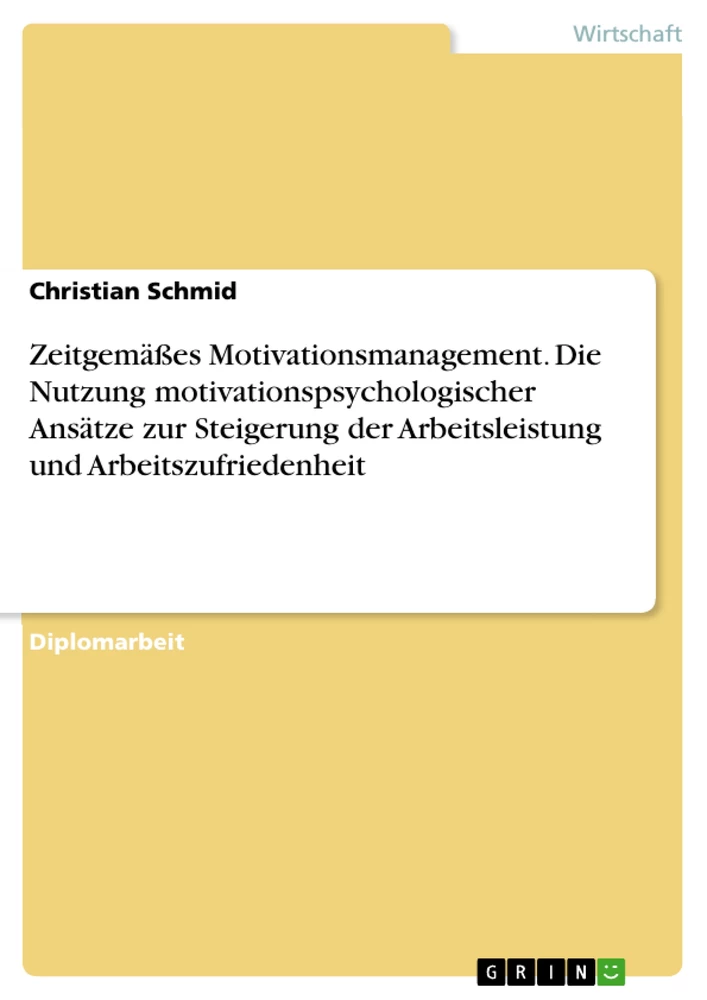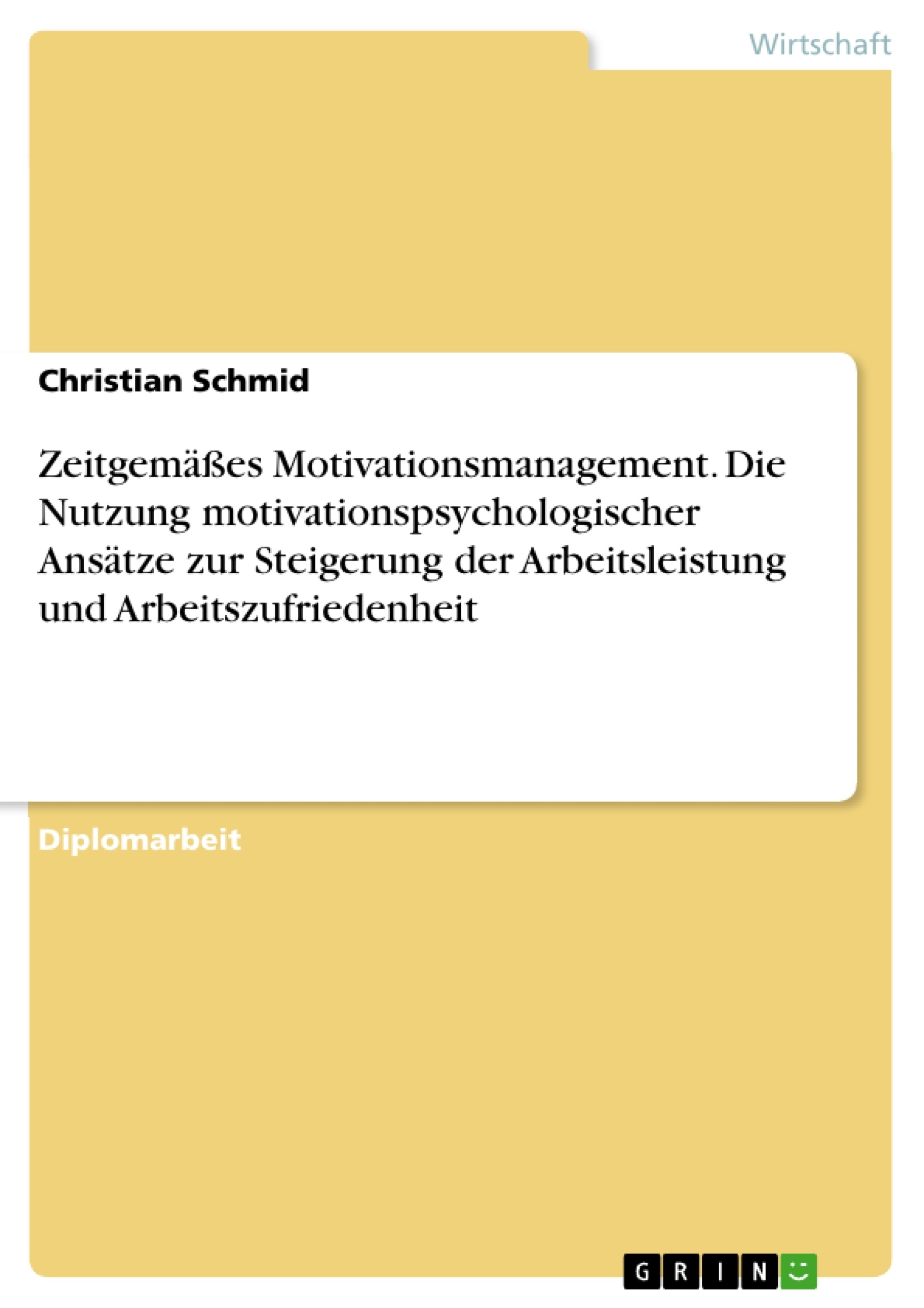Das Ziel der vorliegenden Schrift ist die Darstellung motivationspsychologischer Erkenntnisse und ihre kritische Betrachtung. Darauf aufbauend sollen geeignete Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung abgeleitet werden.
Ferner soll für die Vorstellung geworben werden, dass Leistung und Zufriedenheit als gleichberechtigte Ziele anzustreben sind (VON ROSENSTIEL, 2001, S. VII).
Um ein Verständnis zu vermitteln, was sich hinter dem Begriff der Motivation und der damit zusammenhängenden Aspekte verbirgt, soll in Kapitel eins zunächst eine Einführung in die Grundlagen der Motivation erfolgen. Die Ausführungen sind deshalb bewusst sehr allgemein gehalten.
Anschließend erfolgt eine Diskussion zu verschiedenen Fragen der Motivation im Kontext der beruflichen Arbeit. Die Untersuchung dieser motivationalen Aspekte bezieht sich demzufolge spezifisch auf die Situation im Betrieb.
Das dritte Kapitel analysiert die Konstrukte Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung, wobei der Schwerpunkt auf die Arbeitszufriedenheit gelegt wurde.
Schließlich soll im letzten Kapitel eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Möglichkeiten zur Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung erfolgen. Diese Ausführungen sind nicht isoliert von den vorherigen Kapiteln zu sehen, da sie im Wesentlichen auf die dort beschriebenen Aspekte aufbauen und diese systematisch einbeziehen. Zu diesem Zweck finden sich bei bereits zuvor erwähnten Themenbereichen und Fachtermini entsprechende Hinweise auf das einschlägige Kapitel bzw. den Abschnitt. Dadurch soll das Nachschlagen bei etwaigen Unklarheiten erleichtert werden. Der Umfang dieses abschließenden Teils ist vergleichsweise hoch. Dies zeigt, dass hier der Schwerpunkt der Arbeit zu finden ist.
Inhaltsverzeichnis
- MOTIVATION - EIN FACHBEGRIFF DER IN ALLER MUNDE IST.
- AUFBAU UND ZIELSETZUNG DER ARBEIT
- GRUNDLAGEN DER MOTIVATION
- Historische Positionen der Motivationspsychologie
- Motivation: Begriffsklärung, Entstehung und Abgrenzung zum Motiv
- Motivation und Handeln
- Motivation und Volition
- Motive: Arten und Klassifikationsvorschläge
- Motive: Bewusst oder unbewusst? Wissen wir, warum wir was tun?
- Motive: Welche werden vom Mensch genannt, welche verschwiegen?
- Motive: Welche Methoden gibt es, menschliche Motive zu erkennen?
- Motive: Angeboren oder erlernt?
- MOTIVATION UND BERUFLICHE ARBEIT
- Warum arbeitet der Mensch?
- Arbeiten wir nur des Geldes wegen?
- Extrinsische und intrinsische Motivation in der beruflichen Arbeit
- Die Korrumpierung intrinsischer Motivation durch extrinsische Anreize
- Flow-Erleben: Eine besonders intensive Form intrinsischer Motivation
- Das Leistungsmotiv
- ARBEITSZUFRIEDENHEIT UND ARBEITSLEISTUNG
- Arbeitszufriedenheit
- Formen der Arbeitszufriedenheit nach BRUGGEMANN (1975)
- Die Zwei-Faktoren-Theorie der Arbeitszufriedenheit nach HERZBERG et al. (1959)
- Messung der Arbeitszufriedenheit
- Arbeitsleistung
- STEIGERUNG DER ARBEITSZUFRIEDENHEIT UND ARBEITSLEISTUNG
- Betriebliche Anreizgestaltung
- Das Modell der Bedürfnishierarchie nach MASLOW - eine viel diskutierte Theorie der Motivation
- Was ist bei der betrieblichen Anreizgestaltung zu beachten?
- Welchen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung hat das Geld?
- Welchen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung haben die Aufstiegschancen?
- Welchen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung hat der Führungsstil?
- Welchen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung haben Anerkennung und Kritik?
- Welchen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung hat der Arbeitsinhalt?
- Welchen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung hat die Arbeitsgruppe?
- Welchen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung hat die Arbeitszeit?
- Welchen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung haben die Information und Kommunikation?
- ZUSAMMENFASSUNG DER ERKENNTNISSE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema des Motivationsmanagements im Arbeitskontext. Sie untersucht die Nutzung motivationspsychologischer Ansätze zur Steigerung der Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit. Der Fokus liegt dabei auf der Erläuterung verschiedener motivationstheoretischer Ansätze und deren Anwendung in der Praxis. Ziel der Arbeit ist es, ein tieferes Verständnis für die komplexen Zusammenhänge zwischen Motivation, Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung zu entwickeln und praktische Handlungsempfehlungen für die betriebliche Praxis abzuleiten.
- Motivation und ihre Bedeutung im beruflichen Kontext
- Verschiedene Theorien und Modelle zur Erklärung von Motivation
- Die Rolle von intrinsischer und extrinsischer Motivation in der Arbeit
- Faktoren, die die Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung beeinflussen
- Praktische Ansätze zur Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dieser Diplomarbeit befasst sich mit den Grundlagen der Motivation. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Forschungsfeldes und stellt zentrale Konzepte und Definitionen vor. Im zweiten Kapitel wird der Fokus auf die Rolle der Motivation in der beruflichen Arbeit gerichtet. Verschiedene motivationstheoretische Ansätze werden vorgestellt und diskutiert, um zu verstehen, welche Faktoren die Arbeitsmotivation beeinflussen. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Begriffen Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung. Es beleuchtet die verschiedenen Formen der Arbeitszufriedenheit und die Messung von Arbeitsleistung. Im letzten Kapitel, das in dieser Vorschau nicht wiedergegeben wird, werden verschiedene Möglichkeiten zur Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung vorgestellt und bewertet.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit den Themen Motivation, Arbeitszufriedenheit, Arbeitsleistung, Motivationspsychologie, Motivationstheorien, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation, Flow-Erleben, Bedürfnishierarchie nach Maslow, Betriebliche Anreizgestaltung, Führungsstil, Arbeitsinhalt, Arbeitsgruppe, Arbeitszeit, Information und Kommunikation. Sie zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Zusammenhänge zwischen diesen Konzepten zu entwickeln und praxisrelevante Handlungsempfehlungen abzuleiten.
- Arbeit zitieren
- Christian Schmid (Autor:in), 2007, Zeitgemäßes Motivationsmanagement. Die Nutzung motivationspsychologischer Ansätze zur Steigerung der Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159552