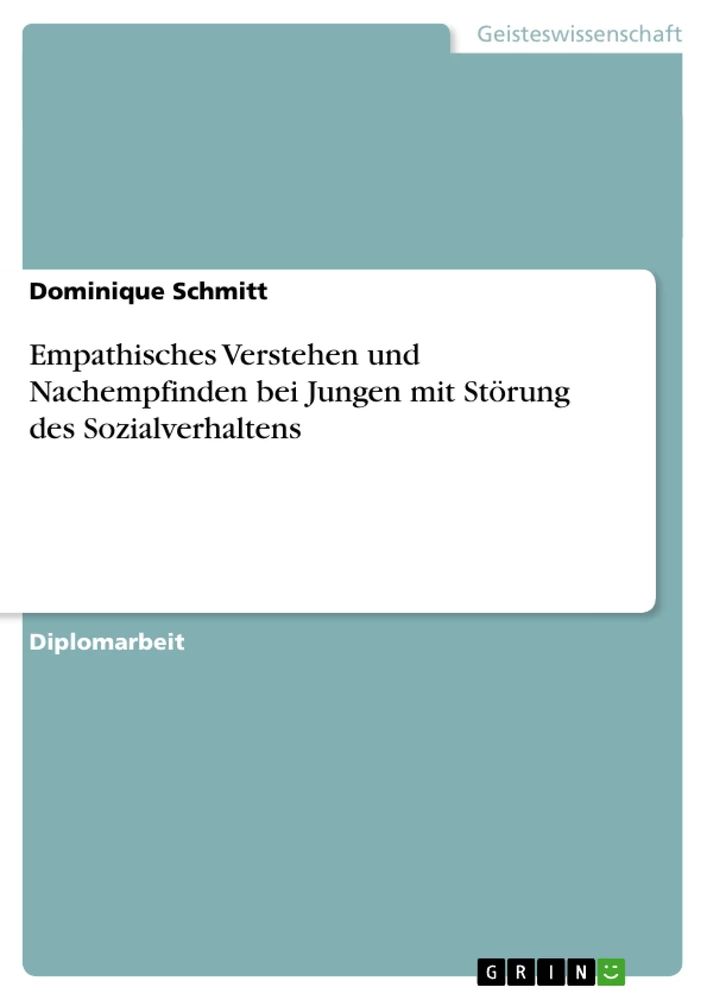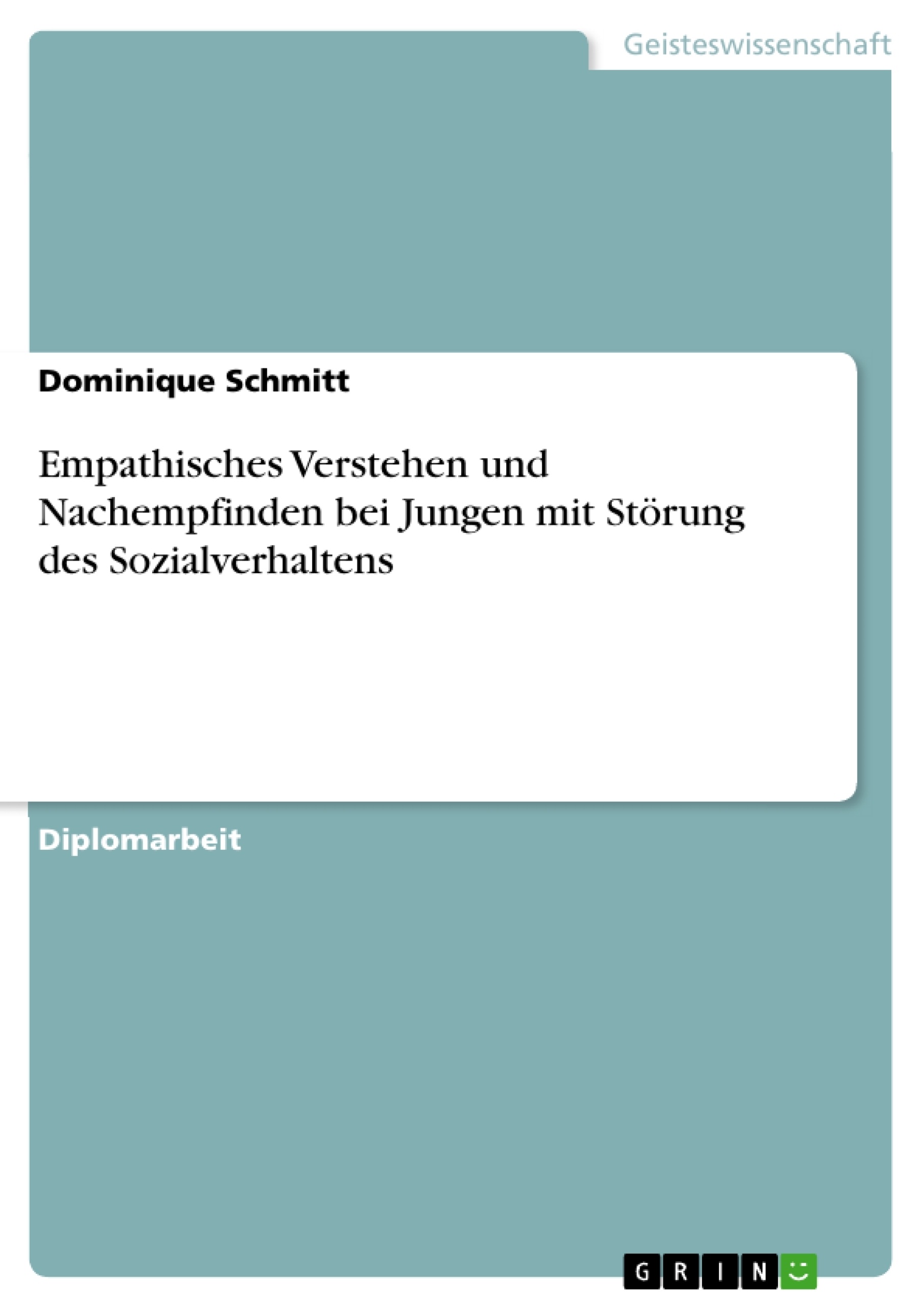Die vorliegende empirische Arbeit hatte zum Ziel, empathisches Verstehen und Nachempfinden bei
Jungen mit Störung des Sozialverhaltens in einem quasiexperimentellen Versuchsdesign zu untersuchen.
Um der theoretischen Dimensionierung des Konstrukts gerecht zu werden, wurde dabei erstmals
ein Untersuchungsschema gewählt, das zugleich emotionale und kognitive sowie situationale und
dispositionale Empathiedimensionen unterscheidet. Dementsprechend wurden die empathischen
Fertigkeiten zur Emotionserkennung, zur Perspektivenübername, zur Emotionsattribution sowie zur
kognitiven und zur affektiven Reaktivität mithilfe geeigneter Testverfahren erfasst und mit den
Ergebnissen einer nicht-klinischen Kontrollgruppe verglichen.
Bei der anschließenden statistischen Auswertung mittels t-Tests für unabhängige Stichproben (a = 5%)
wurden von allen untersuchten Jugendlichen insgesamt 21 Jungen mit einer Störung des Sozialverhaltens
aus mehreren sozialpsychiatrischen Einrichtungen und 25 Jungen der Kontrollgruppe berücksichtigt.
Entsprechend vorausgehender Befunde und klinischer Beobachtungen waren bei der Patientengruppe
grundlegende Defizite im empathischen Verständnis wie auch im empathischen Nachempfinden
angenommen worden. Dabei konnten die vorliegenden Ergebnisse vorwiegend Defizite im Bereich
der kognitiven Empathie und hierbei insbesondere bezüglich der Fähigkeit zur Emotionsattribution
und der kognitiven Reaktivität belegen. Die entsprechenden Auffälligkeiten zeigten sich hierbei v.a. in
situationsgebundenen Zusammenhängen und bei negativen Emotionen. Demnach fanden die Probanden
der Patientengruppe unter den genannten Umständen weitaus schlechtere Erklärungen für die
negativen Emotionen ihrer Umwelt und reagierten dann bedeutsam seltener mit kognitiv geprägten
Eindrücken und Bewertungen der dargestellten Situationen.
Die beschriebenen Ergebnisse konnten im Rahmen der Grundlagenforschung zu einem verbesserten
Verständnis der Störung des Sozialverhaltens im Jugendalter beitragen und weitere Erklärungsansätze
für das störungstypische Ungleichgewicht von prosozialen und dissozialen Verhaltensweisen liefern.
Inhaltsverzeichnis
- ZUSAMMENFASSUNG
- EINLEITUNG
- THEORETISCHER TEIL
- Störung des Sozialverhaltens
- Definition der Störung
- Diagnostik und Klassifikation der Störung
- Ätiologie und Pathogenese: Versuch eines integrativen Störungsmodells
- Zusammenfassung der Befunde zur Störung des Sozialverhaltens
- Der „,violence inhibition mechanism\" (VIM) nach Blair
- Konzept des VIM
- Evidenz des VIM und seiner entwicklungspsychologischen Konsequenzen
- Psychophysiologische Konsequenzen eines VIM-Defekts
- Emotionale Konsequenzen eines VIM-Defekts
- Kognitive Konsequenzen eines VIM-Defekts
- Verhaltensmäßige Konsequenzen eines VIM-Defekts
- Zusammenfassendes Entwicklungsmodell
- Kritik und Einschränkungen der Theorie
- Zusammenfassung der Annahmen und der Befunde zum VIM
- Grundlagen zum Empathiebegriff
- Definition und Dimensionalität der Empathie
- Konsequenzen empathischer Fertigkeiten für das Sozialverhalten
- Determinanten empathischer Fertigkeiten
- Entwicklungsdeterminanten der dispositionalen Empathie
- Determinanten der situationalen Empathie
- Zusammenfassung der Grundlagen zum Empathiebegriff
- Empathisches Verstehen und Nachempfinden bei Kindern und Jugendlichen mit Störung des Sozialverhaltens
- Befunde zum empathischen Verstehen bei Kindern und Jugendlichen mit Störung des Sozialverhaltens: kognitive Empathie
- Befunde zur Emotionserkennung
- Befunde zur Perspektivenübernahme
- Befunde zur Emotionsattribution
- Befunde zum empathischen Nachempfinden bei Kindern und Jugendlichen mit Störungen des Sozialverhaltens: emotionale Empathie
- Einfluss medikamentöser Behandlung und komorbider Aufmerksamkeitsstörungen auf die empathischen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen mit Störungen des Sozialverhaltens
- Zusammenfassung der Befunde zum empathischen Verstehen und Nachempfinden bei Jugendlichen mit Störungen des Sozialverhaltens
- FRAGESTELLUNG UND HYPOTHESEN
- METHODISCHES VORGEHEN
- Überblick über die Methodik des Experiments
- Voruntersuchungen
- Versuchsablauf
- Versuchsplan
- Abhängige Variablen
- Verfahren zur Erfassung empathischer Kompetenzen
- Verfahren zur Erfassung der allgemeinen Intelligenz
- Verfahren zum Ausschluss psychiatrisch relevanter Störungen
- Zusammenfassung und Übersicht der verwendeten Testverfahren
- Untersuchungsstichproben
- Merkmale der klinischen Experimentalgruppe
- Merkmale der nicht-klinischen Kontrollgruppe
- Vergleich der beiden Gruppen bezüglich relevanter Personenvariable
- Statistisches Vorgehen
- Vorgehen zur Prüfung emotionsunabhängiger Gruppenunterschiede in den untersuchten Empathiedimensionen (Hypothese 1)
- Vorgehen zur Prüfung emotionsspezifischer Gruppenunterschiede (Hypothese 2)
- ERGEBNISSE
- Unsystematische Beobachtungen
- Ergebnisse zur Überprüfung der Fragestellung
- Darstellung emotionsunabhängiger Gruppenunterschiede (Hypothese 1)
- Darstellung emotionsspezifischer Gruppenunterschiede (Hypothese 2)
- DISKUSSION
- Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
- Methodische Kritik
- Diskussion der untersuchten Stichproben
- Diskussion der verwendeten Testverfahren
- Résumé
- Perspektiven für zukünftige Forschungsarbeiten
- Implikationen für die therapeutische Praxis
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit dem empathischen Verstehen und Nachempfinden bei Jungen mit Störung des Sozialverhaltens. Ziel der Arbeit ist es, die empathischen Fähigkeiten von Jungen mit Störung des Sozialverhaltens im Vergleich zu einer Kontrollgruppe zu untersuchen und den Einfluss von emotionalen Inhalten auf die empathischen Leistungen beider Gruppen zu erforschen. Die Arbeit beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Störung des Sozialverhaltens sowie des Empathiebegriffs und untersucht verschiedene Aspekte empathischen Verstehens und Nachempfindens, wie die Erkennung von Emotionen, die Perspektivenübernahme und die Emotionsattribution.
- Störung des Sozialverhaltens
- Empathiebegriff und dessen Dimensionalität
- Empathisches Verstehen und Nachempfinden bei Kindern und Jugendlichen mit Störung des Sozialverhaltens
- Einfluss emotionaler Inhalte auf die empathischen Leistungen
- Vergleich der empathischen Fähigkeiten von Jungen mit Störung des Sozialverhaltens und einer Kontrollgruppe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über die Thematik der Diplomarbeit und stellt die Forschungsfrage und die Hypothesen vor. Im theoretischen Teil werden zunächst die Störung des Sozialverhaltens und der ,violence inhibition mechanism' (VIM) nach Blair ausführlich behandelt. Es werden die Definition, Diagnostik, Ätiologie und die entwicklungspsychologischen Folgen des VIM-Defekts beleuchtet. Anschließend werden die Grundlagen zum Empathiebegriff, seine Dimensionalität und seine Determinanten erläutert. Im Fokus stehen die Auswirkungen von Störungen des Sozialverhaltens auf das empathische Verstehen und Nachempfinden. Der methodische Teil beschreibt die Methodik des Experiments, die Stichproben, die verwendeten Testverfahren und das statistische Vorgehen. Die Ergebnisse der Untersuchung werden im nächsten Kapitel dargestellt und im Anschluss in der Diskussion interpretiert und kritisch reflektiert.
Schlüsselwörter
Störung des Sozialverhaltens, „violence inhibition mechanism“ (VIM), Empathie, Empathisches Verstehen, Nachempfinden, Emotionserkennung, Perspektivenübernahme, Emotionsattribution, Entwicklungspsychologie, Klinische Psychologie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Störung des Sozialverhaltens?
Es handelt sich um ein psychiatrisches Störungsbild bei Kindern und Jugendlichen, das durch aggressives, dissoziales und aufsässiges Verhalten gekennzeichnet ist, welches gegen soziale Normen verstößt.
Haben Jungen mit dieser Störung Defizite in der Empathie?
Die Studie belegt insbesondere Defizite im Bereich der kognitiven Empathie, wie der Fähigkeit zur Emotionsattribution (Gründe für Gefühle anderer finden) und der kognitiven Reaktivität auf negative Emotionen.
Was besagt der "Violence Inhibition Mechanism" (VIM)?
Der VIM nach Blair ist ein angeborener Mechanismus, der durch die Wahrnehmung von Not oder Angst beim Gegenüber eine Hemmung der eigenen Aggression auslöst. Ein Defekt dieses Mechanismus wird mit psychopathischen Zügen in Verbindung gebracht.
Was ist der Unterschied zwischen kognitiver und emotionaler Empathie?
Kognitive Empathie ist das Verstehen der Perspektive und Gefühle anderer, während emotionale (affektive) Empathie das tatsächliche Mitfühlen oder die emotionale Reaktion auf den Zustand des anderen beschreibt.
Welche Rolle spielen negative Emotionen in der Untersuchung?
Auffälligkeiten zeigten sich besonders bei negativen Emotionen; die betroffenen Jungen fanden weitaus schlechtere Erklärungen für das Leid anderer und reagierten seltener mit angemessenen kognitiven Bewertungen.
- Quote paper
- Dipl.-Psych. Dominique Schmitt (Author), 2007, Empathisches Verstehen und Nachempfinden bei Jungen mit Störung des Sozialverhaltens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159579