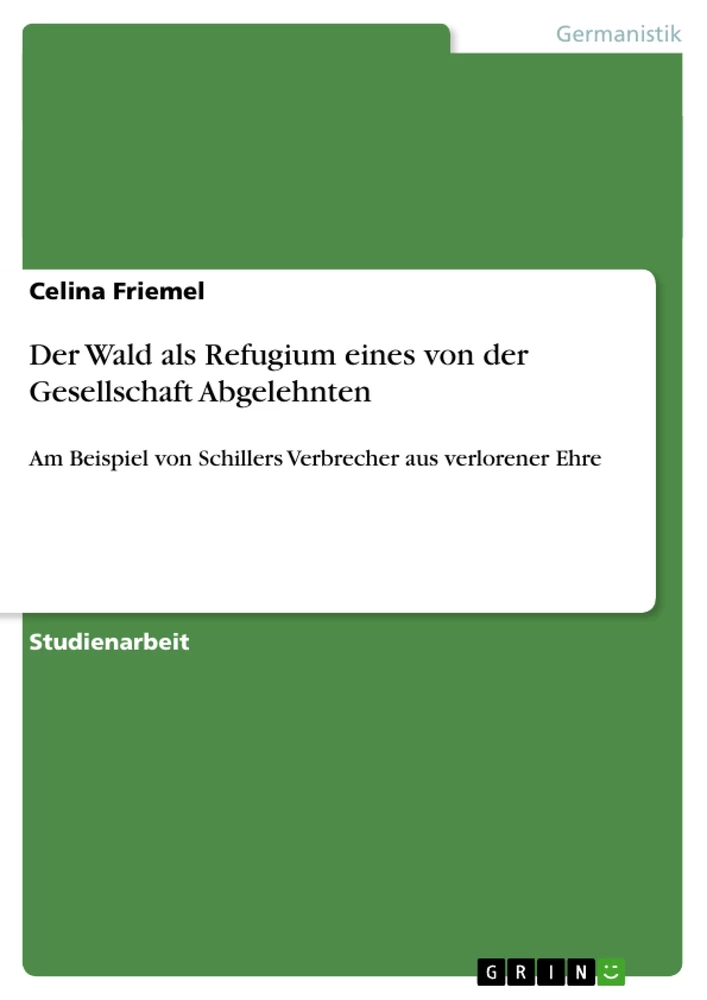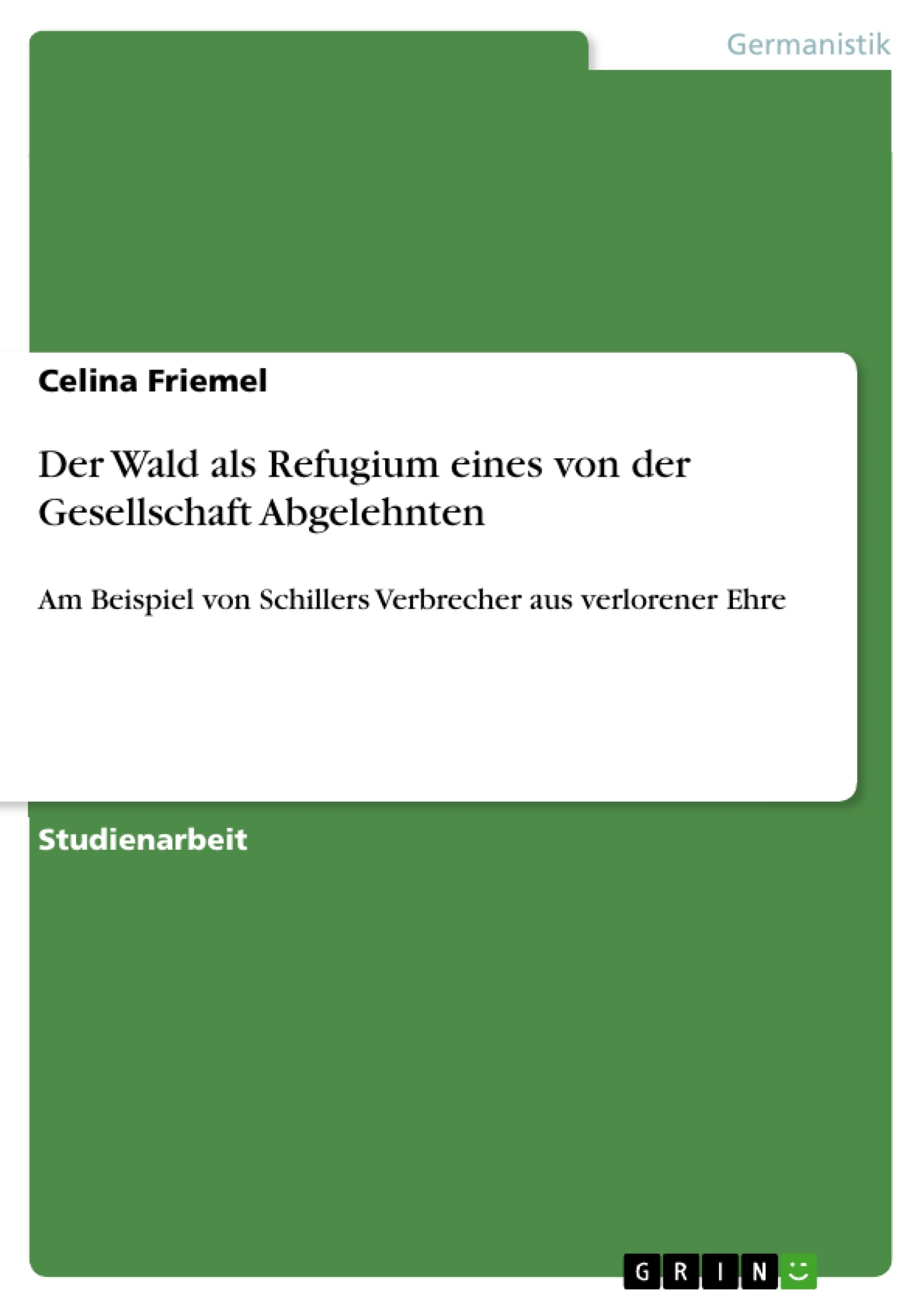"Haste was, dann biste was“, wird Friedrich Schiller im Volksmund aus seinem Gedicht Das Werthe und das Würdige zitiert. Fortführen lässt sich dieses Sprichwort konsequenterweise mit „Haste nichts, bist nichts“. Genau dieses Urteil findet sich auch in Schillers Erzählung Der Verbrecher aus verlorener Ehre.
Schiller porträtiert in selbiger, teilweise auch aus der Sicht des Protagonisten selbst, die Biografie des Sonnenwirts Christian Wolf, die auf der wahren Begebenheit des Falles Fridrich Schwans beruht. Dieser wird zum Wilddieb und Mörder, infolgedessen von der Gesellschaft geächtet und zuletzt sogar zum Tode verurteilt.
Doch legt Schiller in seinem Werk das Hauptmerk nicht auf die Gräueltaten des Protagonisten, sondern vielmehr auf die „verhältnismäßig große Kraft“, die zu solchen verleitet. Aufgrund seiner medizinisch-naturwissenschaftlichen Studien und seiner 2-jährigen Tätigkeit als Militärarzt in Stuttgart besaß Friedrich Schiller ein großes psychologisches Interesse. Höchstwahrscheinlich beeinflusste dieses zusammen mit der Forderung der aufklärerischen Epoche, „in selbstständiger Gedankenbewegung zu jeweils ›eigenen‹ Einsichten zu gelangen“, Schillers Wahl der vorliegenden analytischen Erzählweise. Durch die subjektive Schilderung des Protagonisten und die einführende Beschreibung von Wolfs Ausgangssituation durch den Erzähler „macht Schiller sich im Grunde sogar zum Anwalt des Verbrechers aus verlorener Ehre“. Er weist den Leser hier darauf hin, dass Wolf als Halbweise mit nicht sonderlich attraktivem äußerlichen Erscheinungsbild und einem niedrigen sozialen Stand zum „social outcast“ wird und appelliert an das Publikum „selbst zu Gericht zu sitzen“.
Wie auch Schillers Intension markiert meine Arbeit die psychoanalytische Vorgehensweise, die ich durch die Symbolanalytik der zwei Handlungsorte Wald und Stadt im Folgenden verdeutlichen werde.
Inhaltsverzeichnis
- ,,Der Wald als Refugium eines von der Gesellschaft Abgelehnten“ – Veranschaulicht am Beispiel von Schillers Verbrecher aus verlorener Ehre
- Der Verbrecher ohne Motive?
- Symbolik des Waldes und der Stadt
- Der Wald als Symbol in der Literatur
- Der Wald im Gegensatz zur Stadt
- Wald und Stadt im Verbrecher aus verlorener Ehre
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die psychologische Dimension des Verbrechens in Schillers Erzählung "Der Verbrecher aus verlorener Ehre". Sie analysiert die Bedeutung des Waldes als Refugium für den Protagonisten Christian Wolf, der von der Gesellschaft abgelehnt wird. Der Fokus liegt auf der Symbolanalytik von Wald und Stadt, wobei insbesondere die psychoanalytische Perspektive des Waldes als Sinnbild des Unbewussten beleuchtet wird.
- Der Verbrecher als Opfer der Gesellschaft
- Der Wald als Symbol der Abgeschiedenheit und des Unbewussten
- Der Gegensatz von Wald und Stadt als Ausdruck von Natur und Kultur
- Psychoanalytische Deutung der Handlungsorte
- Schillers Darstellung der gesellschaftlichen Ausgrenzung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel untersucht die Figur des Christian Wolf und stellt ihn als „Verbrecher ohne Motive“ dar. Es zeigt, wie Schillers psychologisches Interesse in der Darstellung von Wolfs Lebensweg zum Ausdruck kommt. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Symbolik von Wald und Stadt. Es beleuchtet die vielfältigen Bedeutungen des Waldes in der Literatur und stellt den Wald als Gegenpol zur städtischen Gesellschaft dar. Der Wald wird als Ort der Abgeschiedenheit, des Unbewussten und der Ungewissheit beschrieben. Das Kapitel untersucht auch die Stadt als Symbol der Ordnung und Sicherheit, die im Kontrast zum Wald steht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: "Der Verbrecher aus verlorener Ehre", Friedrich Schiller, Symbolanalyse, Wald, Stadt, Unbewusstes, Abgeschiedenheit, Gesellschaftliche Ausgrenzung, Psychoanalytische Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Schillers Erzählung "Der Verbrecher aus verlorener Ehre"?
Die Erzählung porträtiert die Biografie des Sonnenwirts Christian Wolf, der durch soziale Ausgrenzung zum Wilddieb und Mörder wird.
Welcher reale Fall diente als Vorlage für die Geschichte?
Schiller bezog sich auf die wahre Begebenheit des Falles Friedrich Schwan, dessen Schicksal er psychologisch analysierte.
Welche Symbolik hat der Wald in der Erzählung?
Der Wald dient als Refugium für den von der Gesellschaft Abgelehnten. Er steht symbolisch für das Unbewusste, die Abgeschiedenheit und den Gegenpol zur geordneten Stadt.
Wie unterscheidet sich die Stadt vom Wald in Schillers Werk?
Während die Stadt für Kultur, soziale Ordnung und Sicherheit steht, repräsentiert der Wald Natur, Gesetzlosigkeit und die Isolation des "Social Outcast".
Warum wird Christian Wolf zum Verbrecher?
Schiller zeigt auf, dass Wolf aufgrund seines Aussehens und niedrigen sozialen Standes von der Gesellschaft geächtet wird, was ihn schließlich in die Kriminalität treibt.
- Citar trabajo
- Celina Friemel (Autor), 2010, Der Wald als Refugium eines von der Gesellschaft Abgelehnten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159582