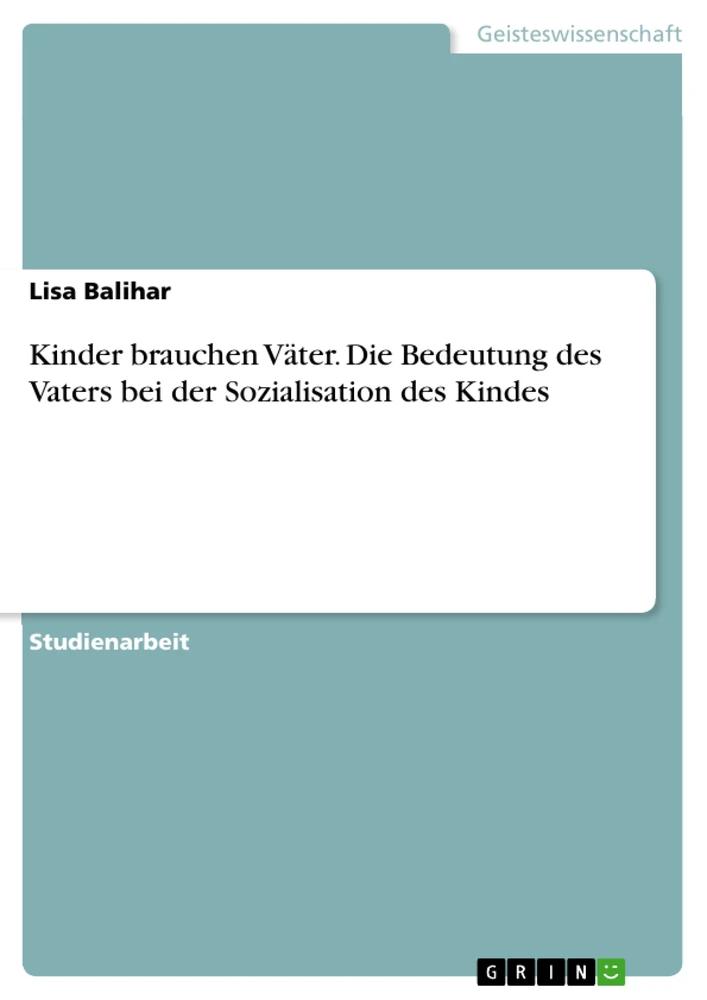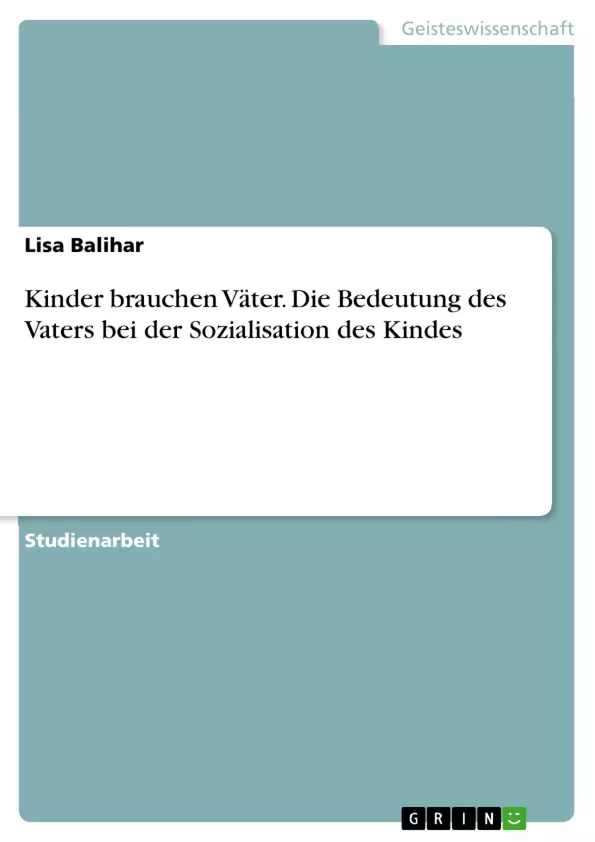Die Familie ist die primäre Sozialisationsinstanz für Kinder, die ihnen weiteren Werdegang maßgeblich beeinflusst. Sie ist die erste Gruppe, der ein Individuum angehört und sie prägt sowohl die physische, kognitive, emotionale, psychische aber auch die soziale Entwicklung des Kindes. In den ersten Jahren werden so die Grundstrukturen der Persönlichkeit festgelegt (vgl. Textor 1991). Die Rolle des Vaters bei der Entwicklung des Kindes wurde früher oft als nebensächlich behandelt, doch seit den 1980er Jahren ist die Vaterforschung auch in diesem Bereich intensiviert worden. Die Annahme in der Bindungstheorie ist, dass beide Elternteile Bezugspersonen für das Kind darstellen, die es beeinflussen.
Wie im Anfangszitat erkennbar, wende ich mich in meiner Hausarbeit der Frage zu, welchen Anteil der Vater zur Entwicklung und Erziehung des Kindes beiträgt und welche Einflüsse dabei auf ihn selbst wirken und ihn evtl. behindern können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sozialisationsbegriff und Väterforschung
- Historisch-gesellschaftliche Ausgangslage des 18. - 20. Jahrhunderts
- Väter und Einflussfaktoren die heute auf sie wirken
- Väter zwischen Erwerbstätigkeit und Familie
- Vater-Kind-Beziehungen und ihre Bedeutung
- Das Geschlecht des Kindes
- Das Fehlen der Vaterfigur
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Bedeutung des Vaters in der Sozialisation des Kindes. Sie untersucht die historische Entwicklung der Vaterrolle sowie die gegenwärtigen Einflussfaktoren, die auf Väter wirken. Die Arbeit beleuchtet die Vater-Kind-Beziehung und ihre Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf das Geschlecht des Kindes. Schließlich betrachtet sie die Auswirkungen der Abwesenheit einer Vaterfigur auf die Entwicklung des Kindes.
- Die historische Entwicklung der Vaterrolle
- Einflussfaktoren, die auf Väter wirken, insbesondere die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Die Bedeutung der Vater-Kind-Beziehung für die kindliche Entwicklung
- Die Auswirkungen der Abwesenheit eines Vaters auf das Kind
- Der Einfluss des Geschlechts des Kindes auf die Vater-Kind-Beziehung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und skizziert den Forschungsgegenstand, die Forschungsfrage und die Struktur der Arbeit. Kapitel 2 behandelt den Begriff der Sozialisation und die Entwicklung der Väterforschung. Es beleuchtet die historische Entwicklung der Vaterrolle von der Antike bis zur Neuzeit, wobei die sich verändernden gesellschaftlichen und familiären Strukturen im Fokus stehen. Kapitel 3 analysiert die Einflussfaktoren, die auf Väter in der heutigen Zeit wirken, vor allem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Kapitel 4 widmet sich der Vater-Kind-Beziehung und ihrer Bedeutung für die Entwicklung des Kindes. Dabei wird auch die Rolle des Geschlechts des Kindes berücksichtigt. Schließlich widmet sich Kapitel 5 den Folgen der Abwesenheit eines Vaters für die Entwicklung des Kindes.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Väterforschung, Sozialisation, Vaterrolle, Vater-Kind-Beziehung, Einflussfaktoren auf Väter, Abwesenheit des Vaters, Familienstrukturen, geschlechtsspezifische Unterschiede, Entwicklung des Kindes.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat der Vater für die Sozialisation des Kindes?
Der Vater prägt maßgeblich die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung des Kindes und dient als wichtige zweite Bezugsperson neben der Mutter.
Wie hat sich die Vaterrolle historisch entwickelt?
Vom autoritären Familienoberhaupt früherer Jahrhunderte hin zu einem involvierten, emotional präsenten Erziehungspartner in der Moderne.
Welche Faktoren behindern Väter heute in ihrer Erziehungsrolle?
Vor allem der Konflikt zwischen Erwerbstätigkeit und dem Wunsch nach mehr Zeit für die Familie stellt viele Väter vor Herausforderungen.
Spielt das Geschlecht des Kindes eine Rolle für die Vater-Kind-Beziehung?
Ja, die Forschung zeigt, dass Väter oft unterschiedliche Interaktionsmuster bei Söhnen und Töchtern zeigen, was die geschlechtsspezifische Entwicklung beeinflusst.
Was sind die Folgen eines fehlenden Vaters?
Die Abwesenheit einer Vaterfigur kann Auswirkungen auf die psychische Stabilität und die soziale Identitätsbildung des Kindes haben.
- Citar trabajo
- Lisa Balihar (Autor), 2009, Kinder brauchen Väter. Die Bedeutung des Vaters bei der Sozialisation des Kindes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159629