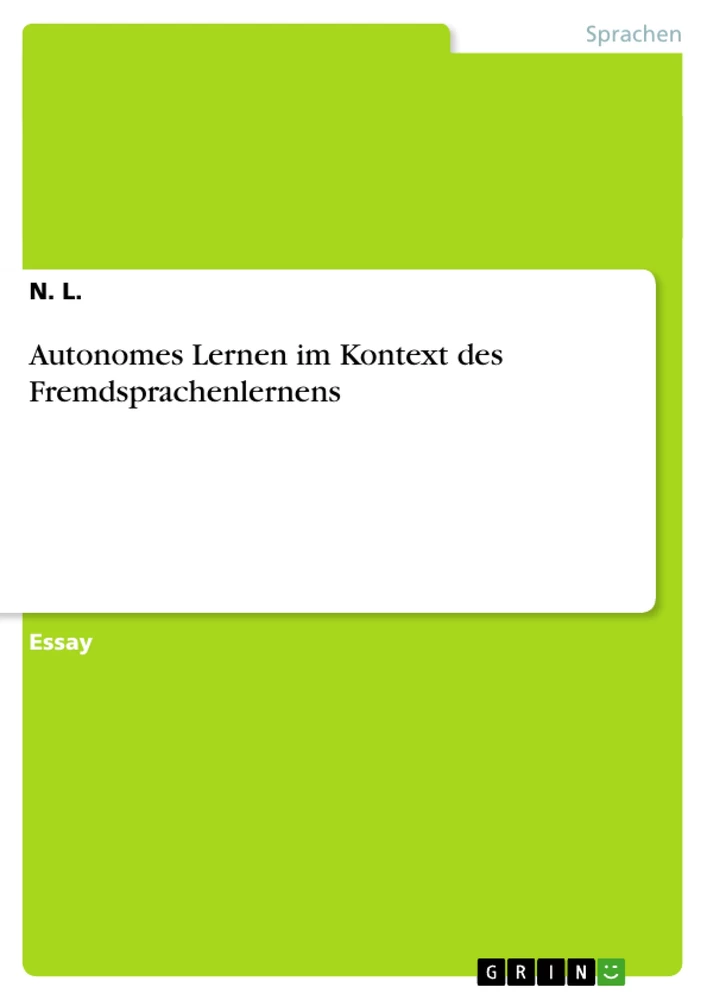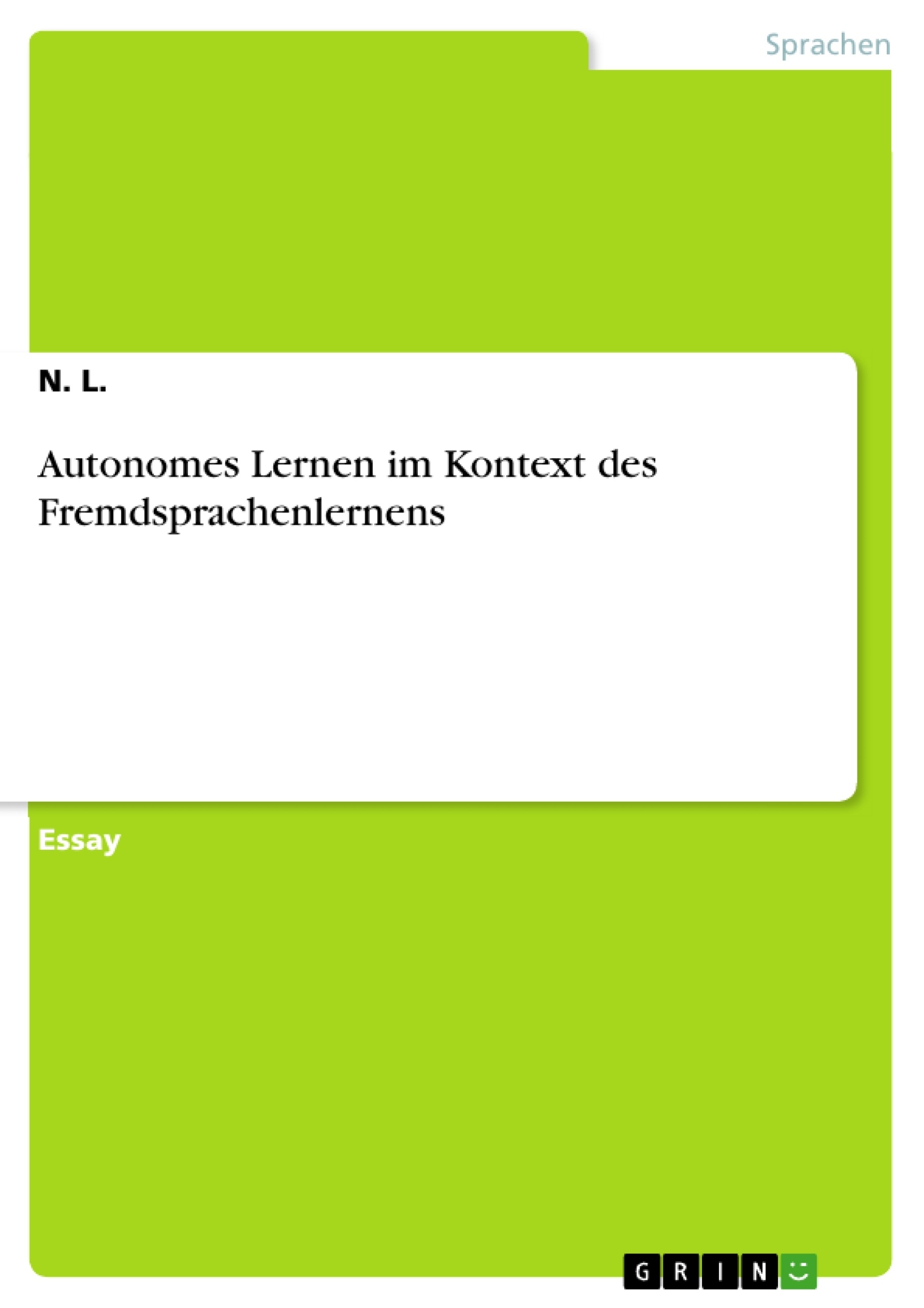Die folgende Arbeit widmet sich dem Konzept der Lernerautonomie und des selbst gesteuerten Fremdsprachenlernens, welches sich in der fremdsprachendidaktischen Dimension als eine neue Lernform etabliert hat, um der Komplexität des Fremdsprachenlernens entgegenzuwirken.Die Idee, die Orientierung auf die Fremdsprachenlerner als aktive Teilhaber im eigenen Lernprozess zu verlagern, wurde als theoretisches Konzept zunächst von Holec(1981) in die wissenschaftliche Diskussion eingebracht und später von anderen Fremdsprachendidaktikern weiterentwickelt. Dadurch rückte der individuelle Charakter des Fremdsprachenlernens immer mehr in den Mittelpunkt.
Das Ziel der folgenden Arbeit ist es, einige Grundelemente der autonomen Lernkonzepte vorzustellen, Gründe für die Notwendigkeit der Veränderung des Lernverhaltens in Richtung des autonomen Lernens zu skizzieren und das Konzept im Hinblick auf seine Grenzen und Ziele zu untersuchen.
Zunächst sollen in einem kurzen Überblick die Ursprünge des autonomen Lernens skizziert werden, wobei die fremdsprachendidaktischen Defizite der 60er und frühen 70er Jahre (die Lernende als Konsumenten von produktorientierten Curricula, die den Spielraum für selbstständiges Handeln auf ein Minimum reduzierten) sowie der emanzipatorische Aspekt des Fremdsprachenlernens seit Mitte der 70er Jahre (die ersten Entwürfe der kommunikativen lernerzentrierten Didaktik sowie der pädagogische Freiraum der Lehrenden und der individuelle Spielraum der Lernenden) den Interessenschwerpunkt bilden sollen.
Darauf folgend wird eine definitorische Annäherung zum Gegenstandsbereich – Lernerautonomie und selbst gesteuerten Fremdsprachenlernen – vorgenommen. Gleichzeitig werden für das Konzept charakteristische Merkmale zur Einführung in die Thematik stets miteinbezogen.
In einem weiteren Schritt soll den Fragen nachgegangen werden, warum Lernerautonomie im Fremdsprachenunterricht gefördert werden sollte und welche Ziele damit verfolgt werden.
Der nächste Punkt widmet sich den Lernstrategien, wobei die unterschiedlichen Lerntechniken und Lernstile sowie einige lehrmethodische Maßnahmen zur Vermittlung dargestellt werden sollen.
Das letzte Unterkapitel dieser Arbeit befasst sich mit der Frage nach der konkreten Umsetzbarkeit der theoretischen Überlegungen zum autonomen Lernen. Hier sollen einige spezifische instruktionsmethodische Maßnahmen vorgestellt werden, die die Selbständigkeit des Lernenden im institutionellen Fremdsprachenunterricht unterstützen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkungen
- Die Ursprünge des autonomen Lernens
- Definition des Gegenstandsbereichs und die charakteristischen Merkmale
- Weltners Auffassung von Lernerautonomie
- Dickinsons Verständnis des autonomen Lernens
- Autonomes Lernen im engeren und im weiteren Sinn
- Bleyhls neurowissenschaftliche Konzeptualisierung des autonomen Lernens
- Bensons drei Versionen des autonomen Lernens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Lernerautonomie und des gesteuerten Fremdsprachenlernens, die sich als eine neue Lernform im Bereich der Fremdsprachendidaktik etabliert haben, um der Komplexität des Fremdsprachenlernens entgegenzuwirken. Ausgehend von den Erkenntnissen aus der kognitiven und konstruktivistischen Lerntheorie werden autonome Lernkonzepte vorgestellt, die darauf ausgerichtet sind, den eigenen Lernprozess für den einzelnen Fremdsprachenlerner transparenter und somit effizienter zu gestalten.
- Die Entwicklung des Konzepts der Lernerautonomie in der Fremdsprachendidaktik
- Die Rolle des Lernenden als aktiver Teilhaber am eigenen Lernprozess
- Die verschiedenen Auffassungen von Lernerautonomie und selbst gesteuertem Lernen
- Die Bedeutung der Selbststeuerung und Selbstorganisation im autonomen Lernprozess
- Die drei Versionen des autonomen Lernens nach Benson: technische, psychologische und politische
Zusammenfassung der Kapitel
Vorbemerkungen
Dieses Kapitel legt den Grundstein für die Analyse des Konzepts der Lernerautonomie, indem es die dynamische Natur des Fremdsprachenlernens und dessen Komplexität hervorhebt. Es wird argumentiert, dass das Fremdsprachenlernen ein langwieriger und komplizierter Prozess ist, der von zahlreichen Faktoren abhängt.
Die Ursprünge des autonomen Lernens
Dieses Kapitel betrachtet die Anfänge des lernerzentrierten Fremdsprachenlernens und der Lernerautonomie. Es wird der Wechsel vom behavioristischen zum kognitivistischen Lernverhalten in den 70er Jahren beleuchtet und die Bedeutung des Kognitivismus für die Entwicklung des Konzepts der Lernerautonomie erläutert.
Definition des Gegenstandsbereichs und die charakteristischen Merkmale
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition des autonomen Lernens und den vier charakteristischen Merkmalen: Eigeninitiative, Selbstbestimmung der Lernziele, unabhängige Steuerung des Lernprozesses und Selbstüberwachung des Lernerfolgs. Es werden verschiedene Konzeptualisierungen des autonomen Lernens in der internationalen Fachdidaktik vorgestellt, die jeweils auf einen speziellen Aspekt fokussieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Lernerautonomie, selbstgesteuertes Fremdsprachenlernen, kognitivistische Lerntheorie, konstruktivistische Lerntheorie, Selbststeuerung, Selbstorganisation, Fremdsprachendidaktik, Lernstrategien, Lernprozess, Lernziele, Lernmethoden, Lernumgebung.
- Quote paper
- Magister Germanistin N. L. (Author), 2009, Autonomes Lernen im Kontext des Fremdsprachenlernens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159658